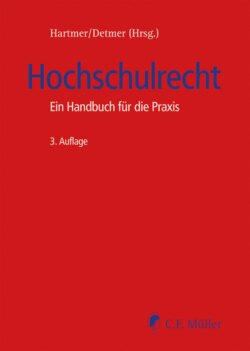Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 64
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Abschlussbezeichnungen (Grade)
Оглавление32
Während die Fachhochschulen in ihrer Anfangszeit ihren Absolventen noch akademische Grade wie beispielsweise „Ing. (grad.)“ oder „Betriebswirt (grad.)“ verliehen, bestimmten die Landeshochschulgesetze basierend auf der vor der Föderalismusreform rahmensetzenden Vorgabe des § 18 Abs. 1 Satz 2 HRG einheitlich, dass der nunmehr im Auslaufen begriffene Diplomgrad[111] an Fachhochschulen mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) verliehen wird.[112] Damit wurde seinerzeit der lange verfolgte Gedanke eines einheitlichen Diplomgrades für alle Hochschulformen[113] aufgegeben, obgleich das BVerfG in seinem Beschluss vom 3.12.1980[114] diesbezüglich keine verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert hatte. Zwar seien das Universitäts- und das Fachhochschulstudium vom Ausbildungsinhalt und Ausbildungsziel zwar „nicht in allem gleichartig.“[115] Jedoch würden sie erhebliche Gemeinsamkeiten aufweisen, wie die „in § 7 HochSchRG festgelegten bundesgesetzlichen Zielsetzungen“ zeigen. „Der einheitliche Diplomgrad [sei] daher als berufsqualifizierender Abschluss … letztlich eine Konsequenz des gemeinsamen Studienziels und insoweit Ausdruck der im Hochschulbereich trotz aller Differenzierungen angestrebten Gemeinsamkeit und Gleichwertigkeit.“[116] Dessen ungeachtet hat das BVerfG in dem Zusatz „FH“ keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG ausmachen können, sondern betont, dass sich der Gesetzgeber insoweit „innerhalb des hier für die Normsetzung offenen Gestaltungsspielraums“ hält.[117]
33
Die damit verbundene Unterscheidung von Diplomgraden der Universität und der Fachhochschule bedeutet keinesfalls eine Abwertung des Fachhochschuldiploms, sondern bringt vielmehr die Unterschiede zwischen den beiden Hochschulformen durch berufsbezogene Zusätze bei den Berufsgraden zum Ausdruck.[118] Zwar sind Praxis- und Wissenschaftsbezug prägende Merkmale eines jeden Hochschulstudiums, jedoch ist – wie zuvor ausgeführt – das Studium an der Universität wissenschaftsbezogener und das Studium an der Fachhochschule praxisbezogener.[119] Die Kennzeichnungspflicht hinsichtlich des an einer Fachhochschule erworbenen Diplomgrades entspricht daher auch den Anforderungen der Praxis.[120] Auf dem Arbeitsmarkt wird nach wie vor zwischen dem an einer Universität und dem an einer Fachhochschule erworbenen Diplomgrad unterschieden. Beim Zusatz „FH“ handelt es sich somit nicht um eine Diskriminierung des an einer Fachhochschule erworbenen Diplomgrades; vielmehr stellt er die durch den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebotene Differenzierung nach seiner Eigenart sicher.[121] Dessen ungeachtet obliegt es in der Konsequenz der vorgenannten Feststellungen des BVerfG der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, ob er die Unterschiede zwischen Fachhochschul- und Universitätsstudiengängen durch herkunftsbezogene Zusätze der Abschlüsse zum Ausdruck bringt.[122] Auch wird das Persönlichkeitsrecht des Fachhochschulabsolventen nicht notwendig durch die Anfügung des Zusatzes verletzt,[123] ebenso wenig wie Universitätsabsolventen durch die Verleihung eines auf die Fachhochschulen hinweisenden Abschluss an Fachhochschulabsolventen unzulässigerweise in ihren Grundrechten berührt werden.[124]
34
Daher wäre es rechtlich unbedenklich gewesen, den Grad eines Bachelors oder eines Masters mit einem auf den Hochschultyp hinweisenden Zusatz zu verleihen, wie es der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5.3.1999[125] intendierte. Für die stärker theorieorientierten – mithin universitären – Studiengänge sollten die Abschlussbezeichnung Bachelor/Master of Arts (Bakkalaureus/Magister Artium) und Bachelor/Master of Science (Bakkalaureus/Magister Scientiarum) ohne fachliche Zusätze verwandt werden, während für stärker anwendungsorientierte – mithin an den Fachhochschulen angebotene[126] – Studiengänge dagegen die Abschlussbezeichnung mit Fachzusätzen entsprechend den jeweiligen Fächergruppen verwandt werden sollten (z.B. Bachelor/Master of Engineering, Bachelor/Master of Business Administration, Bachelor/Master of Social Work).[127]
35
Ungeachtet des vorgenannten KMK-Beschlusses sind Bachelor- und Master-Studiengänge für alle Hochschularten undifferenziert eingeführt worden[128], um – so die Gesetzesbegründung – die Position der Fachhochschulen zu stärken.[129] Nunmehr dürfen Fachhochschulen dieselben Abschlüsse wie Universitäten verleihen. Im Gegensatz zum Diplom müssen die Abschlüsse nicht einmal mit dem Hochschultyp kennzeichnenden Zusatz (z.B. „FH“) versehen werden. Der Grund hierfür wird in dem Umstand gesehen, dass die Universitäten ihre Studiengänge bis zum Bachelor wie die Fachhochschulen auf eine Berufsqualifikation hin anlegen müssen.
36
Bemerkenswert ist insoweit die z.B. in NRW in § 66 Abs. 1 Satz 2 Hs. 1 HG eröffnete Option, sowohl den Bachelor- als auch den Mastergrad mit einem Zusatz zu verleihen, der auch die verleihende Hochschule bezeichnet. Da der Grad auch ohne diesen Zusatz geführt werden kann (§ 66 Abs. 1 Satz 2 Hs. 2 HG NRW), hängt es letztlich vom Selbstverständnis der Universität oder der Fachhochschule ab, ob sie ihre Abschlüsse als „Marke“ versteht und entsprechend kennzeichnet. Gerade für bekanntermaßen herausragende Studiengänge stellt dies eine nicht zu unterschätzende Option dar.[130]
37
Diese vorgenannte Entwicklung schlägt sich zwangsläufig auch in der laufbahnrechtlichen Einordnung der Hochschulabschlüsse nieder. Während das Fachhochschuldiplom im Gegensatz zu universitären Abschlüssen nach allgemein geteilter Auffassung, die sich insofern auf die mittlerweile aufgehobenen Regelungen der §§ 13 und 14 BRRG sowie § 23 Abs. 2 BBesG stützen, nicht die Zulassungsvoraussetzungen für den höheren Dienst, sondern nur für den gehobenen Dienst erfüllt,[131] führen nunmehr die Studiengänge zum Bachelor sowohl an Fachhochschulen wie auch an Universitäten zur Laufbahnbefähigung zum gehobenen Dienst.[132] Mit einem erfolgreichen Abschluss eines Master-Studienganges an einer Universität wie an einer Fachhochschule erwerben die Absolventen die Zugangsberechtigung zum höheren Dienst.[133] In Bayern eröffnet ein Masterabschluss an einer Fachhochschule gem. Art. 26 Abs. 1 Nr. 1 BayBG aber nur dann den Zugang zum höheren Dienst, wenn der Fachhochschulstudiengang in einem förmlichen Verfahren als laufbahnrechtlich gleichwertig anerkannt wurde. Augenscheinlich wird insofern an die Vereinbarung der Ständigen IMK und der KMK vom 24.5.2002 bzw. 6.6.2002 zum „Zugang zu den Laufbahnen des höheren Dienstes durch Masterabschlüsse an Fachhochschulen“ (noch) festgehalten, obgleich die aktualisierte Vereinbarung der Ständigen IMK und der KMK vom 7.12.2007 bzw. 20.9.2007[134] hierzu feststellt, dass die studiengangsbezogene Akkreditierung im erforderlichen Umfange sicherstelle, dass die Masterabschlüsse an Fachhochschulen die Bildungsvoraussetzungen für den öffentlichen Dienst erfüllen; einer gesonderten Feststellung bedürfe es nicht mehr. Dieser Vereinbarung folgen indes auch neuere, nach der Föderalismusreform in Kraft getretene Beamtengesetze der Länder nicht in der beschriebenen Konsequenz: So verlangt z.B. § 9 Abs. 1 Nr. 4b LBG NRW, dass der an einer Fachhochschule erworbene Mastergrad nur dann den Weg in die Laufbahnen des höheren Dienstes eröffnet, wenn das Studium an der Fachhochschule in einem Akkreditierungsverfahren als für den höheren Dienst geeignet eingestuft wurde.