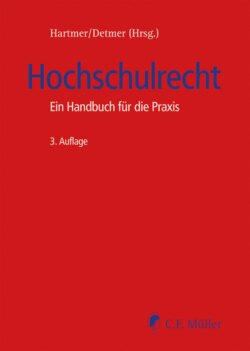Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 84
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Pädagogische Hochschulen, Berufsakademien, duale Hochschulen und deren Aufgaben
Оглавление25
Da es Pädagogische Hochschulen als eigenständige Institutionen derzeit nur noch in Baden-Württemberg gibt, kann man sich hierzu auf das dortige Landesrecht beziehen. Auch das Modell der Berufsakademien ging zunächst von Baden-Württemberg aus. Es hat sich aber nicht nur auf andere Länder erweitert,[26] sondern insbesondere in Baden-Württemberg einem Wandel unterzogen, der sich heute mit dem Begriff „duale Hochschule“ manifestiert. Die Institutionen der Pädagogischen Hochschule einerseits und der dualen Hochschule anderseits sind deutlich voneinander zu unterscheiden, wobei es in diesem Abschnitt nur um die Aufgabenstellung geht. Sie haben auch miteinander nichts gemeinsam, sondern werden nur deshalb in diesem Abschnitt gemeinsam behandelt, weil es sich um Sonderformen als Hochschularten handelt, die man in Vergleich zu den Universitäten und Fachhochschulen setzen kann.
26
Die Aufgaben der Pädagogischen Hochschulen sind dadurch geprägt, dass diese als Spezialhochschulen mit einem segmentär definierten Auftrag angesehen werden.[27] Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 LHG BW obliegen den Pädagogischen Hochschulen „lehrerbildende und auf außerschulische Bildungsprozesse bezogene wissenschaftliche Studiengänge; im Rahmen dieser Aufgaben betreiben sie Forschung“. Man könnte sie also als Spezialuniversitäten bezeichnen. Sie werden dementsprechend auch in den Listen der „den Universitäten gleichgestellten Hochschulen“ geführt. Das LHG BW drückt sich diesbezüglich folgendermaßen aus (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 Hs. 2): „sie sind bildungswissenschaftliche Hochschulen universitären Profils mit Promotions- und Habilitationsrecht“. Gleichzeitig sind sie im Hinblick auf die Lehramtsvorbereitung Hochschulen für ein Segment des öffentlichen Dienstes.[28] In Bezug auf die – auch bereits im Vorgängergesetz verwendete – Formulierung, dass sich der Aufgabenumfang auch auf „außerschulische Bildungsprozesse“ bezieht, wird indes deutlich, dass es nicht ausschließlich um Lehramtsstudiengänge und die diesbezügliche Lehre und Forschung geht. Näheres erfährt man, wenn man sich die Institute und Studienangebote der einzelnen Pädagogischen Hochschulen ansieht.[29] Die Aufgaben in der Lehre und der Forschung sind nur durch diese generelle inhaltsbezogene Aufgabenbegrenzung, also in Bezug auf die Fächer und Forschungsdisziplinen eingeschränkt, nicht im Hinblick auf die Methoden und Intensität der Forschung.[30] Insoweit ist anerkannt, dass der Forschungsauftrag der Pädagogischen Hochschulen auch Grundlagenforschung umfasst, wobei zur Forschung sowohl die Gewinnung als auch die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse gehört.[31] Mit der Aufgabe der (wissenschaftlichen) Nachwuchsförderung sind die Pädagogischen Hochschulen auch insoweit zwar fachlich gebunden, aber ansonsten universitätsgleich, was sich vor allem durch die Zuweisung des Promotions- und Habilitationsrechts manifestiert. Damit werden die Pädagogischen Hochschulen von den Veränderungen des Habilitationsrechts im Sinne alternativer Zugänge zum Hochschullehrerberuf (insbesondere durch das Institut der Juniorprofessuren) und die damit verbundene Praxis ebenfalls den Universitäten entsprechend betroffen. Das Gleiche gilt für die Tendenzen und Überlegungen, Staatsprüfungen im Lehramtsbereich mit dem Bachelor-Master-Modell in Einklang zu bringen oder in diesem Bereich ganz abzuschaffen.
27
Die Aufgaben der Berufsakademien und dualen Hochschulen sind demgegenüber mit denen der Fachhochschulen in Vergleich zu setzen. Anfangs gehörten die Berufsakademien in Baden-Württemberg nicht zu den Hochschulen im Sinne des HRG, obwohl sie dem tertiären Bildungsbereich zugerechnet werden sollten (vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 BAG BW alte Fassung[32]). Das hat sich mit dem in Rn. 24 am Ende genannten 3. HRÄG, also der Neufassung des LHG BW, derzeit wie folgt geändert: Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (Duale Hochschule, DHBW) mit Sitz in Stuttgart gehört zum Kanon der staatlichen Hochschulen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 LHG BW). Ihr ist die Aufgabe zugewiesen „durch die Verbindung des Studiums an der Studienakademie mit der praxisorientierten Ausbildung in den beteiligten Ausbildungsstätten (duales System) die Fähigkeit zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in der Berufswelt“ zu vermitteln. Zudem ist ihr aufgetragen, „im Zusammenwirken mit den Ausbildungsstätten auf die Erfordernisse der dualen Ausbildung bezogene Forschung (kooperative Forschung)“ und im Rahmen ihrer Aufgaben Weiterbildung zu betreiben (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 LHG BW). Diese gesetzliche Aufgabenbestimmung zeigt, dass sich der oben skizzierte Angleichungsprozess zwischen Universitäten und Fachhochschulen hier – gewissermaßen nach unten – im Verhältnis von Fachhochschule zur dualen Hochschule fortsetzt. Die Duale Hochschule rückt als staatliche Hochschule auf ein von den Fachhochschulen nun weniger beackertes Feld und damit in Aufgabenbereiche, die früher deutlicher den Fachhochschulen zugewiesen waren. Das ist insoweit folgerichtig, wenn man davon ausgeht, dass es Studiengänge geben soll, die berufliche Praxis und akademisches Studium eng miteinander verbinden und zügig zu berufsqualifizierenden Hochschulabschlüssen führen sollen. Verschiebt man einen Bestandteil im tertiären Bildungsbereich „nach oben“, schafft man Platz für das Aufrücken eines anderen.
Ebenso und folgerichtig ist in organisatorischer Hinsicht der frühere Befund nach der alten Rechtslage zu korrigieren, dass den bisherigen Berufsakademien in Baden-Württemberg kein Recht der Selbstverwaltung zukomme.[33] Die Sonderbestimmungen der §§ 27a bis 27d LHG BW greifen auf die hochschultypische Systematik und auf akademische Organ- und Amtsbezeichnungen zurück, ohne dass der zugewiesene Kompetenzrahmen indes mit dem identisch wäre, der an den Universitäten, Fach- und Kunsthochschulen des Landes gewährleistet ist. Das Gesetz geht davon aus, dass die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart insgesamt der Rechtsnatur des § 8 Abs. 1 LHG BW mit der für die anderen Hochschulen tradierten Doppelnatur als Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich als staatliche Einrichtung unterliegt. Damit ergibt sich die Notwendigkeit körperschaftsrechtlicher akademischer Selbstverwaltung. Die in § 15 LHG BW konstituierte allgemeine Binnenstruktur mit der Gliederung in Fakultäten und deren Organe wird indes durch die oben erwähnten Sonderbestimmungen der §§ 27a bis 27d LHG BW verändert. Nach diesen Sondervorschriften gibt es zwar ebenfalls die zentralen Organe gemäß § 15 Abs. 1 und 2 LHG BW (also Rektorat, hier als „Präsidium der DHBW“ in § 15 Abs. 1 Nr. 1 LHG BW gesetzlich benannt; hinzu kommen der zentrale Senat und der zentrale Hochschulrat, der an der DHBW nach § 15 Abs. 2 S. 3 LHG BW „Aufsichtsrat“ genannt werden kann). Dezentral gliedert sich die DHBW indes in örtliche “Studienakademien als rechtlich unselbstständige örtliche Untereinheiten“ (§ 27a Abs. 1 S. 1 LHG BW). Sprachlich verwirrend dürfen sich diese Untereinheiten “Fakultäten“ nennen, ohne deren Rechtsstatus zu haben, was das Gesetz ausdrücklich betont (§ 27a Abs. 1 Sätze 2 und 3). Um diese Begriffsverwirrung noch zu erhöhen, wird jede Studienakademie von einer Rektorin oder einem Rektor vertreten, ohne diesen Amtsstatus im vergleichbaren Sinne zu den anderen Hochschularten in BW und im Bundesgebiet insgesamt zu haben. Denn sie sind ausdrücklich „keine Rektorinnen oder Rektoren im Sinne des § 16 Abs. 1“. (§ 27a Abs. 2 S. 1 und Abs. 4 S. 2 LHG BW). Zum oben erwähnten zentralen Aufsichtsrat der DHBW werden zusätzlich Örtliche Hochschulräte gebildet (§ 27b LHG BW). Das Gleiche gilt für Örtliche Senate (§ 27c LHG BW).
Bei derartigen Konstruktionen mit Sonderbestimmungen, aber der Verwendung von Begriffen unterschiedlichen Inhalts kann dem Rechtsanwender und Praktiker nur geraten werden, sich Status und Kompetenzrahmen der verschiedenen Institutionen einschließlich der jeweiligen Organe und Amtsträger genau anzusehen und nicht auf die im Landesrecht verankerten und dann in der Praxis verwendeten Bezeichnungen allein zu vertrauen. Denn es gibt – einfachgesetzlich in Baden-Württemberg festgelegt – nun Fakultäten, die keine sind, und Rektoren, die ebenfalls keine sind. Der ohnehin bundesweit zu verzeichnende Trend, dass Amtsinhaber mit denselben Bezeichnungen, aber unter einem anderen Regelungsregime mit unterschiedlichen Zuständigkeiten ausgestattet sind, erfährt hier eine besonders markante Ausprägung. Die Frage, ob es hier – ähnlich wie im Recht der Professorentitel und nach Maßgabe herkömmlicher Grundsätze im Beamtenrecht – verfassungsrechtliche Schranken gibt, die derartigen Begriffsverwirrungen entgegenstehen, ist noch zu beantworten, was an dieser Stelle nicht geschehen kann.
Hinsichtlich der Berufsakademien und dualen Hochschulen in anderen Bundesländern ist auf das dortige Hochschulrecht und den Umstand zu verweisen, dass es diese Einrichtungen sowohl in staatlicher als auch in privater Trägerschaft geben kann. Auf den letztgenannten Bereich wird in den Abschnitten zu den privaten Hochschulen und deren Anerkennungsfragen zurückzukommen sein. Man muss an dieser Stelle aber festhalten, dass derzeit als vierte Hochschulart – sowohl in Form staatlicher als auch privater Hochschulen organisiert – der Bereich der Dualen Hochschulen zu berücksichtigen ist, wenn man den Umfang des tertiären Bildungsbereichs insgesamt und vollständig erfassen will.
3. Kapitel Typisierung von Hochschulen: Pädagogische Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, kirchliche Hochschulen, private Hochschulen › II. Aufgabenzuweisungen › 5. Aufgaben der Kunsthochschulen (Kunst- und Musikhochschulen)