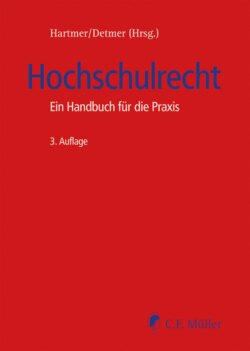Читать книгу Hochschulrecht - Группа авторов - Страница 86
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Aufgaben der nichtstaatlichen Hochschulen
Оглавление36
Die nichtstaatlichen (privaten oder kirchlichen) Hochschulen – insbesondere, wenn sie staatlich anerkannt sind oder diese Anerkennung anstreben – lassen sich den bisher erläuterten vier Hochschularten zuordnen. Es sollte sich also um nichtstaatliche Universitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen sowie jetzt auch um Berufsakademien oder duale Hochschulen handeln.[68] Damit ist in Bezug auf die Aufgaben dieser Hochschulen zunächst grundsätzlich festzustellen, dass es um die dementsprechenden hochschulartenspezifischen Primäraufgaben[69] geht, also Lehre mit den entsprechenden Hochschulabschlüssen, Graden und Titeln, Forschung und Entwicklung, Kunstausübung etc. Aus der Sicht der Praxis können gelegentlich Zweifel angebracht sein, ob sich jede[70] nichtstaatliche Hochschule allen – ihrer Hochschulart entsprechenden – Primäraufgaben in gleicher Weise stellt wie die im jeweiligen Bundesland befindlichen staatlichen Hochschulen oder ob es sich nicht hauptsächlich oder sogar ausschließlich um eine Veranstaltung für Lehre (mit Prüfungen u.Ä.) handelt. Rechtlich wurden diese Zweifel durch § 70 HRG genährt, der nach seinem Wortlaut für die staatliche Anerkennung auf notwendige Bedingungen der Primäraufgabe Lehre abstellte, nicht aber auf solche der anderen Primäraufgaben. Insbesondere die Ausstattung und Ausbauplanung gemäß § 70 Abs. 1 Nr. 2 HRG wurden nur auf die Studiengänge bezogen, wobei jeder Praktiker weiß, dass dies nur einen Teil der personellen, räumlichen, sächlichen, finanziellen und organisatorischen Vorkehrungen ausmacht, die bei vergleichbaren staatlichen Hochschulen zu fordern und auch regelmäßig gegeben sind. Diese Vielfalt macht ja gerade die Besonderheit und Qualität von Hochschulmanagement aus. Landesrechtlich ist diese Parallele zwischen staatlichen und privaten Hochschulen stärker verankert. So enthält z.B. das HG NRW eindeutig in § 72 Abs. 1 als Nr. 1 im Hinblick auf die nichtstaatlichen Universitäten und Fachhochschulen den Verweis auf die Hochschulaufgaben der staatlichen (jetzt vom Staat getragener körperschaftlichen) Hochschulen nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 HG NRW (Primäraufgaben der Universitäten und der Fachhochschulen), die wahrzunehmen seien; § 70 Abs. 1 Nr 1 KunstHG NRW regelt das Gleiche in Bezug auf die Primäraufgaben der nichtstaatlichen Kunsthochschulen im Vergleich zu ihren staatlichen Schwestern. Diese Vergleiche lassen sich besonders im Sinne einer gleichwertigen Aufgabenerfüllung mit entsprechendem Aufgabenumfang treffen. Geht man von dem Anspruch aus, dass die nichtstaatlichen Hochschulen eine gleichwertige Alternative zu den staatlichen Hochschulen bilden sollen, den nicht zuletzt die nichtstaatlichen Hochschulen im Wettbewerb für sich reklamieren, muss man das gesamte Spektrum der Primäraufgaben in den Blick nehmen. Dies bedeutet insbesondere für nichtstaatliche Universitäten die Beachtung des Grundsatzes der Einheit von Forschung und Lehre, für nichtstaatliche Kunsthochschulen die Beachtung der Aufgabentrias in Lehre, Kunstausübung und künstlerischen Entwicklungsvorhaben und für nichtstaatliche Fachhochschulen die Beachtung der zusätzlichen Aufgabe der (anwendungsbezogenen) Forschung. Dies ist ein auch für die Praxis und die behördlichen Verfahren einschließlich der Hochschulaufsicht durch die obersten Landesbehörden (Ministerien) wichtiger Maßstab. Diese Aufsichtsbefugnisse nach Maßgabe des Landesrechts enden nicht mit der Entscheidung über die staatliche Anerkennung. Hier zeigt sich im Übrigen eine weitere Problematik bezüglich der Diskrepanz zwischen dem formell- und dem materiellrechtlichen Hochschulbegriff (s.o. Rn. 7). Auf der anderen Seite steht den privaten Hochschulen im Rahmen solcher Anerkennungs- und Aufsichtsverfahren natürlich zu, Rechtsmittel einzulegen und gerichtliche Überprüfungen vornehmen zu lassen. Es handelt sich in aller Regel um begünstigende oder belastende Verwaltungsakte auf der Grundlage landesrechtlicher Bestimmungen. Die privaten Hochschulen können dieses Instrumentarium des öffentlichen Rechts (Verwaltungsrechts) in vollem Umfang wahrnehmen und sind nicht auf „guten Willen“ oder „Entgegenkommen“ der staatlichen Instanzen beschränkt. Es darf keine entscheidende Rolle spielen, ob Ministerialbeamte erfreut sind, wenn man gegen eine Entscheidung Widerspruch einlegt oder Klage erhebt (bzw. das in Aussicht stellt). Die Aufsichtsbehörden handeln eben nicht privatautonom, sondern gesetzlich gebunden (einschließlich Beurteilungs- und Ermessensspielräumen). Derartige Spielräume stehen aber auch den privaten Hochschulen nach Maßgabe des jeweiligen Hochschulgesetzes zu (z.B. bei den Berufungsverfahren im Rahmen der gesetzlich definierten Einstellungsvoraussetzungen).
37
Die nichtstaatlichen Hochschulen sind außerdem in die beiden Untergruppen der kirchlichen und privaten Hochschulen zu unterteilen,[71] wobei es im Landesrecht spezifische und zusätzliche Regelungen für die kirchlichen Hochschulen geben kann.[72] Beide waren Ausnahmeerscheinungen in einem ursprünglich monopolartigen staatlichen Hochschulsystem, jedoch hatten die kirchlichen Hochschulen dieses Monopol schon früher und mit anderen Ausgangsbedingungen sowie unter Berufung auf eine spezifische verfassungsrechtliche Lage durchbrochen.[73] Die privaten Hochschulen (s.o. Rn. 10) haben inzwischen erreicht, dass man von einem dualen System (mit immer noch unterschiedlichen Gewichtungen der beiden Sektoren) auszugehen hat. Auf die hier zu untersuchende Aufgabenbestimmung der Hochschulen hat dies im Wesentlichen den Einfluss, dass die Zielrichtung der Berufsvorbereitung unterschiedliche Prägungen erhalten kann, aber nicht muss. Weder bereiten die kirchlichen Hochschulen nur auf die Kirchen als Arbeitgeber vor (z.B. in den Bereichen Sozialarbeit und Sozialpädagogik), noch die Privaten Hochschulen nur auf private Arbeitgeber (z.B. bereitet die Bucerius Law School auf die Erste Juristische Staatsprüfung vor, verfolgt also auch das Ziel des „Einheitsjuristen“ trotz gewisser Schwerpunktbildungen). Dennoch sind insoweit bei den nichtstaatlichen Hochschulen Schwerpunkte deutlich, die man im Einzelnen den jeweiligen Informationsquellen der Hochschulen entnehmen kann.[74]
38
Interne Konflikte, etwa durch Einflussnahmen des Trägers auf Lehre und Studium sowie auf die übrigen Primäraufgaben, müssen unter Rückgriff auf die Freiheit von Kunst und Wissenschaft nach Art 5 Abs. 3 S. 1 GG gelöst werden, wobei sich insbesondere die staatlich anerkannten Hochschulen der rechtlich schwierigen Anwendbarkeit dieses Grundrechts und der damit verbundenen Wertentscheidung im Ergebnis nicht werden entziehen können.[75] Ähnliches gilt für Art. 12 Abs. 1 GG und dabei insbesondere die „Aufnahmeprüfungen“ an nichtstaatlichen – aber staatlich anerkannten – Hochschulen. Solche Prüfungen können keinen völlig rechtsfreien und der Willkür unterworfenen Raum bilden, wobei die Rechtsgrundlagen und Verfahrensregeln freilich vom Status der Hochschulen abhängen und nicht identisch mit denen staatlicher Hochschulen sind. Insbesondere bildet die Autonomie des Trägers (Privatautonomie bzw. die Autonomie der Kirchen) eine deutliche Abschottung gegenüber den Teilhaberechten, die man aus Art 12 GG gegenüber den staatlichen Hochschulen geltend machen kann.[76] Private Hochschulen können sich ihre Studierenden stärker „aussuchen“ und den Zugang autonomer regulieren als staatliche. Auch unterliegt die Überprüfung solcher Verfahren grundsätzlich nicht der Verwaltungsgerichtsbarkeit.