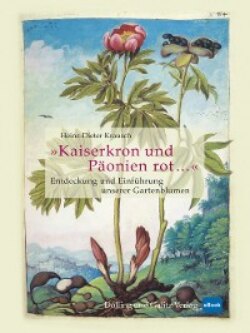Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAdonis L. Adonisröschen, Blutströpfchen
Adonis vernalis L. Frühlings-Adonisröschen, Matthiolus/Bauhin 1598
Der Name dieser Pflanzengattung erinnert an den schönen Jüngling Adonis, den Liebling der Venus, der auf der Jagd von einem wilden Eber getötet und von der Venus daraufhin in eine Blume verwandelt worden war, wie Ovid in seinen Metamorphosen erzählt. Bei der Blume adonium oder adonicum der antiken Autoren dürfte es sich um eine der als Blutströpfchen bezeichneten rotblühenden einjährigen Adonis-Arten des Mittelmeergebietes gehandelt haben, von denen einige als kalkliebende Getreide-Unkräuter bereits in der Jüngeren Steinzeit auch nach Mitteleuropa gelangten. Als Gartenzierpflanze wurde aus dieser Gruppe vor allem das dunkelrot blühende Herbst-Blutströpfchen (A. annua L. em. Hudson, syn. A. autumnalis L.) gezogen. In Deutschland wird es zuerst 1539 von Hieronymus Bock erwähnt, war aber zunächst noch recht selten. Die Horti Germaniae von Gessner 1561 belegen es nur bei Joachim Kreich in Torgau und bei Petrus Coldenberg in Antwerpen. Die Art breitete sich dann aber als Gartenblume rasch aus und wird z.B. 1594 von Franke aus den Lausitzen und Anfang des 17. Jhs. von Burser aus der Mark Meißen und aus Dänemark verzeichnet und fehlte auch nicht im Hortus Eystettensis. Seit dem 17. Jh. waren die »Feuerrößlein« oder »Corallenblumen« dann allerorten gezogene und beliebte Zierpflanzen. In seinem Gartenbaubuch gibt Elsholtz (1684) folgende Kulturhinweise: »Bey der Aussaat leget man sie drey oder vier Körner zusammen/so werden es Stauden/an welchen die Blumen dichter wachsen/und also mehr in die Augen scheinen. Man säet es im April und noch wol einmal im May/ümb desto länger Blumen davon zu haben.« 1769 schreibt Gleditsch über diese Art, sie »Wächset zwar in einigen Provinzen der Mark [Brandenburg] als eine Sommer- und Herbstblume unter dem Getreide, in den Lustgärten hingegen verschönert sich die ganze Pflanze, und blühet stärker, häufiger und länger«. Noch 1864 war sie in Brandenburg eine häufige Zierpflanze. Dann aber wurde die relativ kleinblütige Art zunehmend von größerblütigen Sommerblumen verdrängt und ist heute nur noch sehr selten in Gärten zu sehen.
Von den überwiegend gelbblühenden staudigen Adonis-Arten kommt das sonst in den buntblumigen Wiesensteppen Osteuropas verbreitete Frühlings-Adonisröschen (A. vernalis L.) auch in einigen Trockeninseln Mitteleuropas als seltene und gefährdete Wildpflanze vor. Schon frühzeitig hat man es in die Gärten geholt, und zwar wohl hauptsächlich als Zierpflanze, da seine medizinische Verwendung nur gering war. Die durch ihren Gehalt an Adonitoxin und anderen Glykosiden stark giftige Art wurde als Heilmittel bei Harnbeschwerden, Wassersucht und Steinleiden empfohlen. Wegen ihrer schwarzen Wurzel stellte man sie damals in die Nähe der Christrose. Als Elleborus nigri species, Elleborastrum und Sesamoides luteum erscheint sie 1561 in Gessners Horti Germaniae mehrfach als Gartenpflanze. 1590 verzeichnet sie Johann Wigand unter dem Namen Helleborus niger, flore luteo sogar für Ost- und Westpreußen als, wenn auch seltene, Gartenblume, dort wahrscheinlich von ihren natürlichen Vorkommen an der unteren Weichsel bei Kulm bezogen. Im Hortus Eystettensis (1613) ist sie dann als Pseudo Helleborus niger vertreten. Johann Royer kultivierte sie, vermutlich von nahegelegenen Wildvorkommen im nördlichen Harzvorland geholt, unter der Bezeichnung Buphthalmum seit vor 1630 im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem. In der Folgezeit blieb sie in Mitteleuropa eine zwar seltene, aber doch außerordentlich geschätzte Gartenstaude. So bezeichnet sie Gleditsch 1773 als eine »überaus schöne niedrige, dauerhafte Berg- und Frühlingspflanze« und 1818 der mecklenburgische Pfarrer Wredow in seinem Gartenfreund als »eine der schönsten Zierpflanzen in Blumengärten«.
Erst um 1900 gelangte das in Ostasien (Amurgebiet bis Nord- und Mitteljapan) heimische und in Japan bereits seit langem in vielen Formen kultivierte, aber erst 1861 wissenschaftlich beschriebene Amur-Adonisröschen (A. amurensis Regel et Radde) über Rußland nach Deutschland, wo es aber bis heute eine relativ seltene Gartenpflanze geblieben ist, da es hier nur vegetativ vermehrt werden kann.