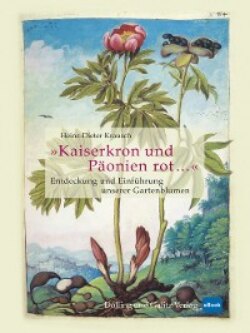Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGartenblumen aus aller Herren Länder
Die Zierpflanzen unserer Gärten und Grünanlagen stammen aus unterschiedlichen Regionen der Erde. Die Hauptmenge kam aus den kühl-gemäßigten (temperaten), warm-gemäßigten (submeridionalen) und warmen (meridionalen) Zonen der nördlichen Erdhalbkugel, doch haben auch die subtropischen Zonen sowie die südlich gemäßigte (australe) Zone eine Reihe von Arten beigesteuert.
Von den Arten, die bei uns in Mitteleuropa wildwachsend vorkommen, beschränken sich nur wenige auf dieses Verbreitungsgebiet. Das Areal der meisten dieser Arten umfaßt auch andere Teile Europas, vielfach auch Asiens und zum Teil auch Nordamerikas. Manche von ihnen sind in Mitteleuropa weit verbreitet und hier wahrscheinlich an verschiedenen Stellen in Gartenkultur genommen worden, wie z.B. Maiglöckchen (Convallaria majalis), Gänseblümchen (Bellis perennis) und Wiesen-Margerite (Chrysanthemum leucanthemum). Andere Arten dagegen sind seltener oder kommen nur an speziellen Standorten (Mittel- und Hochgebirge, warmtrockene Abhänge, Meeresküsten) vor. Sie gelangten zunächst in der Nähe ihrer Wildvorkommen in die Gärten und breiteten sich von dort durch Weitergabe von Ort zu Ort, später durch den Handel über andere Teile Mitteleuropas aus. Auf diese Weise kamen z.B. Gebirgspflanzen wie Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum), Eisenhut (Aconitum napellus), Hoher Rittersporn (Delphinium elatum), Weiße Christrose (Helleborus niger) und Berg-Flokkenblume (Centaurea montana) in die Gärten des Flachlandes.
In Gartenkultur genommen wurden schönblühende und schöngestaltige Pflanzen sowie Formen von Wildpflanzen mit gefüllten Blüten, wie z.B. vom Gänseblümchen (Bellis perennis), vom Hahnenfuß (Ranunculus) und vom Seifenkraut (Saponaria officinalis) oder solche mit weißpanaschierten Blättern, wie z.B. vom Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea ,Picta’). Manche dienten hauptsächlich als Heil- oder Zauberpflanzen, bevor sie nur noch als Zierpflanzen gezogen wurden, wie etwa Christrose und Dach-Hauswurz (Sempervivum tectorum).
Attraktive Pflanzen aus Südeuropa, insbesondere aus dem Mittelmeergebiet und seiner Umrandung (Mediterran- und Submediterran-Gebiet), wurden zum Teil bereits in der Antike als Zierpflanzen kultiviert. In welchem Ausmaß derartige Pflanzen von den Römern in die von ihnen okkupierten Gebiete Westeuropas und des westlichen und südlichen Mitteleuropa mitgebracht wurden, entzieht sich der sicheren Kenntnis; auch bleibt unklar, ob sie die Wirren der Völkerwanderungszeit überdauert haben. Wahrscheinlich sind südeuropäische Gartenzierpflanzen erst seit dem Frühen Mittelalter über die Burg- und Klostergärten des Frankenreiches nach Mitteleuropa gekommen. Zu Beginn des 9. Jhs. belegen z.B. der Hortulus des Walahfried Strabo und der St. Gallener Klosterplan die Anwesenheit einiger südeuropäischer Arten, die hauptsächlich als Heilpflanzen gezogen wurden, aber auch der Zierde dienten wie Gallische Rose (Rosa gallica), Weiße Lilie (Lilium candidum) und Deutsche Schwertlilie (Iris germanica). Im Hohen Mittelalter waren, wie u.a. den Schriften Hildegards von Bingen und des Albertus Magnus zu entnehmen ist, weitere derartige Arten aus Südeuropa eingetroffen wie z.B. Weiße Rose (Rosa x alba), Ringelblume (Calendula officinalis) und Echte Pfingstrose (Paeonia officinalis). Möglicherweise brachten auch interessierte Ritter und deren Mannen, die an den Italienfeldzügen oder den Kreuzzügen teilnahmen, Pflanzen mit nach West- und Mitteleuropa; zuverlässige Belege hierfür harren der Entdeckung.
Der Großteil der aus dem südlichen Europa stammenden Gartenzierpflanzen kam seit der Renaissance nach Mitteleuropa. Nicht nur das in dieser Epoche gewaltig zunehmende Interesse an der Natur, auch die vielfältigen politischen, ökonomischen und geistigen Verbindungen zwischen Mitteleuropa und Italien ließen den Zustrom südlicher Zierpflanzen erheblich anschwellen. An deren Einführung waren zum einen Kaufleute beteiligt, die Gewürze, Stoffe und andere Handelswaren von ihren Geschäftspartnern in italienischen Städten bezogen, welche ihrerseits wiederum durch den Levantehandel mit den Hafenstädten des östlichen Mittelmeerraumes verbunden waren. Es ist überliefert, daß bei diesen Handelsverbindungen auch seltene Pflanzen als Werbe- und Freundschaftsgeschenke dienten. Viele wohlhabend gewordene deutsche Kaufleute legten sich nach italienischem Vorbild repräsentative Gärten an und bemühten sich um neue und seltene Pflanzen. Auch viele Landesfürsten und adlige Grundherren waren bestrebt, ihre Lustgärten möglichst artenreich auszustatten. So erfahren wir aus dem Briefwechsel des Landgrafen Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (1532–1592), daß der pflanzenliebende Fürst eifrig nach neuen Pflanzen suchte und sich u.a. an Joachim Camerarius in Nürnberg und an Carolus Clusius in Wien wandte und letzterem sogar in dessen Frankfurter Zeit (1588–1592) ein Jahrgehalt zukommen ließ. Auch stattete er einen Studenten seines Landes mit einem Italien-Stipendium aus mit der Weisung, ihm neue Gartenpflanzen zu beschaffen. Von solchen Arten, die in seinen Gärten vermehrt werden konnten, gab Landgraf Wilhelm bereitwillig Pflanzgut an fürstliche Verwandte und Standesgenossen weiter (Kessler 1859).
Eine große Rolle bei der Einführung und Verbreitung fremdländischer Pflanzen spielten im 16. und 17. Jh. auch die Ärzte. Sie hatten während ihres Studiums oftmals italienische und südfranzösische Universitäten (Padua, Bologna, Pisa, Montpellier u.a.) besucht und die dort seit Mitte des 16. Jhs. bestehenden Botanischen Gärten sowie die Pflanzenwelt der Umgebung kennengelernt und die eine oder andere Pflanze für den eigenen Garten mitgebracht. Neben die privaten Gärten traten nunmehr auch in Mitteleuropa Botanische Gärten an Universitäten und wurden mehr und mehr zu Sammel- und Ausgangspunkten für ausländische Pflanzen.
Wenn auch die Hauptmasse der in Südeuropa heimischen Zierpflanzen im 16. Jh. oder zuvor die Gärten Mitteleuropas erreichte, so trafen doch auch in den folgenden Jahrhunderten weitere südländische Pflanzen ein, wie z.B. Duft-Wicke (Lathyrus odoratus), Blaukissen (Aubrieta deltoidea) und Duft-Reseda (Reseda odorata).
Eine zwar nicht allzu große, aber sehr wichtige Gruppe stellen die in der 2. Hälfte des 16. Jhs. aus türkischen Gärten nach Mittel- und Westeuropa eingeführten Zierpflanzen dar. Im Vorderen und Mittleren Orient hatte man schon in alter Zeit dort wild vorkommende schönblühende Pflanzen in die Gärten geholt und sie zum Teil durch Auslese und Hybridisation weiterentwickelt. Als im Hohen Mittelalter türkische Stämme von ihrer Urheimat in Zentralasien westwärts zogen, in Kleinasien das Osmanische Reich begründeten, 1453 Konstantinopel eroberten und nachfolgend weitere Gebiete in Südosteuropa, in Vorderasien und Nordafrika unter ihre Herrschaft brachten, übernahmen sie als große Blumenfreunde die von Persern, Byzantinern, Arabern und anderen von ihnen unterworfenen Völkerschaften kultivierten Gartenpflanzen und fügten weitere hinzu. So schrieb der französische Gelehrte Pierre Belon (1517–1564) in seinem Bericht über eine Reise in die Türkei 1553: »Die Türken widmen dem Gartenwesen eine ebenso große Aufmerksamkeit wie wir und geben sich große Mühe, fremde Pflanzen zu entdecken, vor allem solche, die schöne Blüten tragen, und ihnen sind keine Kosten zuviel.« Durch Belon und den kaiserlichen Gesandten Augerius Ghislain de Busbecq (1522–1592) drangen erste Nachrichten von den in den türkischen Gärten gepflegten, hierzulande gänzlich unbekannten Zierpflanzen nach Mittel- und Westeuropa. Alsbald schickten bzw. brachten Mitglieder kaiserlicher Gesandtschaften auch Zwiebeln, Knollen und Samen von Tulpen, Hyazinthen, Ranunkeln, Flieder, Roßkastanie und weiteren Arten von Konstantinopel nach Wien, von wo aus sie in andere Regionen Mittel- und Westeuropas gelangten.
Besonders eifrig um orientalische Zierpflanzen bemüht war der 1573–1588 in Wien ansässige flämische Botaniker Carolus Clusius, der seine guten Beziehungen zu den kaiserlichen Gesandten nutzte, um sich viele neue Arten und Sorten aus türkischen Gärten zu beschaffen. Der Import türkischer Zierpflanzen nach Mitteleuropa lief allerdings nicht nur über Wien. Auch der italienische, insbesondere der venezianische Levantehandel war an diesen Einfuhren beteiligt. Die Republik Venedig besaß zu dieser Zeit (bis 1669) die Insel Kreta. Von ihren dortigen Stützpunkten aus beherrschten die Venezianer den Handel mit den Küstengebieten des östlichen Mittelmeergebietes, durch den ebenfalls Zierpflanzen nach Venedig bzw. in den 1545 gegründeten Botanischen Garten der venezianischen Universität Padua gelangten. Auf diesem Wege kamen offensichtlich erste Tulpen und erste Exemplare des Flieders nach Mitteleuropa.
Weitere kleinasiatische Wild- und Gartenpflanzen wurden in späteren Jahrhunderten durch Botaniker und Pflanzensammler nach Europa gebracht. So bereiste der französische Botaniker Joseph Pitton de Tournefort – Frankreich war damals mit der Türkei verbündet – von 1700 bis 1702 Kleinasien. Im 19. Jh. wurden u.a. die zu dieser Zeit erst entdeckten Schneeruhm- (Chionodoxa-)Arten eingeführt.
Auf seiner Forschungsreise, die ihn bis in das Kaukasusgebiet (Tiflis) führte, entdeckte Tournefort eine große Zahl neuer Pflanzen, brachte sie aber meist nur als Herbarexemplare nach Paris. Lediglich der von Tournefort bei der osttürkischen Stadt Erzurum aufgefundene, aber auch im Kaukasusgebiet wachsende Orientalische Mohn gelangte in Form von Rhizomen oder Samen nach Paris und wurde von dort aus weiter verbreitet. Als das unter türkischer bzw. persischer Herrschaft stehende Kaukasusgebiet ab 1770 schrittweise von den Russen okkupiert und unterworfen wurde, beteiligten sich verschiedene in russischen Diensten stehende Deutsche an der wissenschaftlichen Erforschung der reichhaltigen Kaukasusflora. Anfang des 19. Jhs. nahm Johann Friedrich Adam (1780–1838) als botanischer Mitarbeiter an einer Forschungsreise des russischen Grafen Apollo Mussin-Puschkin (gest. 1805) durch das östliche Kaukasusgebiet teil und beschrieb 50 neue Pflanzen. Der einst als Offizier nach Rußland gekommene, später als Naturforscher tätige Freiherr Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768–1826) veröffentlichte im Jahre 1800 eine Beschreibung der Länder zwischen den Flüssen Terek und Kur am Kaspischen Meer mit einem botanischen Anhang. Sein Hauptwerk aber ist die 1808 erschienene zweibändige Flora taurico-caucasica, der er 1819 einen umfangreichen Nachtragsband hinzufügte. In diesem Werk werden zahlreiche Pflanzenarten des Kaukasusgebietes erstmals beschrieben. Durch Bieberstein bzw. durch die von ihm belieferten russischen Botanischen Gärten gelangten zahlreiche kaukasische Pflanzen nach Mittel- und Westeuropa, von denen viele attraktive Arten alsbald auch als Zierpflanzen Eingang in die allgemeine Gartenkultur fanden, wie z.B. Gold-Schafgarbe (Achillea filipendulina), Orientalische Gemswurz (Doronicum orientale), Rotweiße Flockenblume (Centaurea dealbata) und Kaukasische Skabiose (Scabiosa caucasica). Im Verlaufe des 19. Jhs. folgten weitere Arten, zuletzt die erst zu Beginn des 20. Jhs. entdeckten Sippen Kissen-Primel (Primula juliae) und Kranz-Enzian (Gentiana septemfida var. lachodechiana) sowie der 1931 eingeführte Vorfrühlings-Blaustern (Scilla mischtschenkoana).
Nord-, Ost- und Zentralafrika und die Kanaren haben nur wenige Zierpflanzen für unsere Gärten beigesteuert. Echte Aloe (Aloe vera) und Rizinus (Ricinus communis) waren bereits in der Antike in Gartenkultur, damals hauptsächlich als Heil- und Nutzpflanzen. Die in Nordafrika heimischen Arten Duft-Reseda (Reseda odorata) und Gekielte Wucherblume (Chrysanthemum carinatum) wurden im 18. Jh. entdeckt und nach Europa gebracht. Bei der Durchforschung ostafrikanischer Kolonien im 19. Jh. fand man Fleißiges Lieschen (Impatiens walleriana) und Usambaraveilchen (Saintpaulia ionanthe). Vermutlich durch den venezianischen Orienthandel kam Anfang des 16. Jhs. die im tropischen Afrika, aber auch in Ostindien beheimatete Federbusch-Celosie (Celosia argentea) zuerst nach Italien und wenig später nach Mitteleuropa. Dorthin gelangte im 17. Jh. dann auch die auf den Kanaren heimische Strauch-Margerite (Chrysanthemum frutescens), welche hierzulande aber nur als Kübelpflanze gezogen werden kann.
Das Kapland an der Südspitze Afrikas wurde Ende des 15. Jhs. von portugiesischen Seefahrern auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien entdeckt und in Besitz genommen. Die dort angelegten Stützpunkte dienten auch den Segelschiffen anderer Nationen wie Niederländern und Engländern als Zwischenstationen auf der Route nach und von Ostindien und Südostasien. In der 1. Hälfte des 17. Jhs. brachten zurückkehrende Schiffe erste Pflanzen der artenreichen Kap-Flora nach Europa, wie z.B. die Blaulilie (Agapanthus africanus) und eine erste Pelargonie (Pelargonium triste). Der Zustrom südafrikanischer Arten nach Europa verstärkte sich erheblich, als ab 1652 die Niederländer das Kapland in Besitz hatten (bis 1815). Nunmehr wurden u.a. zahlreiche weitere Pelargonium-Arten, Gladiolen und das Männertreu (Lobe- lia erinus) eingeführt. Unter der englischen Nachfolge kamen weitere Arten, u.a. Monbretien (Crocosmia) und Nemesien nach Mitteleuropa.
Entweder durch die Portugiesen, welche 1498 auf dem Seeweg Vorderindien erreicht und sich dort an verschiedenen Stellen festgesetzt hatten, oder durch italienische Kaufleute, die über arabische Zwischenhändler indische Gewürze importierten, kamen zu Beginn des 16. Jhs. einige dort heimische Zierpflanzen nach Europa, so Garten-Balsamine (Impatiens balsamina), Dreifarbiger Amaranth (Amaranthus tricolor), Blaue Purpurwinde (Pharbitis nil) und vielleicht auch die Federbusch-Celosie (Celosia argentea). Seit 1600 hatten auch die Engländer in Indien Fuß gefaßt und verleibten Vorderindien 1858 ihrem Kolonialreich ein. Bereits zuvor hatte die Erforschung der indischen Flora vorwiegend durch englische Botaniker begonnen. Unter anderen veröffentlichte William Roxburgh (1759–1815) eine Flora Indica 1820–1824 und John Forbes Royle (1800–1856) 1839 Illustrations of the botany ... of the Himalayan mountains and the Flora of Cashmere. In dieser Zeit kamen verschiedene Gebirgspflanzen des Himalaya als Gartenzierpflanzen nach Europa, wie z.B. Dreinerviges Perlkörbchen (Anaphalis triplinervis), Weinblättrige Anemone (Anemone vitifolia), Himalaya-Springkraut (Impatiens glandulifera) und Kugel-Primel (Primula denticulata).
Die zentralasiatischen Gebiete (Turkmenien, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkestan) wurden in der 2. Hälfte des 18. Jhs. von russischen Truppen erobert und dem Russischen Reiche eingegliedert. Zu den ersten Erforschern der dortigen Flora gehörte Albert Regel, seit 1875 Bezirksarzt in Kuldja in Turkestan. Er sandte seinem Vater Eduard Regel, Direktor des Botanischen Gartens in St. Petersburg, zahlreiche Pflanzen zu, die dieser wissenschaftlich beschrieb, u.a. verschiedene Arten von Wildtulpen und Steppenkerzen (Eremurus). Die Einführung dieser Arten in die Gartenkultur erfolgte später durch holländische Gartenbaufirmen, welche ihre Pflanzensammler in die zentralasiatischen Gebiete entsandten, um die dortigen Pflanzenschätze auszubeuten. Der 1. Weltkrieg setzte diesen Aktionen ein Ende. Bei seinem Ausbruch standen auf einigen Bahnstationen des russischen Zentralasien Kisten mit Tausenden von Blumenzwiebeln zum Versand bereit, welche niemals ihr Ziel erreichten. Inzwischen wurde auch hier der Ausplünderung der Flora für kommerzielle Zwecke durch Naturschutzgesetze ein Riegel vorgeschoben.
Die artenreiche Flora Ostasiens blieb den Europäern lange Zeit unbekannt, wenn auch einzelne Nutz- und Zierpflanzen (Pfirsich, Aprikose, Weiße Maulbeere, Hemerocallis-Arten, Hibiscus syriacus) bereits in antiker Zeit über die Seidenstraßen nach Kleinasien und in das Mittelmeergebiet gekommen waren und von dort aus später auch Mitteleuropa erreichten. Die eigentliche Erschließung der ostasiatischen Pflanzenwelt für die europäischen Gärten setzte ein, nachdem 1516 die Portugiesen, später auch Niederländer, Engländer und Franzosen in China Handelsniederlassungen und Missionsstationen gegründet hatten. Von dort aus wurden ab Mitte des 17. Jhs. Pflanzgut und Samen chinesischer Zierpflanzen nach Europa gesandt. So kam z.B. die in China seit altersher kultivierte Chrysantheme in der 2. Hälfte des 17. Jhs. nach Westeuropa, ging hier aber zunächst wieder verloren. Der Verkehr zwischen China und Europa gestaltete sich lange Zeit ausgesprochen schwierig. Da Europäer in China nicht gern gesehen waren, konnte die botanische Erkundung des Landes und die Übersendung chinesischer Pflanzen bis zum 19. Jh. nur von einigen Kaufleuten, Missionaren und Diplomaten vorgenommen werden. Auf dem langen Seeweg nach Europa um das Kap der Guten Hoffnung herum ging nicht selten ein Teil der Pflanzen zugrunde, auch kam es bei Schiffshavarien zu Totalverlusten. Am günstigsten erwies sich die Übersendung von Samen, und so sind zuerst vorwiegend einjährige Arten wie China-Nelke (Dianthus chinensis) und Sommeraster (Callistephus chinensis) in Europa erschienen. Letztere z.B. wurde 1728 durch französische Missionare in Peking in Form von Samen nach Paris geschickt und gelangte von dort aus rasch in die Niederlande, nach England und Deutschland. Überhaupt haben sich französische Missionare in erheblichem Ausmaß an der Erforschung der Flora Chinas beteiligt, wie etwa Pierre N. le Chéron d’Incarville (1706–1757), später dann Armand David (1826–1900) und Jean Marie Delavay (1838–1895). Im 19. und 20. Jh. lag die Einführung chinesischer Gartenzierpflanzen überwiegend in den Händen englischer Gärtner und Pflanzensammler, die derartige Pflanzen an Gartenbaubetriebe in England schickten, von wo aus sie weiter vertrieben wurden. Zu Beginn des 19. Jhs. sandte Sir Joseph Banks (1743–1820), Direktor des Botanischen Gartens in Kew bei London und Präsident der Royal Horticultural Society, den Gärtner William Kerr (gest. 1814) als Sammler nach China. Später konnte Robert Fortune (1812–1880) auf drei Reisen zahlreiche Pflanzen nach England importieren. Zunächst erwarb man das Pflanzgut bei Gartenbesitzern und Gärtnereien der chinesischen Küstenstädte. Als dann nach dem Opium-Krieg (1840–1842), besonders aber 1860 die Beschränkungen für ausländische Reisende in China stark gelockert wurden, konnten größere Sammelreisen in das Landesinnere unternommen werden. Im Auftrage englischer Gartenbaufirmen war nunmehr auch in China eine Vielzahl von »Pflanzenjägern« (plant hunters) unterwegs, um die Pflanzenschätze für kommerzielle Zwecke auszubeuten. Als besonders erfolgreiche Sammler sind u.a. George Forrest (1873–1932) und Ernest Henry Wilson (1876–1930) zu nennen. Letzterer betrieb das Pflanzensammeln in großem Maßstab. Allein auf seinen ersten beiden Chinareisen leitete er seinem Auftraggeber, der Gartenbaufirma Veitch & Sons in Combe Wood bei London, Samen von über 1800 Pflanzenarten, 3000 Blumenzwiebeln sowie eine riesige Zahl von Wurzeln und Rhizomen zu. Später arbeitete er für das Arnold Arboretum in den USA und brachte von einer weiteren Reise 1910–1911 u.a. 6000 bis 7000 Zwiebeln der 1903 von ihm in einem abgelegenen Hochtal in Westchina entdeckten Königs-Lilie (Lilium regale) mit. Die Tätigkeit der Pflanzensammler war nicht ungefährlich. Wilson zog sich in unwegsamem Gelände einen komplizierten Beinbruch zu und gelangte nur mit Mühe wieder nach Hause. Andere wurden hier wie auch in anderen Erdteilen von feindseligen Einwohnern oder von Räubern getötet oder ertranken in Flüssen, wie der deutsche Gärtner Friedrich Sello 1831 im Rio Dolce in Brasilien. Besonders tragisch war das Ende des englischen Gärtners David Douglas (1798–1834), dem wir die Einführung zahlreicher Pflanzen aus dem westlichen Nordamerika verdanken. Er stürzte auf den Sandwich-Inseln in eine von Eingeborenen angelegte Wildfanggrube und wurde von einem darin befindlichen wilden Stier zu Tode getreten.
Japan, das der Portugiese Mendez Pinto 1542 als erster Europäer erreicht hatte, verschloß sich aus Furcht vor Kolonisierung bis zur Mitte des 19. Jhs. den Fremden. Lediglich die 1602 gegründete Niederländische Ostindische Kompanie durfte auf der Insel Deshima im Hafen von Nagasaki eine Handelsniederlassung unterhalten. Von dort aus haben einige im Dienste dieser Handelsgesellschaft stehende Ärzte Informationen über die Pflanzenwelt Japans gesammelt und ihre Beobachtungen in Berichten und Florenwerken veröffentlicht, so Engelbert Kaempfer (1651–1716), der sich 1690–1692 in Japan aufhielt, Carl Peter (Pehr) Thunberg (1743–1822), der 1775/76 in Japan war, sowie der sich im 19. Jh. 1823–1829 und 1859–1861 dort aufhaltende Philipp Franz von Siebold (1796–1866). Letzterer hat bereits bei der Rückkehr von seinem ersten Japanaufenthalt fast 500 japanische Pflanzen nach Europa gebracht und von seinem damaligen Wohnsitz Leiden aus verbreitet. Als in der Mitte des 19. Jhs. die Abschottung Japans gegen Ausländer zu Ende ging, konnten weitere europäische Botaniker und Gärtner das Land bereisen und Pflanzen nach Europa senden. Zu nennen sind vor allem John Gould Veitch (1839–1870) vom englischen Gartenbaubetrieb Veitch & Sons, der u.a. die nach ihm benannte Sorte des Dreispitzigen Wilden Weines (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’) nach England einführte, und der deutschstämmige russische Botaniker Carl Johann Maximowicz (1827–1891), der nicht nur eine große Zahl japanischer Pflanzen nach St. Petersburg schickte, sondern auch eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher Arbeiten über die Flora Japans veröffentlichte.
Maximowicz und vor ihm andere russische bzw. in russischen Diensten stehende deutsche Botaniker waren es auch, welche die Flora des östlichen Sibirien, des Amurlandes und des nördlichen China (Mandschurei) sowie Koreas erkundeten. So unternahm der aus Berlin stammende Naturforscher und St. Petersburger Akademiker Peter Simon Pallas (1741–1811) in den Jahren 1768–1774 zwei Forschungsreisen nach Sibirien, die ihn bis in das Gebiet östlich des Baikal-Sees (Daurien) führten, wo er u.a. die Wildform der Chinesischen Pfingstrose (Paeonia lactiflora) entdeckte und erstmals beschrieb.
Australien war zwar Anfang des 17. Jhs. von Portugiesen und Niederländern entdeckt worden, welche es als »Neuholland« bezeichneten (der Name Australien kam erst 1814 auf), seine eigentliche Erschließung erfolgte aber erst ab 1770 durch die Engländer. Diese setzten sich zuerst an der Ostküste Australiens fest und waren von der dortigen Pflanzenwelt sehr beeindruckt (»Botany Bay« bei Sydney). Zunächst Sträflingskolonie, erfolgte die Durchforschung und Besiedlung des Erdteiles durch die Europäer im wesentlichen im 19. Jh. An der Erforschung beteiligte sich auch Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt (1813–1848) aus Trebatsch bei Beeskow, der beim Versuch einer Ost-West-Durchquerung des Kontinents mit seiner Expedition im Innern Australiens verschollen, wahrscheinlich von Ureinwohnern getötet worden ist. Die meisten australischen Pflanzen lassen sich in West- und Mitteleuropa nur in speziellen Gewächshäusern (»Neuholland-Häusern«) ziehen, nur wenige eignen sich für eine Freilandkultur. Zu nennen sind vor allem einige annuelle Strohblumen-Arten (Helichrysum bracteatum, Ammobium alatum, Helipterum) sowie das als Kübel- und Balkonkastenblume gezogene »Australische Gänseblümchen« (Brachycome iberidifolia), die ab 1800 in Europa eintrafen.
1492 hatte der in spanischen Diensten stehende italienische Seefahrer Christoph Columbus auf der Suche nach Indien Amerika entdeckt und auf dieser und drei weiteren Fahrten die karibische Inselwelt, die Nordostküste Südamerikas und das mittelamerikanische Festland erkundet und für Spanien in Besitz genommen. Von diesen Ausgangspositionen aus okkupierten die Spanier in der 1. Hälfte des 16. Jhs. Florida (1513), Mittelamerika (1519–1541), Mexiko (1519–1521) und Kalifornien (1535) und stießen vom Norden Südamerikas aus längs der Westküste nach Süden vor. 1532–1533 eroberte Francisco Pizarro das Inkareich in Peru, und 1553 hatten die Spanier den gesamten Westen des südamerikanischen Subkontinents bis Mittelchile unterworfen. Im Südosten gründeten sie 1535 Buenos Aires. Entsprechend einem 1497 abgeschlossenen Vertrag gehörte die Ostküste in der Mitte Südamerikas zur portugiesischen Interessensphäre. 1500 nahmen die Portugiesen diesen Bereich in Besitz, 1531 gründeten sie Rio de Janeiro, und 1532 setzte in den brasilianischen Küstengebieten die portugiesische Kolonisation ein.
Vor allem durch die Spanier gelangten aus ihren amerikanischen Kolonien alsbald nicht nur verschiedene Nutzpflanzen wie Mais, Kartoffel und Tomate nach dem spanischen Mutterland, sondern auch Zierpflanzen wie Studentenblume (Tagetes), Wunderblume (Mirabilis jalapa) und Sonnenblume (Helianthus annuus). Von Spanien aus verbreiteten sich diese Arten zunächst im Mittelmeergebiet und erreichten ab etwa 1530 nach und nach, zumeist über Italien, Mitteleuropa. Andere Arten aus dem mittel- und südamerikanischen Raum, größtenteils erst zu späteren Zeitpunkten entdeckt, kamen in den folgenden Jahrhunderten nach Europa, so gegen Ende des 18. Jhs. Dahlien, Schmuckkörbchen und Zinnien, im 19. Jh. die Immerblühende Begonie, die Fuchsien, die Stammeltern der Petunien und der Garten-Verbenen. In der Karibik und an der Nordostküste Südamerikas (Guayana) hatten sich später auch Engländer, Franzosen und Niederländer festgesetzt und z.T. bis heute bestehende Kolonien begründet. Zu einem wichtigen Erforscher der karibischen Pflanzenwelt wurde Ende des 17. Jhs. der französische Franziskanerpater Charles Plumier (1646–1704), welcher mehrere vorzüglich bebilderte Beschreibungen der von ihm entdeckten neuen amerikanischen Pflanzen veröffentlichte. Diese subtropischen Arten ließen sich jedoch nicht den in Europa bekannten damaligen (vorlinnéischen) Gattungen zuweisen. Plumier löste dieses Problem, indem er völlig neue Gattungen aufstellte, die er nach berühmten Botanikern oder Förderern der botanischen Forschung benannte. Da Linnaeus 1753 viele dieser Gattungsnamen in seine binäre Nomenklatur übernahm, sind Namen wie Fuchsia und Begonia erhalten geblieben und heute noch gültig. Fortan wurde es allgemein üblich, neu entdeckte oder neu zugeordnete Pflanzengattungen oder -arten (auch) nach um die Botanik verdienten Persönlichkeiten zu benennen; zu den Beispielen aus jüngerer Zeit zählen u.a. die wissenschaftlichen Namen Kolkwitzia und Primula juliae.
Die Ostküste Nordamerikas wurde, abgesehen von ihrer Entdekkung durch die Wikinger im Mittelalter, Ende des 15. Jhs. von englischen Schiffen erreicht. 1535 brachte eine französische Expedition den Abendländischen Lebensbaum (Thuja occidentalis) als erstes nordamerikanisches Gehölz nach Paris. Im 16. Jh. setzten sich Engländer und Franzosen, später vorübergehend auch Niederländer (1614–1664) und Schweden (1638–1655) an der Ostküste Nordamerikas fest, doch kam es erst zu Beginn des 17. Jhs. zur eigentlichen Besiedlung der Küstengebiete, von wo aus man das Landesinnere erschloß. Von diesen Gebieten wurden alsbald Pflanzen nach Frankreich und England sowie in die Niederlande gebracht. Zunächst waren die Franzosen in der Einführung neuer Arten aus ihren nordamerikanischen Kolonien insbesondere in Kanada führend. Erste kanadische Stauden erschienen um 1620 in Pariser Gärten, und 1635 veröffentlichte der Arzt und Botaniker Jacques Cornut (gest. 1651) ein erstes Buch über bisher unbekannte kanadische Pflanzen, in dem etwa 40 neue nordamerikanische Arten abgebildet und beschrieben wurden. Aber auch die Engländer brachten schon frühzeitig derartige Pflanzen aus ihren nordamerikanischen Besitzungen nach Europa, so z.B. das Perlkörbchen (Anaphalis margaritacea), das als erste nordamerikanische Staude 1596 in England kultiviert wurde. Aus den seit 1607 besiedelten englischen Kolonien Virginia und Neu-England bezogen englische Gärtner und Botaniker wie z.B. John Tradescant (gest. 1638) und sein gleichnamiger Sohn (1608–1662) alsbald weitere attraktive Zierpflanzen. Die neuen Pflanzen lösten unter den zahlreichen englischen Pflanzenliebhabern wachsendes Interesse aus. So sandte der Bischof von Oxford Henry Compton (1632–1713), ein großer Pflanzenfreund, sogar einige seiner Kaplane zum Pflanzensammeln nach Amerika. Sein eifrigster Sammler wurde John Baptist Banister (1654–1692), der viele neue Arten, darunter auch Echinacea purpurea, nach England sandte und 1680 eine erste Studie über die Flora Virginias veröffentlichte. Im Alter von 38 Jahren stürzte er beim Pflanzensammeln von einem Felsen und kam dabei zu Tode. Im 18. Jh. bildete sich in England unter der Leitung des Geschäftsmannes Peter Collinson (1694–1768) ein Syndikat von Gartenliebhabern, welches die Beschaffung nordamerikanischer Pflanzenneuheiten organisierte und finanzierte. Wichtigster Zulieferer wurde der in dem 1681 durch Quäker begründeten Pennsylvanien ansässige Farmer John Bartram (1699–1777), welcher von 1730 an jährlich etwa 20 Kisten mit jeweils rd. 100 verschiedenen Arten von Pflanzen und Samen zum Preis von 5 Guineen pro Kiste an Collinson schickte, der sie dann weiter verteilte und vertrieb. Hierdurch und durch weitere Sammler und Gärtner kam in dieser Zeit eine Vielzahl von Zierpflanzen aus dem östlichen Nordamerika nach England, von wo aus viele Arten dann auch nach Mitteleuropa gelangten.
Im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), in dem England auf Seiten Preußens stand, verloren die Franzosen den größten Teil ihrer nordamerikanischen Kolonien an die Engländer, bis auch diese nach dem Unabhängigkeitskrieg 1775–1783 mit der Gründung der USA dort ihre Kolonialherrschaft aufgeben mußten. Im Zuge eines Stroms von Auswanderern aus vielen europäischen Staaten drangen nunmehr europäische Siedler immer weiter nach Westen vor. Gegen Ende des 18. Jhs. erreichten sie den Mittleren Westen mit seinen großen Prärien, so daß auch von dorther zahlreiche Pflanzen nach Europa gelangten. 1803 kauften die Vereinigten Staaten von Frankreich das Gebiet westlich des Missisippi bis hin nach Montana, woraufhin 1804 Captain William Clark (1770–1839) und Captain Meriwether Lewis (1774–1809) ihre berühmt gewordene transkontinentale Expedition vom Mittleren Westen bis an den Pazifischen Ozean unternahmen, auf der zahlreiche neue Pflanzen entdeckt wurden, die 1814 in der Flora Americae septentrionalis des aus Großenhain in Sachsen stammenden nordamerikanischen Botanikers Friedrich Traugott Pursh (Pursch, 1774–1820) zuerst beschrieben wurden. 1845 wurden Texas, 1848 Kalifornien, Nevada, Arizona, Kolorado und Neu-Mexiko von Mexiko an die Vereinigten Staaten abgetreten. In der damals noch spanischen Hafenstadt San Francisco hatte im Oktober 1816 der Berliner Botaniker Adelbert von Chamisso während seiner Weltumseglung auf dem russischen Forschungsschiff Rurik den Goldmohn (Eschscholtzia californica) gefunden, nach Berlin mitgebracht und 1820 in einer dortigen wissenschaftlichen Zeitschrift als neue Art beschrieben. 1824–1827 unternahm der schottische Gärtner und Pflanzensammler David Douglas eine botanische Sammelreise in das westliche Nordamerika, bei der zahlreiche Pflanzen gefunden und nach England eingeführt wurden, darunter auch die heute in unseren Gärten verbreitete Stauden-Lupine (Lupinus polyphyllus). Obwohl auch später noch nordamerikanische Pflanzenarten nach Europa gebracht wurden, wie z.B. die heute in unseren Vorgärten fast allgegenwärtige Stech-Fichte (Picea pungens), waren bis Mitte des 19. Jhs. die meisten unserer in Nordamerika beheimateten Zierpflanzen in Europa eingetroffen. Nunmehr befaßten sich auch in Nordamerika Gartenbaubetriebe mit der züchterischen Weiterentwicklung der vorhandenen, nicht nur amerikanischen Zierpflanzen und brachten zahlreiche neue Sorten und Hybriden z.B. in den Gattungen Lilium, Hemerocallis, Paeonia und Tagetes auf den Markt.
Von der Vielzahl der im Laufe der Jahrhunderte aus aller Welt nach Mitteleuropa eingeführten Zierpflanzen sind einige in mehr oder weniger großem Umfange verwildert und haben sich in der heimischen Natur eingebürgert. Während manche von diesen Neophyten sich problemlos in die natürliche Vegetation einfügen und zum Schmuck der Landschaft beitragen, wie z.B. Duft-Veilchen (Viola odorata), Gauklerblume (Mimulus guttatus) und Schlitzblättriger Sonnenhut (Rudbeckia laciniata), können andere durch unduldsamen Massenwuchs stellenweise zu Problemfällen werden, wie etwa Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Japanischer Staudenknöterich (Reynoutria japonica) und Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum).