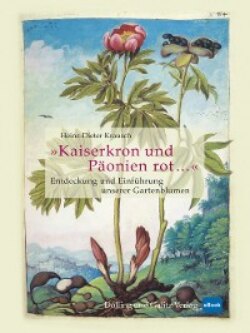Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnaphalis DC. Perlkörbchen
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook.f. Großes Perlkörbchen, Matthiolus/Bauhin 1598
Als eine der ersten nordamerikanischen Stauden wurde das vom östlichen Nordamerika bis Nordostasien verbreitete Große Perlkörbchen (A. margaritacea (L.) Benth. et Hook.) in Europa eingeführt. Zuerst gelangte die Pflanze nach England, von wo sie der Londoner Kanzler Richard Garth unter dem Namen Gnaphalium Americanum im Jahre 1580 an den damals in Wien tätigen Carolus Clusius schickte. Dieser beschrieb sie in seinem 1583 erschienenen Buch über die seltenen Pflanzen Österreichs und Ungarns und meinte, man könne sie argyrokome (»silberhaarig«) nennen. 8 Jahre später übersandte ihm aus England der Apotheker James Garet Rhizome dieser Art, die aus Amerika gekommen waren. Clusius hat sie dann offenbar in seinem Garten kultiviert. Jedenfalls bringt er 1601 in seinem Werk über seltene Pflanzen nicht nur eine eingehende Beschreibung, sondern auch eine schöne Abbildung des Gnaphalium Americanum. Joachim Burser, ein Schüler Caspar Bauhins, sammelte die Art Anfang des 17. Jhs. (wohl 1614 o. 1615) im Bauhinschen Garten in Basel und gab an, ein Pariser Apotheker habe sie aus Brasilien mitgebracht. Die Angabe »ex Brasilia« ist jedoch zweifellos falsch. Wahrscheinlich waren diese Exemplare aus den damaligen französischen Kolonien im Osten Nordamerikas gekommen. Zur gleichen Zeit wurde die Art auch in dem von Bauhins Bruder Johann betreuten herzoglich württembergischen Garten in Mömpelgard (Montbéliard/Frankreich, damals württembergischer Besitz) gezogen. Relativ schnell verbreitete sich die Art nunmehr auch in den deutschen Gärten. 1613 führte sie der Hortus Eystettensis als Gnaphalium latifolium peregrinum, »Fremd Ruhr-Kraut« auf. Zwischen 1607 und 1630 war sie als Gnaphalium Americanum latifolium im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem vertreten. 1649 wuchs die Art im fürstlichen Garten in Kiel als »Weiß Ruhrkraudt« und 1655 im herzoglich schleswigschen Garten zu Gottorf als Gnaphalium flore albo pleno. 1663 war sie als »Americanisch Ruhrkraut« auch in den berlin-brandenburgischen Gärten vorhanden. Dort gab es wegen der Winterhärte dieser Staude zunächst Bedenken, denn in seinem Gartenbaubuch zählt Elsholtz (1684) die Pflanze zu dem »Schirm=Gewächß von Blumwerck«. Elsholtz beschreibt die Art und deren Vermehrung: »Dieses ist mit weisser Wolle überzogen/wie unser gemein Ruhr=Kraut/ist aber im übrigen an Grösse/Blättern und Blumen ein mercklicher Unterscheid. Man muß davon ein Pfläntzlein zu überkommen sich bemühen/dessen Wurtzel setzet in der Erden neue Zasern/daraus jährlich junge Stengel an den Seiten herfür lauffen: und kan also durch Abreissung derselben diß Gewächß leicht beybehalten und fortgepflantzet werden.« Der merkliche Unterschied zu dem Ruhrkraut führte dazu, daß Tournefort (1700) und ebenso Ruppius (1718) die Art als Elichrysum Americanum latifolium zu den Strohblumen versetzten. Linnaeus stellte das Perlkörbchen dann aber wieder als Gnaphalium margaritaceum zu den Ruhrkräutern. Später finden wir es auch in der Gattung Antennaria, Katzenpfötchen. Erst der englische Botaniker George Bentham ordnete die Art dann der 1837 von Augustin Pyramus de Candolle geschaffenen neuen Gattung Anaphalis zu, deren Bezeichnung durch Umstellung des Namens Gnaphalium künstlich gebildet wurde. Im 18. Jh. war das Große Perlkörbchen wegen seines wuchernden Wachstums und seiner leichten Vermehrbarkeit zu einer allgemein verbreiteten Zierpflanze geworden, die kaum in einem Garten fehlte und auch gern auf Friedhöfen gepflanzt wurde. Gleditsch nennt es 1773 »die große breit- und spitzblättrige Reinblumenstaude mit perlfarbenen Blumenknöpfen«, charakterisiert es als ein sehr beliebtes und hartes Staudengewächs und empfiehlt es für »etwas trockne Oerter«. Im 19. Jh. wurde die Art hier und da auch schon verwildert angetroffen, heute ist sie in Nordeuropa stellenweise eingebürgert.
Als weitere Art wurde 1824 das Dreinervige Perlkörbchen (A. triplinervis (Sims) Sims et Clarke) aus dem Himalaya nach England eingeführt. Seit der Mitte des 19. Jhs. erscheint es dann auch in zunehmendem Maße in deutschen Gärten und fand aufgrund seines niedrigen Wuchses seinen Platz vor allem im Steingarten. »Sie ist eine der schönsten Arten«, schrieb Karl Foerster in seinem Steingartenbuch, während er die alte A. margaritacea lediglich noch »zur Kompostbereitung« empfiehlt, gewiß ein zu hartes Urteil über diese altbewährte robuste Art.