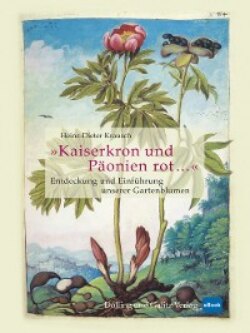Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAntirrhinum majus L. Garten-Löwenmaul
Antirrhinum majus L. Garten-Löwenmaul, Dodonaeus 1583
Die Heimat des Garten-Löwenmauls liegt im westlichen Mittelmeergebiet, wo es in Felsspalten und im Schotter der Flüsse wächst. Die trüb purpurroten Blüten der Wildform stehen in armblütigen Trauben. Mitte des 16. Jhs. kam die Art als Zierpflanze nach Deutschland, wo sie 1561 in den Gärten von Pflanzenliebhabern bereits recht verbreitet war. Allerdings handelte es sich fast überall um die Wildform bzw. eine dieser nahestehende Primitivsorte mit purpurnen Blüten, während Abänderungen mit gelben, weißen, roten oder rosa Blüten noch außerordentlich selten waren. Um 1570 war die Art z.B. im Leuschnerschen Garten in Meißen als Antirrhinum, Welscher Orant nur in einer roten und in einer weißen Form vertreten. Nach und nach nahmen diese Farbformen aber immer mehr zu. Im fürstbischöflichen Garten von Eichstädt zählte man 1613 bereits 5 Farbensorten: weiß, rot, weiß mit rotem Saum, weiß mit gelbem Saum und weiß mit rötlichem Saum. Wie die Abbildungen zeigen, waren diese Formen aber noch allesamt relativ wenigblütig. Bis zum Beginn des 19. Jhs. stieg die Zahl der Farbformen weiter an. Es gab sie damals vom dunkelsten bis zum hellsten Rot, in Gelb, Weiß und zwei- oder mehrfarbig bunt, auch gefüllt. Auch existierte eine Form mit panaschierten Blättern. Obwohl durch Auslese bereits farbkräftigere und reicherblütige Formen entstanden waren, setzte die eigentliche Züchtung erst im 19. Jh. ein. Durch intensives züchterisches Wirken entstand eine Vielzahl von Sorten mit großen, in dichten Trauben zusammenstehenden Blüten, deren Farbspiel zahlreiche gelbe, rosa- und lachsfarbene, rote, orange- und bronzefarbene Farbtöne wie auch reines und unterschiedlich farbig abgestuftes Weiß umfaßt. Es gibt einfache und gefüllte Sorten, solche mit radiären Blüten und solche, deren Blütenstände denen der Hyazinthen ähneln. Nach der Wuchshöhe unterscheidet man Hohe Sorten (Maximum-Gruppe), Halbhohe Sorten (Nanum-Grandiflorum- und Nanum-Maximum-Gruppe) und Niedrige Sorten (Pumilum-Gruppe, Zwerg-Löwenmaul).
Der wissenschaftliche Gattungsname geht auf den bereits von antiken Autoren (Theophrast, Dioskurides, Plinius) für diese oder eine andere Rachenblütler-Art gebrauchten Namen antirrhinon (»nasenähnlich«) zurück, der sich auf die Form der reifen Fruchtkapsel bezieht. Die zweilippige, sich bei Fingerdruck öffnende Rachenblüte war Anlaß für den deutschen Namen, der bereits im Epitome von Matthiolus/Camerarius (1586) und im Hortus Eystettensis (1613) als »Löwenmäuler« sowie bei Elsholtz (1663, 1684) als »Löwenmaul« erscheint, aber recht eigentlich erst im 18. Jh. in Gebrauch kam. Vordem nannte man die Art im Deutschen meist Orant, welcher Name sonst das in Deutschland wildwachsende Feldlöwenmaul (Misopates orontium (L.) Rafin.), aber auch verschiedene andere Pflanzen, die für zauberische Zwecke verwendet wurden, bezeichnete.