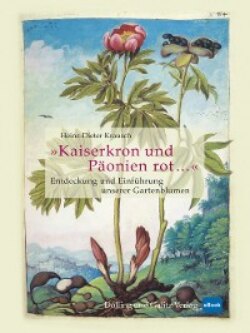Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAsphodeline lutea (L.) Rchb. Junkerlilie
Asphodeline lutea (L.) Rchb. Junkerlilie, Matthiolus/Camerarius 1586
Die im Mittelmeergebiet und Vorderasien in Gesteinsfluren heimische Art war offenbar bereits den antiken Autoren bekannt, kam aber erst zur Zeit der Renaissance aus Italien nach Deutschland. Zuerst nannte man sie hier mit ihrem lateinischen Namen Hastula regia, »Königsspießlein«, dann aber setzte sich der griechische Name Asphodelus durch, wobei diese Art wegen ihrer gelben Blüten und gelben Wurzeln als Asphodelus luteus bezeichnet wurde. Auch Linnaeus behielt 1753 diesen Namen bei, bis der Dresdener Botanikprofessor Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach der Art 1830, als er sie aus der Gattung Asphodelus herausnahm, den heute gültigen wissenschaftlichen Namen gab. Zuerst war die Art in Deutschland noch recht selten. Konrad Gessner lernte sie zuerst in Basel im Garten von Zwingger kennen. 1561 zog er sie – neben 2 anderen Asphodelus-Arten – dann auch selbst in seinem Garten in Zürich. Nunmehr breitete sich die Pflanze ziemlich rasch aus. Schon 1586 charakterisierte sie Camerarius als bekannte Gartenpflanze (»Hortis est familiaris«). Die »Affodilwurtz« war damals nicht nur Zierpflanze, sondern auch Heilpflanze. Ihre Wurzel diente als harntreibendes Mittel. 1684 gab Elsholtz in seinem Gartenbau erste Kulturhinweise: »Diese (Pflanzen) werden durch Zerreissung ihrer Wurtzeln insgemein fortgebracht/bedürfen nachmals keiner sorgfältigen Wartung: sondern halten sich leicht/und mehren sich jährlich in der Erden mit neuen Knollen.« 1773 beschreibt Gleditsch die Goldwurz oder Gelbe Affodilenwurzel als »ein schönes und dauerhaftes Staudengewächse in weitläufigen Lustgärten, wo es seine prächtigen Blumenähren auf einem drey oder vier Fuß hohen Stengel zu Ende des Frühlinges bringt ... Die gemeinen Gärtner nennen das Gewächse, des Stengels halber, Peitschenstock.« Auch im 19. Jh. blieb die nunmehr Junkerlilie genannte Art eine weitverbreitete Gartenpflanze, erfuhr jedoch keine züchterische Weiterentwicklung. Nur eine Form mit gefüllten Blüten wurde gelegentlich kultiviert. Im 20. Jh. empfiehlt Karl Foerster (1874–1970) in seinem Gartenbaubuch den Gelben Affodill als eine unverwüstliche, langlebige Blütenstaude, »wenn seine Ansprüche an vollsonnige Lage und etwas kalkhaltigen bis neutralen Boden erfüllt werden«, und nennt ihn als ideal für einen Steppengarten, schreibt aber auch, er sei jetzt »leider in den Gärten selten zu sehen«.