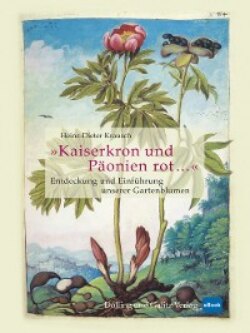Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBegonia L. Begonie, Schiefblatt
Die rd. 800 Arten dieser Gattung sind Bewohner der tropischen und subtropischen Zonen Amerikas, Afrikas und Asiens und können in Mitteleuropa zumeist nur im Gewächshaus oder als Zimmerpflanze gezogen werden. Als erster stieß der spanische Arzt und Naturforscher Francisco Hernandez um 1580 in Mexiko auf eine Begonien-Art (es handelte sich um die heutige Art B. gracilis H. B. K.), die er in seinem großen, jedoch erst 1651 im Druck erschienenen Werk über die Arzneimittel Neu-Spaniens abbildete und beschrieb, und zwar unter ihrem aztekischen Namen Totoncaxoxo coyollin. 1690 fand der französische Missionar und Botaniker Charles Plumier, ein Franziskanerpater, auf den Antilleninseln weitere Arten. Plumier gab ihnen den wissenschaftlichen Gattungsnamen Begonia, zu Ehren von Michel Bégon (1638–1710), Gouverneur von Französisch Kanada, später von St. Domingo, einem großen Pflanzenfreund und Förderer der Botanik. Linnaeus übernahm den Gattungsnamen Begonia, vereinigte 1753 aber die bis dahin bekannt gewordenen 6 Sippen in seiner Sammelart B. obliqua (zu lat. obliquus, »schief«).
Als erste Begonie wurde 1777 B. minor Jacq. (= B. nitida Ait.) aus Jamaika in England eingeführt. Die große Masse der bis heute bei uns kultivierten Arten kam erst im 19. Jh. nach Europa. Im Jahre 1808 gab es im Berliner Botanischen Garten erst 4 Begonien-Arten (B. minor Jacq. = B. nitida Ait., B. dichotoma Jacq., B. acutifolia Jacq. = B. acuminata Dryand., B. humilis Dryand.), und im Garten des Hofgärtners Christian August Breiter in Leipzig war die Gattung Begonia 1817 lediglich durch 7 Warm- und Kaphaus-Arten vertreten.
Nur ganz wenige Arten eignen sich bei uns für eine sommerliche Freilandkultur. Die wichtigste davon ist die Immerblühende Begonie (B. cucullata Willd. var. hookeri (A. DC.) L. B. Sm. et Schub. = B. semperflorens Link et Otto). Sie kam auf eine recht ungewöhnliche Weise und eigentlich nur zufällig nach Europa, und zwar keimte sie auf aus der Erde von Pflanzen, welche Friedrich Sello 1820 aus Porto Alegre im südlichen Brasilien an den Botanischen Garten in Berlin geschickt hatte. Dessen damaliger Direktor Professor Heinrich Link (1767–1851) und der Garteninspektor Friedrich Otto (1782–1856) beschrieben sie 1828 in ihrem Abbildungswerk der neuen und seltenen Gewächse des Botanischen Gartens als B. semperflorens. Sehr viel später stellte es sich heraus, daß es sich bei dieser Art lediglich um eine Varietät der bereits 1805 beschriebenen B. cucullata handelt. Seit etwa 1830 gelangte die Immerblühende Begonie in die allgemeine Gartenkultur, wurde aber vorerst lediglich als Warmhauspflanze gezogen. Im letzten Viertel des 19. Jhs. entstanden durch Auslese und durch Einkreuzung weiterer Arten die Begonia-Semperflorens-Hybriden. Zuerst kreuzte der französische Pflanzenzüchter Victor Lemoine (1823–1911) in Nancy die damalige weißblühende B. semperflorens mit der dunkelrot blühenden B. lyncheana Hook., später auch mit weiteren Arten (z.B. B. foliosa H. B. K.) und erzielte dadurch verschiedene rot-, rosa- und weißblühende Sorten, welche seit 1884 in den Handel kamen. In Deutschland beschäftigten sich vor allem die Erfurter Gartenbaufirmen Haage & Schmidt und Benary mit der züchterischen Weiterentwicklung der Semperflorens-Begonien. Zur Einkreuzung wurde außer B. lyncheana insbesondere die durch die Firma Haage & Schmidt 1879 aus Brasilien eingeführte B. schmithiana Regel benutzt, wodurch die Reich- und Langblütigkeit der Sorten erheblich erhöht werden konnte. Eine Form mit dunklem Laub (cv. ‘Atropurpurea’) wurde 1890 in den Handel gegeben. So konnte 1901 der Erfurter Gärtner F. C. Heinemann berichten: »Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, daß man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und größten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von größter Bedeutung.« Heute hat man fast ausschließlich leistungsfähige F1-Sorten, welche ausgeglichene, wüchsige, reichblütige und meist witterungsunempfindliche Bestände ergeben, wobei das Farbenspiel der Blüten von Weiß über Rosa bis hin zum kräftigen Rot reicht. Die im Volksmund Eisblumen, Eisbegonien oder Gottesaugen genannten Pflanzen gehören weiterhin zu den beliebtesten und häufigsten Zierpflanzen und kommen überall in Deutschland in Gärten und in Grünanlagen, in Balkonkästen und auf Gräbern in reichlichem Maße zur Anpflanzung. Die Anzucht wird im allgemeinen von Gärtnereien besorgt, welche die Pflanzen bereits zeitig im Dezember und Januar unter Glas aussäen und nach zweimaligem Pikieren ab Mitte Mai zum Verkauf bringen.
Die heute ebenfalls vielfach in Gärten und Grünanlagen, auf Balkonen und Friedhöfen gepflanzten Knollen-Begonien sind Hybriden, deren Stammeltern seit 1865 aus den Anden Perus und Boliviens eingeführt wurden. Die erste derartige Hybride, hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen B. boliviensis A. DC. und B. rosaeflora Hook. f., brachte um 1870 die englische Gartenbaufirma James Veitch & Sons in London-Chelsea auf den Markt. Sie diente als Ausgangspunkt für die Einkreuzung weiterer Arten, wie B. pearcei Hook., B. veitchii Hook., B. davisii Veitch ex Hook. und B. froebelii A. DC. An der Züchtungsarbeit beteiligten sich in der ersten Phase außer der englischen Firma Veitch auch Victor Lemoine in Nancy und Erfurter Betriebe. Heute erfolgt die Züchtung und Vermehrung von Knollen-Begonien vor allem in Holstein und in Belgien. Die Anzucht der Knollen besorgen meist Gartenbaubetriebe. Die Knollen werden dann von Februar bis April angetrieben und sind ab Mitte Mai zur Verwendung bereit.