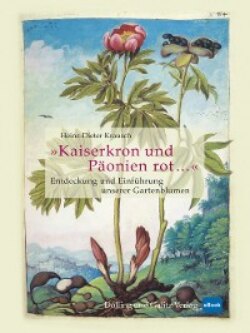Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAnemone L. Windröschen, Anemone
Anemone hupehensis (Lemoine) Lemoine Japan-Anemone, Rümpler 1890 (links)
Anemone coronaria L. Kronen-Anemone (Mitte)
A. hortensis L. Garten-Anemone, Matthiolus/Bauhin 1598 (rechts)
Das auch in Mitteleuropa in Steppenrasen und wärmeliebenden Saumgesellschaften vorkommende, jedoch insgesamt seltene und streckenweise völlig fehlende Große Windröschen (A. sylvestris L.) wurde seit Ausgang des 16. Jhs. hier und da in Gartenkultur genommen. So finden wir es 1613 im fürstbischöflichen Garten von Eichstädt und 1630 im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem. Hingegen kennt es Elsholtz 1663 und auch noch 1684 aus Berlin und Brandenburg lediglich als Wildpflanze. Dort kam es u.a. auf den Rüdersdorfer Kalkbergen vor und wurde deshalb in Berlin vielfach »Rüdersdorfer Anemone« genannt. Erst 1773 berichtet Gleditsch, diese Anemone werde nunmehr auch hier »wegen ihrer großen schneeweißen Blumen« als Gartenpflanze gezogen, zumal sie ohne menschliche Pflege in hohen, trockenen, steinigen, kalkigen und sandigen Böden gedeihen könne. Insgesamt war das Große Windröschen als Zierpflanze jedoch nicht sehr häufig. Durch Auslese entstand die höherwüchsige und größerblütige Sorte ‘Macrantha’. Eine gefüllte Form ist seit mindestens 1837 bekannt.
Erst in den neunziger Jahren des 19. Jhs. kam das in Südeuropa, Kleinasien und dem Kaukasus heimische Reizende Windröschen (A. blanda Schott et Kotschy) nach Deutschland, eingeführt durch die Gärtner und Pflanzensammler Max Leichtlin in Baden-Baden und Walter Siehe in Izmir/Türkei. In der Gartenkultur entstanden von der ursprünglich weiß- oder blaublühenden Art zahlreiche Farbformen und Sorten. Obwohl diese in Form von Knollen alljährlich in großer Zahl und relativ preisgünstig vom Handel angeboten werden, ist das Reizende Windröschen wegen seiner mangelnden Winterfestigkeit hierzulande im allgemeinen nur wenig zu sehen.
1827 entdeckte Lady S. Amherst, die botanisch sehr interessierte Gattin des britischen Generalgouverneurs von Indien, auf einer Reise in den Himalaya die Weinblättrige Anemone (A. vitifolia Buch.-Ham.). 1828 brachte sie Samen davon nach England, aus denen im folgenden Jahr Pflanzen angezogen und in Gartenkultur genommen wurden. 1867 wird diese Art auch für Norddeutschland als Gartenpflanze verzeichnet.
Die nahestehende Filzige Anemone (A. tomentosa (Maxim.) C. P’ei) aus Nordchina wurde 1909 durch William Purdom und 1914 durch Reginald Farrer in England eingeführt. Zunächst betrachtete man sie als Varietät von A. vitifolia. Erst der chinesische Botaniker P’ei Chien erkannte ihr 1933 Artrang zu. Als winterhärteste und robusteste der hochwüchsigen Anemonen wird sie nunmehr auch in Deutschland in zunehmender Menge als spätsommer- bis frühherbstblühende Staude in den Gärten angetroffen.
Die Japan-Anemone (A. hupehensis (Lemoine) Lemoine) wurde in China bereits seit langer Zeit als Zierpflanze kultiviert und kam als solche auch nach Japan. Von dort erwähnt sie zuerst der deutsche Arzt Andreas Cleyer, der von 1682 bis 1686 in der Handelsniederlassung der Niederländischen Ostindien-Kompanie in Nagasaki tätig war, und 1784 beschrieb sie der schwedische Botaniker Carl Peter Thunberg, ein Schüler von Linnaeus, in seiner Flora Japonica. Aber Pflanzen gelangten damals noch nicht nach Europa. Erst 1844 sandte der englische Botaniker Robert Fortune (1812–1880), der auf seiner ersten Chinareise (1843–1846) in der Nähe von Shanghai auf diese Art gestoßen war, lebende Exemplare nach England. Von dort aus kam die Japan-Anemone auf das europäische Festland. 1855 läßt sie sich für Deutschland als Gartenpflanze belegen. In Frankreich entstanden bereits 1847 durch Kreuzungen mit A. vitifolia die Herbst-Anemonen (A. x hybrida Paxt.), von denen es inzwischen eine ganze Anzahl von Sorten mit einfachen oder halbgefüllten, weißen, rosa und purpurroten Blüten gibt, so z.B. die 1858 in der Gärtnerei von M. Jobert in Verdun erzielte, 1863 in den Handel gekommene weißblühende Sorte ‘Honorine Jobert’.
Die im Mittelmeergebiet und Westasien heimischen, knollenbesitzenden Arten der Anemone-Coronaria-Gruppe, insbesondere die Kronen-Anemone (A. coronaria L.) und die Pfauen-Anemone (A. pavonina Lam.) sowie die zwischen beiden entstandene Hybride A. x fulgens Gay wurden dort bereits seit altersher auch als Gartenblumen gezogen. Gartenformen dieser Sippen kamen Ende des 16. Jhs. aus türkischen Gärten, aus Italien und Südfrankreich nach Mittel- und Westeuropa. Die Abbildungen in den Pemptades von Rembert Dodonaeus (1583) und in dem 1586 erschienenen Epitome von Matthiolus/Camerarius stellen offenbar noch Wildpflanzen aus Italien dar. Bereits im Garten gezogen wurde in Deutschland die Anemone flore incarnato, radice tuberosa, zu deutsch Anemonenröschen, welche das um 1590 entstandene sogenannte Camerarius-Florilegium farbig abbildete. 1594 zog Laurentius Scholz in seinem Breslauer Garten 2 Sippen, eine Anemone coccineo flore und eine Anemone tuberosa geranifolia coerulea. In der 1. Hälfte des 17. Jhs. kannte man dann schon zahlreiche Formen und Sorten, welche zu den Prachtpflanzen der Barockgärten gehörten. Wegen ihrer geringen Winterfestigkeit erforderten sie freilich besondere Pflege und blieben daher zumeist auf Botanische, Adels- und Liebhaber-Gärten beschränkt. Im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem wurden 1630 bereits 22 Formen dieser Anemonen mit einfachen und mit gefüllten Blüten in weißen, roten und violetten Farbtönen kultiviert, dazu eine gefüllte Form der gelbblühenden A. palmata L. aus dem westlichen Mittelmeergebiet, von welcher 1613 der Hortus Eystettensis eine farbige Abbildung brachte. Bis zum Jahre 1651 kamen in Hessem 12 weitere Formen hinzu. In seinem Gartenbaubuch (1684) rechnete Elsholtz in Berlin diese Anemonen zum »Schirm= Gewächß von Blumwerck« und nennt auch schon einige (meist französische) Namensorten. Seine sehr ausführlichen Kulturhinweise enden mit dem Satz: »Schließlich hat die Erfahrung gelehret/daß in warmen Gärten so zwischen Gebäwden liegen/und bey gelinden Wintern/die Anemonen auch unter unserm Climate im offenen Lande keinen Schaden leiden: jedoch ist nicht allzeit zu trawen/sondern man sol zum wenigsten die Helffte der Wurtzeln außheben/und im Gemach überwintern lassen/die aber im Garten gelassen/bedecken.«
Auch in den folgenden Jahrhunderten wurden diese Garten-Anemonen in Holland züchterisch weiterentwickelt, vermehrt und versandt, in Deutschland vielerorts als Zierpflanzen gezogen. Wegen ihrer Frostempfindlichkeit und geringen Dauerhaftigkeit haben sie hierzulande allerdings kaum irgendwo den Status einer bleibenden Gartenblume erreichen können. Meist werden sie von Gartenbaubetrieben unter Glas kultiviert und als Schnitt- oder Topfblumen in den Handel gebracht.