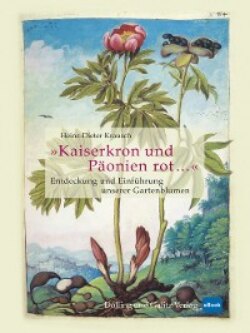Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVon Theophrast bis heute – die Quellen
Die Quellen zur Geschichte unserer Gartenblumen sind in erster Linie gedruckte und handschriftliche Angaben, dann aber auch bildliche Darstellungen, archäologische Befunde und Herbarien.
Angaben über Gartenzierpflanzen finden sich bereits in den Werken antiker Schriftsteller wie in Theophrasts (370–285) De historia plantarum, Dioskurides’ (1. Jh. n. Chr.) Materia medica und Plinius’ (23–79) Naturalis historiae libri. Da diese Werke ebenso wie die weiterer antiker Autoren durch neuzeitliche Auswertungen weitgehend erschlossen sind, ist ein Zurückgehen auf die Originaltexte kaum notwendig. Auch für die in einigen mittelalterlichen Handschriften überlieferten Berichte über Gärten und Gartenpflanzen stehen neuere, kommentierte und erläuterte Textausgaben zur Verfügung. Unter den in der Bibel genannten Pflanzen (Zohary 1986) befinden sich nur wenige, die als Zierpflanzen kultiviert wurden, zudem ist die Zuordnung der biblischen Namen zu bestimmten Pflanzenarten nicht immer sicher. Wichtigste Quellen für die Zeit des frühen Mittelalters sind die um 800 erlassene Landgüterverordnung Capitulare de villis Karls des Großen, der nur wenig später entstandene St. Gallener Klosterplan und das Hortulus genannte Gartengedicht des Reichenauer Mönches und Abtes Walahfried Strabo (807–849). Dem hohen Mittelalter entstammen die Physica der Äbtissin Hildegard von Bingen (1099–1179) und die Schriften des Bischofs und Universalgelehrten Albertus Magnus (Albert Graf von Bollstädt, 1193–1280).
Nach der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jh. gibt es alsbald erste Bücher über Heil- und Gartenpflanzen, wie z.B. das Puch der Natur 1475 von Konrad von Megenberg und den Gart der Gesundheit 1485.
Die eigentliche botanische Literatur beginnt in der Mitte der 16. Jhs. mit den »Vätern der Botanik« Otto Brunfels (um 1489–1534), Hieronymus Bock (um 1498–1554) und Leonhart Fuchs (1501–1566). In ihren, mit Abbildungen versehenen Kräuterbüchern bringen diese als Ärzte tätigen Autoren zwar in erster Linie Angaben über Heilpflanzen und deren Heilwirkungen, doch auch Angaben über Zierpflanzen, selbst wenn diese sich nicht für medizinische Zwecke verwenden ließen, wie z.B. über die sich damals in den Gärten Mitteleuropas ausbreitenden ersten Arten aus Amerika. Weitere derartige Kräuterbücher erschienen in der 2. Hälfte des 16. Jhs., z.B. von Adam Lonicerus (Lonitzer 1528–1586), Petrus Andreas Matthiolus (Pierandrea Mattioli 1500–1577) und Jakob Tabernaemontanus (Theodorus um 1520–1590).
Schon in der Mitte des 16. Jhs. gab es Gartenliebhaber, welche artenreiche Gärten besaßen und bestrebt waren, deren Pflanzenbestand durch Tausch und Erwerb neuer Sippen zu vermehren. Berühmt war damals z.B. der Pflanzen- und Arzneipflanzengarten des Nürnberger Apothekers Georg Öllinger (1487–1557), der nach seinem Ableben von dem Nürnberger Stadtarzt Joachim Camerarius (1534–1598), ebenfalls leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber, übernommen wurde und über dessen Pflanzenbestand ein 1588 herausgegebener Katalog unterrichtet. 1560 wandte sich der Züricher Arzt und Naturforscher Konrad Gessner (1516–1565) an die ihm bekannten Pflanzenliebhaber Mitteleuropas mit der Bitte, ihm Listen der in ihren Gärten kultivierten Pflanzen anzufertigen. Wohl die meisten von ihnen kamen seinem Ersuchen nach, und Gessner veröffentlichte diese Pflanzenlisten 1561 unter dem Titel Horti Germaniae als Anhang zu den von ihm herausgegebenen Annotationes des frühverstorbenen Botanikers Valerius Cordus (1515–1544). Kurt Wein gab diese einzigartige Quelle über Deutschlands Gartenpflanzen um die Mitte des 16. Jhs., aufbereitet und kommentiert, im Jahre 1914 erneut heraus. Weitere wichtige Angaben über Zierpflanzen in der 2. Hälfte des 16. Jhs. enthalten der um 1570 entstandene Gartenkatalog des Leuschnerschen Gartens in Meißen, abgedruckt in einer späteren Stadtgeschichte von Gregorius Fabricius, sowie die Kataloge des Gartens des Arztes Laurentius Scholz in Breslau 1594 und der Gärten der Bergstadt Annaberg im Erzgebirge (in Jenisius 1605).
Hinzu kommen Regionalfloren wie die Abhandlung über die in Preußen wachsenden Kräuter des pomesanischen Bischofs Johann Wigand (1523–1587) von 1590 und der Hortus Lusatiae von Johannes Franke (1545–1617) von 1594. Über die Einführung neuer Gartenzierpflanzen, insbesondere aus türkischen Gärten, finden sich zahlreiche Angaben in den Werken des Botanikers Carolus Clusius (Charles de l’Ecluse 1526–1609), der 1573–1588 in Wien ansässig und seit 1593 als Professor an der Universität Leiden tätig war. Eigene Forschungsreisen auf der Iberischen Halbinsel, in Österreich und Ungarn sowie seine vielfältigen Verbindungen zu den kaiserlichen Gesandten in Konstantinopel, zu anderen Gelehrten und Pflanzenliebhabern brachten ihm zahlreiche neue Arten, vor allem auch Zwiebel- und Knollenpflanzen, die er in seinen Büchern nicht nur eingehend beschrieb, sondern auch an andere Pflanzenliebhaber weitergab und damit in umfangreichem Maße zu ihrer Ausbreitung in Mitteleuropa beitrug. Seine von Wien nach Leiden überführte Sammlung seltener Arten und Sorten von Zwiebelpflanzen bildete einen der Ausgangspunkte für die sich damals in Holland entwickelnde Blumenzwiebelkultur, die auch für die mitteleuropäischen Gärten von großer Bedeutung war und noch immer ist. Auch erste Gartenbücher finden sich im 16. Jh., so das 1529 in Zwickau erschienene New Pflantzbüchlein von Johann Domitzer und die 1597 in Leipzig gedruckte Garten Ordnung von Johann Peschel. Sie enthalten zwar vornehmlich Anweisungen zu den im Garten durchzuführenden Arbeiten, aber doch auch einige Angaben über Zierpflanzen.
Carolus Clusius (Charles de l’Écluse, 1526–1609), bedeutendster Botaniker der Renaissance. Im Gegensatz zu den meisten Kräuterbuch-Autoren, bei denen die Heilwirkunge der Pfanzen im Mittelpunkt standen, betrieb er seine Forschungen unter rein botanischen Aspekten. Ihm verdanken wir nicht nur die Beschreibung, sondern auch die Einführung und Verbreitung zahlreicher Zierpflanzen.
Im 17. Jh. erschienen weitere Gartenkataloge, Regionalfloren und Gartenbücher. Unter ihnen ragt der mit prachtvollen, in einigen Ausgaben mit naturgetreu kolorierten Kupferstichen ausgestattete Hortus Eystettensis heraus, der von dem Nürnberger Apotheker Basilius Besler (1561–1629) besorgte Pflanzenkatalog der Gärten der Willibaldsburg im mittelfränkischen Eichstätt, der Residenz des Fürstbischofs Johann Conrad von Gemmingen (1560/61–1612). Das wichtigste und inhaltsreichste Gartenbuch früherer Zeit ist das seit 1666 in mehreren Auflagen veröffentlichte Gartenbaubuch des Berliner Arztes, Botanikers und Gartendirektors Johann Sigismund Elsholtz (1623–1688). Erwähnenswert ist ferner die 1648 veröffentlichte Beschreibung des herzoglich braunschweigischen Gartens zu Hessem bei Wolfenbüttel, dem wohl artenreichsten deutschen Garten der damaligen Zeit, durch dessen Obergärtner Johann Royer. Solche Gartenkataloge von privaten und fürstlichen Lust- und Liebhaber-Gärten setzten sich in Deutschland bis in die 1. Hälfte des 19. Jhs. fort. Daneben gab es Pflanzenkataloge von Botanischen Gärten an Universitäten und Hochschulen. Zu den frühesten dieser Gruppe gehören in Deutschland die Horti medici, qui Ratisbonae est, descriptio (1621) von Johann Oberndorffer in Regensburg und der Catalogus plantarum in horto Altdorphino (Altdorf bei Nürnberg; 1635) von Ludwig Jungermann (1572–1653). Besonders umfangreich ist die 1809 erschienene Enumeratio plantarum des alten Berliner Botanischen Gartens in Schöneberg (bis 1900), welcher 1808 unter der Leitung von Carl Ludwig Willdenow (1765–1811) 6351 Arten aufwies und damit der artenreichste Botanische Garten Mitteleuropas zu dieser Zeit war.
Bis gegen Ende des 18. Jhs. war es allgemein üblich, in den Regionalfloren neben den Wildpflanzen auch die in den Gärten gezogenen Nutz- und Zierpflanzen aufzuführen. Zwar nennt der Berliner Botaniker Paul Ascherson (1834–1913) in seiner Flora der Provinz Brandenburg 1864 noch eine Vielzahl von Gartenpflanzen, doch seit Beginn des 19. Jhs. beschränkten sich viele regionale und überregionale Florenwerke auf die Angabe einiger besonders häufiger Gartenzierpflanzen oder führten solche Pflanzen nur auf, wenn sie im Gebiet verwildert auftraten. Das mag damit zusammenhängen, daß seit dem 19. Jh. Gartenfloren aufkamen, welche fast ausschließlich auf die Bestimmung der vorhandenen Gartenpflanzen ausgerichtet sind. Als wohl verbreitetstes Gartenbuch des 19. Jhs. sei der seit 1818 vielfach aufgelegte Gartenfreund des mecklenburgischen Pfarrers Johann Christian Ludwig Wredow (1773–1823) genannt. Seit dem 19. Jh. erschienen dann auch umfassende Handbücher über Gartenpflanzen, so 1802–1810 das Vollständige Lexikon der Gärtnerei und Botanik von Friedrich Gottlieb Dietrich (1768–1850) und 1829 das Vollständige Handbuch der Blumengärtnerei von Julius Bosse (1788–1864). Diese Gartenbücher liefern für die Geschichte unserer Gartenblumen vor allem Angaben über das Vorhandensein von Gartenzierpflanzen und ihrer Kultivare, weniger über die Häufigkeit und Verbreitung dieser Pflanzen im mitteleuropäischen Raum.
Quellen ähnlicher Art sind die Verkaufskataloge von Handelsgärtnereien und Baumschulen, die um die Mitte des 18. Jhs. aufkamen und bis heute erstellt werden. An älteren Katalogen dieser Art sollen hier die der Gärtnerei Krause in Berlin 1746, der Gärtnerei Buek in Hamburg von 1779, der von Burgsdorffschen Baumzucht in Tegel bei Berlin 1785, der Gärtnerei Breiter in Leipzig von 1817 und der Landesbaumschule bei Potsdam seit 1824 als Beispiele genannt werden.
Gegen Ende des 18. Jhs. entstanden spezielle Gartenzeitschriften, in Deutschland im Jahre 1782. Eine der führenden war die seit 1852 erscheinende »Gartenflora« des seit 1855 als Direktor des Botanischen Gartens von St. Petersburg wirkenden Gärtners und Botanikers Eduard Regel (1815–1892) aus Gotha in Thüringen. Sie enthält sogar eine Reihe von Erstbeschreibungen von neuentdeckten Pflanzen, die als Gartenzierpflanzen eine Rolle spielen sollten. Im allgemeinen informieren die Gartenzeitschriften über neu eingeführte Zierpflanzen, Neuzüchtungen von Formen und Sorten, zudem enthalten sie mancherlei rückschauende Berichte zur Einführungs- und Züchtungsgeschichte einzelner Arten. Geschichtliche Angaben finden sich auch in den seit dem 19. Jh. in zunehmendem Maße erscheinenden Monographien gärtnerisch wichtiger Arten, Gattungen oder Pflanzengruppen, wobei manche dieser Daten jedoch einer kritischen Überprüfung bedürfen.
Neben der Fülle gedruckt vorliegender Zierpflanzenliteratur gibt es in Archiven und Bibliotheken handschriftliche, bisher unveröffentlichte Quellen, vor allem in Gestalt von Gartenkatalogen und Garteninventaren sowie Manuskripte und Briefe von Botanikern, Gartenliebhabern und Gärtnern. Für das vorliegende Buch wurden Unterlagen aus dem Archiv der Akademie der Wissenschaften, der Handschriften-Abteilung der Staatsbibliothek Berlin sowie aus dem Landesarchiv Schleswig herangezogen.
Es sei hier kurz auf zwei Probleme hingewiesen, die sich bei der Benutzung und Auswertung der älteren Zierpflanzenliteratur ergeben. Da viele Kräuterbücher und Florenwerke, letztere zum Teil bis zu Beginn des 19. Jhs., in lateinischer Sprache abgefaßt wurden, sind fundierte Lateinkenntnisse Voraussetzung der Lektüre. Das andere Problem sind die Pflanzennamen der älteren Schriften. Bevor Linnaeus (seit 1762 Carl von Linné, 1707–1778) in der Mitte des 18. Jhs. die sich schnell durchsetzende binäre Nomenklatur schuf, wurden die Pflanzen mit vielfach langen Bezeichnungen (Phrasen oder Polynome) versehen, die zudem bei den einzelnen Autoren oft verschieden waren. Versuche, insbesondere 1623 durch Caspar Bauhin (1560–1624) und 1700 durch Joseph Pitton de Tournefort (1656–1708), diesen Namenwirrwarr zu vereinheitlichen, blieben ohne allgemeine Anerkennung und dauerhafte Wirkung. Leider gibt es bis heute keine umfassende Zusammenstellung und Identifizierung der vorlinnéischen Pflanzennamen. Man ist hier auf die Aufarbeitungen einiger weniger botanischer Schriften von vor 1753 z.B. durch Kurt Wein, John Harvey und Gerard Aymonin angewiesen, oder auf die Bestimmung der betreffenden Arten mittels der beigegebenen Abbildungen. Ohne Erfahrung und detaillierte Kenntnisse in dieser Materie kommt es leicht zu Fehlbestimmungen. Aber auch die binären Namen bergen Probleme, zumal viele Zierpflanzen in der Literatur oftmals unter heute ungültigen und in Vergessenheit geratenen Namen (Synonymen) erscheinen.
Bildliche Darstellungen als Quellen für die Geschichte unserer Gartenblumen reichen weit in die Vergangenheit zurück. So fanden sich Abbildungen der Weißen Lilie (Lilium candidum) auf Gefäßen und an Wänden von Wohngebäuden und Grabkammern sehr früher mesopotamischer, ägyptischer und altgriechischer Kulturen. Auch in dem im Jahre 79 durch einen Ausbruch des Vesuv verschütteten Pompeji sind verschiedene Zierpflanzen auf Wandgemälden zu sehen. Auf mittelalterlichen Gemälden finden sich insbesondere solche mit christlichem Symbolgehalt wie Gallische Rose (Rosa gallica), Weiße Rose (Rosa x alba), Deutsche Schwertlilie (Iris germanica) und Akelei (Aquilegia vulgaris). Ein besonders reichhaltiges Beispiel ist das um 1410 von einem oberrheinischen Meister gemalte »Paradiesgärtlein« im Städel Museum in Frankfurt am Main. In einem mittelalterlichen Burggarten zeigt es neben Figuren aus christlichen Legenden eine größere Zahl von Gartenpflanzen. Diese, wie auch die verschiedenen Vogelarten, sind trotz des kleinen Formats des Bildes von 26,3 x 33,4 cm so genau gemalt, daß sie eindeutig bestimmt werden können. Neben einigen Wild- und Nutzpflanzen erkennt man folgende als Zierpflanzen zu bewertende Arten (von vorn nach hinten): Maiglöckchen (Convallaria majalis), Wiesen-Margerite (Chrysanthemum leucanthemum), Echte Pfingstrose, einfachblühend (Paeonia officinalis), Kleines Immergrün (Vinca minor), Akelei (Aquilegia vulgaris), Himmelsschlüsselchen (Primula veris), Duft-Veilchen (Viola odorata), Gänseblümchen (Bellis perennis), Goldlack (Cheiranthus cheiri), Frühlings-Knotenblume (Leucojum vernum), Gallische Rose mit gefüllten Blüten (Rosa gallica), Weiße Lilie (Lilium candidum), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Gefleckte Taubnessel (Lamium maculatum), Vexiernelke (Lychnis coronaria), Levkoje, weiß- und rotviolett blühend (Matthiola incana), Deutsche Schwertlilie (Iris germanica) und Stockrose, rot- und weißblühend (Alcea rosea, Erstnachweis für Deutschland!).
Auch die seit der Renaissance entstehenden Bilder von Privatpersonen, Landschafts- und Gartenmotiven zeigen Zierpflanzen wie die im 15. Jh. nach Mitteleuropa gekommene Garten-Nelke (Dianthus caryophyllus). Dürer macht Blumen sogar zum Hauptgegenstand von Bildern, wie die Blasse Schwertlilie (Iris pallida) um 1505. Üppige Blumensträuße mit einer Fülle von Gartenblumen malen ab dem 17. Jh. vor allem die Niederländer. Wichtige Bildquellen, vor allem, wenn sie sich datieren lassen, sind ferner die Florilegien, z.B. das sogenannte Camerarius-Florilegium aus der Zeit um 1590 und das Moller-Florilegium des Hamburger Blumenmalers Hans Simon Holtzbecker (gest. 1671). Sie zeigen mit großer Genauigkeit die Arten und Formen der damals in den Gärten kultivierten Gartenzierpflanzen. Und schließlich müssen die ab der 2. Hälfte des 15. Jhs. erscheinenden Arznei- und Kräuterbücher nochmals genannt werden. Sie sind sämtlich illustriert, zunächst mit relativ roh wirkenden, aber bereits Mitte des 16. Jhs. eine hohe künstlerische Qualität erreichenden Holzschnitten. Gegen Ende des 16. Jhs. trat neben diese Technik der Kupferstich, der zunehmend an Bedeutung gewann, bis er im 19. Jh. durch andere Abbildungstechniken abgelöst wurde. Die bildlichen Darstellungen in den Kräuter- und Gartenbüchern sowie in den Florilegien des 16. bis 18. Jhs., durch die nahezu alle hier behandelten Pflanzen erfaßt werden, stellen außerordentlich wichtige Quellen für die Geschichte der Gartenblumen dar, gestatten sie doch in den meisten Fällen eine genaue Bestimmung der Arten und zeigen die oft anfangs recht primitiven Gartensorten, aber auch ihre allmähliche Vervollkommnung in der Gartenkultur.
Archäologische Funde von Zierpflanzenresten sind selten. Zu nennen sind Grabbeigaben in antiken (z.B. altägyptischen), aber auch in mittelalterlichen Gräbern. Leider geben die römerzeitlichen Fundschichten im westlichen und südlichen Mitteleuropa kaum Auskunft über damalige Zierpflanzen, und es bleibt unklar, ob die Römer auch derartige Pflanzen aus Italien nach Mitteleuropa gebracht haben bzw. um welche es sich handelte.
Herbarien, d.h. Sammlungen zwischen Papier gepreßter und getrockneter Pflanzen, wurden seit dem 17. Jh. angelegt, doch haben von den älteren Sammlungen nur wenige die Zeitläufte überstanden. Um so größere Bedeutung für die Geschichte der Gartenzierpflanzen hat das bis auf geringe Verluste erhaltene, in den ersten 4 Jahrzehnten des 17. Jhs. zusammengetragene Herbar des Bauhin-Schülers Joachim Burser (1583–1639). Es wird heute in der Universität Uppsala aufbewahrt und erfuhr durch Hans O. Juel 1923 und 1936 eingehende Bearbeitung.