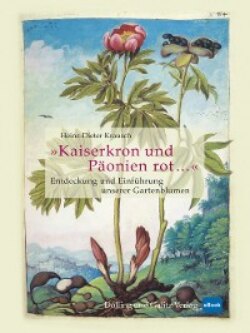Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAloe vera (L.) N. L. Burman (A. barbadensis Mill.) Echte Aloe
Von den die Trockengebiete Afrikas und Südasiens besiedelnden rund 250 Arten der Gattung Aloe besitzt die Echte Aloe ein weites Areal, das sich vom südlichen Mittelmeergebiet und Ost- und Südafrika über Südarabien und Nordwestindien bis nach Südchina erstreckt. Die Art wurde bereits im Altertum zur Öl- und Harzgewinnung genutzt und vielfach auch kultiviert und weiter verbreitet. Um 1650 gelangte sie durch die Spanier nach Mittel- und Südamerika, wo vor allem auf der Antilleninsel Barbados ausgedehnte Kulturen angelegt wurden. Die aus dem bitteren gelben Saft der Blätter durch Eintrocknen gewonnene Droge war seit altersher als abführendes, adstringierendes und wundheilendes Arzneimittel in Gebrauch. In biblischer Zeit verwendete man das Öl für Einbalsamierungen und als Duftstoff für Leichentücher. Heute ist es Bestandteil von Hautcremes und anderen Hautpflegemitteln. Die älteste Abbildung der Art enthält ein um 512 entstandener Dioskurides-Kodex.
Nach Mitteleuropa kam die Art hauptsächlich als Zierpflanze. 1415 ist sie in Italien nachweisbar, und 1539 erscheint sie dann auch in Deutschland. 1543 schrieb Leonhart Fuchs: »Aloen wächst mit grosser menge in India. Es würd auch in Arabia vnndt Asia gefunden/vnnd würd auch yetzund an ettlichen orten des Teutschlands gepflanzt in Gärten. Doch so vil mir bewußt/ist es noch keinem zu der volkommenheyt gewachsen/hat auch noch nie blumen gebracht.« 1561 war die Echte Aloe in Deutschland noch ziemlich selten, Ende des 16. Jhs. aber schon weit verbreitet. Wegen ihrer Frostempfindlichkeit konnte sie hier nur als Topf- oder Kübelpflanze gehalten werden. Eine ausführliche Kulturanleitung für diese, von ihm »Griechische Aloe« genannte und dem »Schirm=Gewächß von Blumwerck« zugerechnete Art gibt Elsholtz 1684: »Diese kan den Sommer über in Töpffen gehalten/gegen den Winter aber außgenommen/und in einem warmen Gemach an einen Balcken auffgehencket werden also/daß die Wurtzel oben komme. Alsdan pfleget sie drey Wochen lang ihre Farbe zu verlieren/bald darnach aber erholet sie sich/und wird gleichsam wieder lebendig: nach Außgang des Winters bringet man sie wieder in die Erde/sonst verdirbet sie in die Länge. Einige haben im brauch/daß sie diese Aloen unten mit Leim/welcher mit Öl durchknetet/oder mit einem wollenen Lumpen in Öl genetzet beschlagen/und also in einer warmen Stuben auffhengen. Sie hat bey uns keine solche Bittrigkeit/als in Orient/da man den bekanten Apotheker=Safft daraus bereitet: kommet auch in diesen Landen gar selten zur Blüht/zum Samen aber durchaus nicht: deswegen man die gantze Pflantze zu erlangen/sich bemühen muß/welche dan junge Absetzlinge zur Vermehrung machet.«
Außer als Kübelpflanze wurde die Echte Aloe vielfach als Topfpflanze auf Fensterbrettern gehalten. Die fleischigen Blätter dienten volksmedizinisch als schmerzstillendes und heilendes Hausmittel bei Brandwunden. Der wissenschaftliche Name der Pflanze, dessen Herkunft unklar ist (vielleicht aus dem Hebräischen), wurde im Volksmund vielfach zu »Alleweh« oder ähnlich umgestaltet.