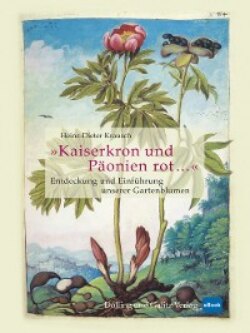Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAchillea L. Schafgarbe
Achillea ptarmica L. Gefüllte Sumpf-Schafgarbe, Clusius 1601
Von der auch in Mitteleuropa heimischen und an Wegrändern und auf trockenen Wiesen und Grasplätzen weitverbreiteten und seit altersher als blutstillende Heilpflanze genutzten Wiesen-Schafgarbe (A. millefolium L.) mit weißen Randblüten treten gelegentlich auch rosa oder rötlich blühende Pflanzen in Erscheinung, auch weisen einige auf Bergwiesen vorkommende Sippen, wie die subsp. sudetica (Op.) Weiss und A. roseoalba Ehrend., meist rosarote Blüten auf. Besonders farbintensive Exemplare haben wohl zunächst Bauern in ihre Gärten geholt, von wo aus sie sich dann weiter verbreiteten. Solche Millefolium terrestre purpureum, Purpurrote Schafgarbe, erscheint z.B. 1594 in Frankes Hortus Lusatiae. 1601 beschreibt sie Clusius in seiner Rariorum plantarum historia als Millefolium rubro colore, und 1613 finden wir sie im Hortus Eystettensis farbig abgebildet. Die Darstellung dieser »Roth Garben/oder Schaaf-Garben mit rothen Blumen« zeigt eine Form mit hellroten Randblüten. In der Folgezeit wurde sie dann vielfach »der schönen Farbe halber, als eine angenehme Spielart der gemeinen Schaafgarbe, in den Gärten unterhalten«, wie Johann Gottlieb Gleditsch 1773 schrieb. Hundert Jahre später empfahl man sie auch für die damals in Mode gekommenen Teppichbeete. Seit Ende des vorigen Jahrhunderts entstanden in den Staudengärtnereien durch Auslese verschiedene Farbsorten mit farbkräftigen, tief kirschroten oder karminroten Blüten und größerer Standfestigkeit, wie z.B. ‘Cerise Queen’ (‘Kirschkönigin’), ‘Sammetriese’ und ‘Kelway’.
Die ebenfalls in Mitteleuropa vorkommende, auf wechselfeuchten Wiesen wachsende und ehemals recht verbreitete, heute aber vielfach selten gewordene Sumpf-Schafgarbe (A. ptarmica L.) spielte früher vielerorts eine große Rolle im Volksglauben. So galt sie z.B. in Brandenburg unter dem Namen Dorant u.ä. als ein Hexen und Teufel abweisendes Kraut. Als Gartenpflanze trat sie aber erst in Erscheinung, als man Ende des 16. Jhs. in England eine gefülltblühende Form entdeckte und in Gartenkultur nahm. Unter dem Namen Ptarmica vulgaris, flore pleno wird sie 1601 von Clusius erwähnt. Zuerst noch selten – der Hortus Eystettensis 1613 zeigt lediglich die ungefüllte Wildform – erlangte die gefüllte Sumpf-Schafgarbe im Laufe des 17. Jhs. eine weite Verbreitung. So traf sie zwischen 1630 und 1651 im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem und 1646 im Botanischen Garten von Altdorf bei Nürnberg ein. 1663 wird sie in der Flora Marchica von Elsholtz unter dem 1623 von Caspar Bauhin geprägten Namen Dracunculus pratensis, flore pleno, »Wiesen-Dragune mit vollen Blumen«, auch für die fürstlich brandenburgischen Gärten in Berlin und Brandenburg verzeichnet. Von den Botanischen und den fürstlichen Gärten drang sie schließlich bis in die Bauerngärten vor und ist dort als Silberknöpfchen oder Hemdenknöpfchen bis heute eine beliebte Zierpflanze. Auch dieser Sippe haben sich die Staudenzüchter angenommen und mehrere Namensorten mit dichteren Blütenköpfen, verlängerter Blütezeit und strafferem oder kompakterem Wuchs entwickelt.
Die im Kaukasus und Kleinasien beheimatete Gold-Schafgarbe (A. filipendulina Lam.) war eine der ersten kaukasischen Pflanzen, die seit der Ende des 18. Jhs. verstärkt einsetzenden botanischen Erforschung dieses Gebietes nach West- und Mitteleuropa gelangten. Bereits 1803 wurde sie in England kultiviert, wahrscheinlich angezogen aus Samen, die Marschall von Bieberstein im Kaukasus gesammelt hatte und die über Moskau nach London gekommen waren. Marschall von Bieberstein nannte sie 1800 im Anhang seiner Beschreibung der Länder zwischen den Flüssen Terek und Kur am kaspischen Meere Achillea Eupatorium und führte sie auch 1808 in seiner Flora taurico-caucasica für den östlichen Kaukasus auf. Unter diesem Namen wuchs die schöne Pflanze 1808 auch schon im Botanischen Garten Berlin und drang von dort alsbald in andere Gärten vor. So läßt sie sich z.B. 1815 in Kunersdorf bei Wriezen, 1817 in Leipzig und 1824 in Frankfurt/Oder nachweisen, und Mitte des 19. Jhs. war die Gold-Schafgarbe in Deutschland dann schon weit verbreitet, wenn auch noch nicht überall häufig. Um 1820 stellte sich heraus, daß Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de Lamarck (1744–1829) die Art bereits 1783 nach von Tournefort gesammelten Pflanzen gültig beschrieben hatte, woraufhin fortan nur noch dieser wissenschaftliche Name verwendet wurde. Später zeigte es sich, daß sie mit der von Bieberstein aus Transkaukasien verzeichneten A. filicifolia identisch ist, welche bereits 1728 von Johann Christian Buxbaum (1693–1730) im 2. Band seines Werkes über die wenig bekannten Pflanzen des Orients als Ptarmica orientalis foliis Tanaceti incanis, flore aureo beschrieben und abgebildet, aber damals noch nicht als Gartenpflanze eingeführt worden war.