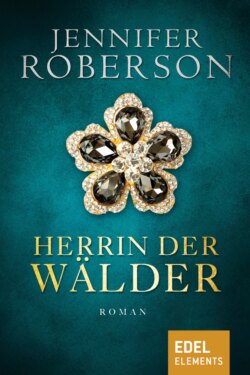Читать книгу Herrin der Wälder - Jennifer Roberson - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9. Kapitel
ОглавлениеPrinz John lächelte gemessen, während Kammerdiener damit beschäftigt waren, ihn anzukleiden. Gisbourne zählte drei Männer, die ihren leichtgebauten Herrn gewandt mit Bliaut, Hose, schultergepolstertem Obergewand, Gürtel, Stiefeln und unzähligen Schmuckstücken zurechtmachten.
»Ach«, sagte der Count. »Ich hoffte sehr, daß Ihr kommen würdet.«
Er wirkte gar nicht wie ein König, dachte Gisbourne. Wenn man einmal von seiner prachtvollen Kleidung absah, wirkte er auch nicht wie ein Prinz. Er war schmächtig, hatte dunkle Haare, dunkle Augen und dunkle Hautfarbe. Seine Nase war ein wenig zu lang, und seine Schultern waren unter der sorgfältigen Wattierung nicht breiter als seine schmalen Hüften.
Er sieht wie ein Vogel aus, mit Schnabel und allem Drum und Dran.
»Ich ließ Euch hierherbestellen, weil es etwas gibt, was ich Euch fragen muß. Es betrifft Euren Herrn«, sagte John unbewegt. »Wie Ihr wißt, ist es meine Aufgabe, das Reich meines Bruders zu verwalten, während der König im Gefängnis sitzt.«
Es folgte eine eigentümliche Pause. Gisbourne beeilte sich, das in der Schwebe hängende, erwartungsvolle Schweigen zu füllen. »Ja, Mylord.«
»Deshalb muß ich Maßnahmen ergreifen, die das Wohlergehen aller Grafschaften garantieren – nein, nicht den, du Blödmann .. . den da!« John nahm einem der Kammerdiener einen Ring weg und steckte ihn sich auf einen Finger. Er begutachtete seine Wahl, dann nickte er und wandte seine Aufmerksamkeit wieder Gisbourne zu. »Ich nehme an, Ihr kennt William deLacey am besten, Sir Guy?«
Feuchtigkeit befleckte die Ärmel von Gisbournes Unterhemd. Er verfluchte seine Nervosität. »Mylord, es sollte so sein – ich bin sein Kämmerer und in seine Geschäfte eingeweiht..
»Er ist ein bescheidener Mensch, Euer Sheriff, wie es sich für einen Mann von Anstand geziemt – Wir möchten, daß er mit seinem Amt zufrieden ist, so daß er Uns weiterhin so gut dienen mag.« Gisbourne entging der Wechsel zum königlichen »Wir« nicht.
»Deshalb sind Wir bemüht, das wahre Streben Unserer treuesten Untergebenen herauszufinden, damit Wir sie dementsprechend belohnen können.« Seine dunklen Augen funkelten, als er Gisbourne kurz anblickte. »Gibt es etwas, was er mehr begehrt als alles andere? Etwas, was ihm zu gewähren in Unserer Macht steht?«
Gisbourne dachte angestrengt nach. Er wußte, daß deLacey nach Macht und Aufstieg trachtete, aber das tat schließlich jeder. Was das anging, tat er selbst das auch; was sollte er jedoch Prinz John erzählen?
Hastig wischte sich Gisbourne die feuchten Schweißperlen von der Oberlippe und entschied sich für das erstbeste. »Seine Tochter, Mylord.«
John zog die Augenbrauen fragend hoch.
»Seine Tochter«, wiederholte Gisbourne, »möchte er mit Huntingtons Sohn vermählt sehen.«
»Eine treffliche, wenn auch ehrgeizige Verbindung.« John äußerte sich zurückhaltend. »Der Earl ist ein mächtiger Mann. Er könnte sich nach einer besseren Partie umsehen. Er ist ein Huntington.« John lächelte flüchtig. »Und der Sheriff könnte sich nach einem Mann niedrigeren Ranges umsehen, nach einem treuen Kämmerer. Der immerhin Ritter ist und dem eine gewisse Achtung zukommt.«
Das war eine Feststellung. Gisbourne sagte nichts. Es war nicht an ihm, das zu entscheiden. Doch der so plötzlich geborene Einfall verwandelte sich vor seinem inneren Auge in eine Möglichkeit und in ein blühendes Versprechen. Wenn er vorhat, mir eine Frau zu geben...
John schüttelte die Hände seiner Diener ab und entließ sie mit einer Handbewegung. »Es gebührt Euch Unsere Dankbarkeit«, sagte er aufgeräumt. »Es muß etwas geben, wie Wir Eure Treue belohnen können ...«
Gisbourne holte tief Luft. »Mylord – wenn ich bitten dürfte –«
John schnitt ihm mit einer Geste der ringüberladenen Hand das Wort ab. »Ich erkläre hiermit, daß Euch heute der erste Stoß gehört, wenn die Jäger den Keiler herausgejagt haben.«
Gisbourne hatte mehr gewollt. Er hatte auf mehr gehofft – auf die Frau, deren Namen er nicht kannte, aber deren Gesicht seine Träume füllte. »Danke, Mylord. Mylord –« Doch Englands Retter war verschwunden, und mit ihm Gisbournes Hoffnungen.
»Keiler?« Dem Weidmann blieb fast der Mund offenstehen. »Aber – es ist Frühling!«
Der Earl machte ein verächtliches Gesicht. »Wäre es möglich, würde unser geehrter Count wahrscheinlich auch die Jahreszeit ändern lassen.«
»Laßt es einen Hirsch sein«, schlug der Jäger Dickon vor. »Es gibt gerade viele –«
»Er sagte Keiler.«
Der Jäger gab nach. »Ja, Mylord. Keiler. Aber –« Er gestikulierte hilflos. »Wenn es keinen Keiler gibt?«
»Wir werden in den Feldern frühstücken ... ich werde zusehen, daß die Küche das Essen so lange wie möglich hinauszögert, und dann werde ich mein Bestes tun, daß sich die Mahlzeit so lange wie möglich hinauszieht. Aber wenn keine List erfolgreich ist ...« Huntington seufzte schwer und warf einen finsteren Blick über die Schulter. »Dann hetzt jeden Hirsch, den Ihr finden könnt, und treibt ihn auf uns zu. Eine wahre Flut an Hirschen.« Ohne große Überzeugung setzte er hinzu: »Und wenn wir Glück haben, wird vielleicht ein wohlgesetzter Huf uns – und England – unseres gemeinsamen Problems entledigen, bevor es uns ausbluten kann.«
Der Weidmann lächelte, dann verbarg er sein Lächeln hinter der Hand. »Das sind verräterische Gedanken, Mylord.«
Huntingtons Lächeln war eisig. »Auch nicht mehr als Johns Versuch, seinem Bruder die Krone zu entreißen.«
Es versprach ein schöner Tag zu werden. Marian verwandte jedoch nur wenig Aufmerksamkeit auf den Himmel und das Wetter. Statt dessen dachte sie darüber nach, wie sie sich inmitten der Vorbereitungen am besten die Pferde bringen lassen sollte, ohne an der Jagd teilnehmen zu müssen.
Die fette, keuchende Matilda zeigte auf etwas. »Da. Seht Ihr? Der Earl.«
Marian folgte dem Zeigefinger mit ihrem Blick.
»Beschäftigt«, sagte sie und wich geschickt einer Gruppe von Gästen aus. »Erwartest du etwa, daß ich einfach zu ihm gehe und sein Gespräch unterbreche?«
»Ihr seid eine Ritterstochter, mein Mädchen – keine gewöhnliche Küchenmagd.«
»Du vergißt ...« Marian schlängelte sich durch die Menge. Sie wünschte, sie hätte länger gewartet. »Für den Earl of Huntington bin ich nicht viel mehr. Warum ist es denn so wichtig? Kann ich nicht einfach gehen?«
Matilda, der es unter ihrem grauen Wollstoff warm war, machte halt, wischte sich übers Kinn und sah ihrer Herrin ins Gesicht. Tränen glitzerten in Marians Augen, aber sie flossen nicht. Matilda wußte, daß Marian es haßte zu weinen.
»Euer Vater wollte, daß ich in seiner Abwesenheit für Euch Sorge trage. Und nun, da er tot ist –« Überraschend wurden auch in Matildas Augen Tränen sichtbar. Ihre Stimme war belegt. »Ich möchte es richtig machen.«
»Das hast du«, sagte Marian. »Und das wirst du. Aber wenn wir jetzt gehen, ohne den Earl zu stören, wird es uns in kein schlechtes Licht rücken. Dazu ist es nicht wichtig genug.«
»Jetzt gehen? Aber warum denn?« Eine Hand glitt unter Marians Ellbogen. »Bitte, meine Lady, verlaßt mich nicht. Der ganze Tag wäre mir verdorben.«
William deLaceys Griff war sanft, aber Marian trat dennoch zur Seite und befreite ihren Arm mit einer gemurmelten Bemerkung. »All diese Leute ...« Sie suchte nach einer Entschuldigung. »Das vergangene Jahr brachte ich durch meine Trauer in Zurückgezogenheit – ich fühle mich in solch großen Menschenmengen unbehaglich.«
»Und deshalb lauft Ihr weg? Die Tochter von Hugh FitzWalter?« DeLacey schüttelte seinen Kopf. Das Morgenlicht fiel auf die Spuren von Silber in seinem gewellten, braunen Haar. »Das sieht dem tapferen Mädchen, das ich kenne, aber gar nicht ähnlich.«
»Genau das habe ich ihr auch gesagt.« Matilda ignorierte Marians scharfen Blick.
»Dann sind wir uns ja völlig einig.« DeLacey lächelte unbekümmert. »Wenn ich verspräche, mich um sie zu kümmern, würdest du sie dann meiner Obhut überlassen, Matilda?«
Die alte Amme machte einen unbeholfenen Knicks. »Selbstverständlich, Mylord. Und ich muß sogar zugeben, daß ich nichts dagegen habe, in der Zwischenzeit meine alten Knochen auszuruhen.«
»Warte –« Marian streckte ihre Hand aus, aber deLacey hielt sie schon wieder am Arm und zog sie mit sich.
Marian öffnete ihren Mund, um deLacey anzufahren. Der Sheriff geleitete sie jedoch flink durch die Menge und machte keine Anstalten, ihr seine Aufmerksamkeit zu widmen, bis sie in der Nähe der inneren Mauer standen, am Tor, das hinaus in die Vorburg führte. »Vergebt mir«, murmelte er. »Ich verspürte nicht den Wunsch, meinen Tag Eurer Schönheit zu berauben.«
»Hört auf«, sagte Marian.
Er lachte. »Bin ich durchschaut? Seid Ihr meines Werbens müde?«
DeLacey war plötzlich auf der Hut: wie ein Hund, der eine neue – und möglicherweise gefährliche – Witterung aufnimmt. »Was möchtet Ihr, daß ich Euch sage?«
»Die Wahrheit.« Daß Ihr sehr wohl wißt, daß mein Vater wollte, daß wir heiraten. Aber sie traute sich nicht, eine Andeutung zu machen, falls er es nicht wüßte.
»Die Wahrheit ist für einen Mann, wie ich es bin, schwierig.« DeLacey hatte ihr Ansinnen nicht weiter erschüttert, und er war nicht mehr bereit, das Spiel zu beenden, als sie es war, es überhaupt zu spielen. Er änderte einfach die Regeln. »Aber hier ist sie, schnörkellos und unumwunden: Ich hätte gern, daß Ihr mir auf der Jagd heute Gesellschaft leistet.« Er machte eine Pause. »Ist das denn zuviel verlangt?«
Sie war gezwungen zuzugeben, daß es das nicht war.
Plötzlich trat ein neuer Ausdruck in deLaceys Gesicht. Suchend schaute sich Marian um und entdeckte in ihrer Nähe Prinz John, der von einem unruhig tänzelnden Pferd auf sie herabblickte. Hastig senkte sie den Blick und stierte auf das Kopfsteinpflaster des Hofes. Laß ihn weggehen – laß ihn mich nicht wahrnehmen – laß ihn etwas anderes wollen.
Wundersamerweise tat er das. »Lord Sheriff«, sagte John, »wollt Ihr mich begleiten?« Er machte eine ungeduldige, gebieterische Handbewegung. »Wenn Ihr so liebenswürdig sein wollt. Einige Männer würden es als Ehre betrachten.«
Die meisten Männer würden das. »Natürlich, Mylord. Sofort.« DeLacey neigte den Kopf und warf Marian verstohlen einen Blick zu. Leise versprach er ihr: »Das wird nicht den ganzen Tag dauern. Ich werde Euch später treffen.«
Sie sagte nichts. Sie war sich noch immer Johns Blick bewußt und hielt ihren Kopf weiter gesenkt. Sie zählte die endlosen Momente, bis deLacey sich umdrehte und, sein Pferd verlangend, davonging.
Ein Stallknecht kam und fragte sie, ob sie ihr Pferd wünsche, dann brachte er es ihr. Marian dankte ihm und hieß ihn zu gehen. Ruhig hielt sie das Pferd am Zügel, während die letzten Grüppchen gesattelter Gäste eilig auszogen, um die anderen einzuholen. Ich danke dir, Gott.
Hinter ihr klapperten Hufe. »Marian von Ravenskeep!« Es war Eleanor deLacey, die sich ihr eilig näherte. »Ich bin spät dran – viel zu spät... reitet mit mir, wollt Ihr? Bevor er jemanden nach mir schicken läßt.«
»Aber ich war...« Marian beendete den Satz nicht. Eleanor hatte sichtlich nicht die Absicht, auf die Begleitung einer Frau zu verzichten, die sie anstandshalber brauchte. Marians heimlicher Fluchtversuch war schmachvoll gescheitert. »Natürlich«, sagte sie resigniert.
»Gut.« Eleanor beugte sich vor und gab Marians Pferd einen Klaps. »Also los!«