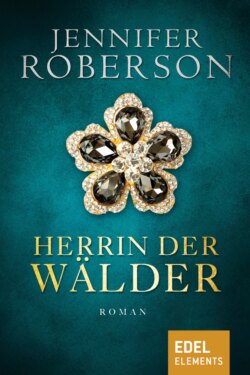Читать книгу Herrin der Wälder - Jennifer Roberson - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12. Kapitel
ОглавлениеEine Hand schloß sich fest um ihre Schulter und riß Marian aus ihrer Versunkenheit. »Kommt«, sagte der Sheriff ruhig und zog sie mit sich. »Es gibt keinen Grund, warum Ihr bei ihm bleiben müßtet. Der Wagen wird ihn zur Burg zurückbringen.«
»Vielleicht könnte ich ihm beistehen ... ihn irgendwie beruhigen –« Sie hatte das Gefühl, das wäre wichtig, so als sei sie schuld an allem.
»Wie denn? Und warum? Es verbindet Euch nichts mit ihm.« DeLacey faßte sie an beiden Schultern und führte sie unbekümmert von der Menge weg, die um Gisbourne herumstand. »Was könnt Ihr ihm schon Gutes tun?«
»Es verbindet mich nichts mit ihm? Aber ja doch – er hat den Keiler schließlich meinetwegen angegriffen –«
Er lachte leise. »Ich glaube nicht. Sicher nicht. Ich denke, er fühlte sich durch die anderen dazu herausgefordert ... Ich gestehe Euch etwas, Marian. Männer tun die unglaublichsten Dinge, wenn es um ihren Stolz geht ... und Gisbourne ist kein gewöhnlicher Ritter.«
Ihr Schock wich der Wut. Vielleicht hat Eleanor recht – er ist härter, als ich dachte. Marian hob ruckartig beide Schultern und schüttelte seine Hände ab, um sich zu ihm umzudrehen. »Ein ungewöhnlicher Ritter, Sheriff? Ungewöhnlich tapfer wohl doch, oder nicht?«
Sie sah, wie sich die Falten in seinem Gesicht vertieften und die braunen Augen strenger wurden. »Er ist mein Kämmerer. Ein fähiger Mann überdies – was die Führung meines Haushaltes betrifft. Aber er ist nicht tapfer.«
»Was, wenn er nun stirbt?«
»Wenn Gott unsere Gebete erhört, wird er das nicht.«
»Wollt Ihr denn nicht mit ihm zur Burg zurückkehren?«
»Aber natürlich. Gerade eben wird mein Pferd gebracht und Eures. Nahmt Ihr etwa an, ich wollte mit Euch im Wald verschwinden?« Der Sheriff lachte. »Nein, Marian. Ich möchte, daß wir ihn beide zur Burg begleiten. Die Jagd ist vorüber. Und nun gestattet mir, daß ich Euch in den Sattel helfe ...«
»Mylord Sheriff –« Sie wollte ihm sagen, daß er sich ihr gegenüber zuviel herausnahm, daß er nicht das Recht hatte, sie herumzukommandieren, sie hier- oder dorthin zu schubsen, als wäre sie seine Frau oder eine Bedienstete.
Aber sie brachte es nicht heraus. Sie blickte am Sheriff vorbei und erkannte Robert von Locksley, der zusammen mit dem Earl auf die Lichtung getreten war.
Seine Kleidung war ganz durchweicht. Sein schlohweißes Haar hing ihm, mit rötlichen Fetzen durchsetzt, lang auf die Schultern herab. Sein Gesicht hatte er zwar mit einem Unterarm abgewischt, doch er sah immer noch blutbesudelt und barbarisch aus.
Während sich der Earl mit jemandem unterhielt, bemerkte Locksley ihren Blick. Wie gelähmt starrte er sie einen lang anhaltenden Moment an – und dann wurde das Gesicht unter den Blutschlieren leichenblaß.
Alan saß stirnrunzelnd über die Laute gebeugt und nahm keine Notiz von den Bediensteten um ihn herum, die schmutzige Binsen hinaustrugen und sie durch frische ersetzten. Saubere Tücher wurden auf den Tischen ausgebreitet und das Silber geputzt. Zweimal hatte Alan bereits seinen Platz räumen müssen, worauf er entrüstet gemurrt hatte. Nun saß er auf einem einfachen Stuhl, der neben dem Sessel stand, welcher dem Earl vorbehalten war.
»Alain!« Sein Name hallte durch den Saal.
Den Kopf noch immer voller Noten, blickte er hoch und sah sie auf ihn zueilen, ihr langes Gewand und den Umhang gerafft, damit sie die Kleider beim Laufen nicht behinderten.
Sie warf sich, ohne zu beachten, daß er die Laute in einer Hand hielt, in seine Arme und verschloß seinen Mund mit dem ihrigen.
»Schönste Eleanor«, sagte er keuchend, als sie seinen Mund schließlich wieder freigab. »Ich – hatte dich nicht so schnell zurück erwartet.«
Eleanor kicherte heiser, während sie sich bereits an der Kordel seiner Hose zu schaffen machte. »Nichts kann mich aufhalten, wenn ich solche Lust habe.«
Er hielt ihre Hand fest. »Nicht hier, ich bitte dich –«
Sie war ungeduldig, was ihn einst vielleicht erregt haben mochte. »Dann in einem Zimmer, aber beeil dich. Wir haben zwar Zeit, aber auch nicht wieder so viel, daß ich auch nur einen Augenblick davon ungenutzt verstreichen lassen möchte.«
In der Nacht zuvor hatte er es selbst gewollt. Er hatte sie genommen, weil ihn ihre Lust erregt hatte. Jetzt hatte sie ihren Reiz verloren. Es gab neue Musik zu entdecken; sie kannte er nun schon. »Eleanor –«
»Ein Zimmer«, drängte sie ihn. »Oder ich verführe dich hier an Ort und Stelle.«
Das erregte ihn, machte sie anziehender. Doch er wußte es besser. Soviel würden sie nicht riskieren. Nicht beim zweiten Mal; beim ersten Mal war das etwas anderes. Gefahr bei der ersten Begegnung machte den Beischlaf nur um so aufregender.
Nicht hier also. Er wußte jedoch, daß sie nicht lockerlassen würde. Deshalb lachte Alan, küßte Eleanor und brachte sie und seine Laute in das erstbeste Zimmer in der Nähe des Halleneingangs. Es war ein kleiner, abgeschiedener Raum. Es ermangelte eines Bettes, aber das machte nichts. Der Boden würde es genauso tun.
Es war schiefgegangen, wußte deLacey. Er war ein Mann, der sich auf Nuancen verstand, der Veränderungen im Klang einer Stimme oder im Ausdruck eines Gesichts deuten konnte. Instinktiv merkte er, daß er Marian nicht richtig behandelt hatte. Sie war nicht Eleanor, die man hier- und dorthin befehligen konnte, weil es der einzige Weg war, sie zu beherrschen. Sie war Marian und weit mehr Zeit und Mühe wert. Es war ein Fehler gewesen, wenn auch nicht gänzlich seine Schuld. Das Zusammentreffen mit Prinz John hatte ihn tief erschüttert, und das allein beunruhigte ihn schon. Er war es gewohnt, selbst unangenehmen Überraschungen mit Ruhe und Selbstbeherrschung zu begegnen.
Mit John war es jedoch etwas anderes. John war gefährlich. Er wagte es nicht, ein falsches Spiel mit dem Prinzen zu spielen, sonst hätte er sein Leben sicher verwirkt; auf der anderen Seite war sein Leben jedoch im Falle, daß Prinz Johns Versuch, England zu regieren, fehlschlug und König Richard freigekauft wurde, ebenfalls keinen Penny mehr wert. Mit John würde auch er fallen. Wenn er allerdings John half, und John würde König ...?
Ein Frösteln lief über seinen Rücken. Gedanken dieser Art waren Hochverrat. Er dachte besser an etwas anderes.
Er riskierte einen Seitenblick. Marian hielt ihren Kopf gesenkt, ihr makelloses Profil wirkte nachdenklich. Ohne Zweifel fand sie ihn zu hart, zu herrisch, und er konnte ihr daraus keinen Vorwurf machen. Er wollte, daß sie aus freien Stücken in sein Bett käme; er wollte ihre Achtung gewinnen, falls das möglich war. Keine andere Frau war ihm je wichtig gewesen, nicht einmal seine ersten beiden Gemahlinnen. Sie hatten ihn eine Weile unterhalten, ihm sogar Kinder geschenkt – Töchter! – und seinen Aufstieg unterstützt. Aber sie hatten ihn nicht geliebt, und er hatte sie nicht geliebt. Die Ehen waren zweckdienlich gewesen, mehr nicht. Und obgleich auch diese Ehe ihm materiellen Nutzen bringen würde, war Profit nicht der einzige Grund, warum er FitzWalters Tochter wollte. Nein, er wollte das Mädchen selbst.
Innerlich staunte er. Er hatte mit angesehen, wie sie herangewachsen war. Sie war ein reizloses, lebhaftes und unbeholfenes Mädchen gewesen, das nur aus linkischen Gliedmaßen und verfilztem Haar bestanden hatte. FitzWalter hatte ihr nach dem Tode ihrer Mutter zu viele Freiheiten gelassen. Sie hatte sich immer wie ein Junge benommen anstatt wie eine heranwachsende Dame. Das hatte sich jedoch im vergangenen Jahr geändert. Die Trauer war die Schwelle zum Erwachsenenalter gewesen.
Sie war exquisit. Er konnte sich kein besseres Wort für sie vorstellen. Und er konnte sich keinen besseren Mann für sie vorstellen als ihn, der ihr das Leben bieten konnte, das sie verdiente.
Und der sie lehren konnte, wofür Körper da waren.
Locksley ritt auf Gisbournes Pferd, da sein eigenes tot war. Das trocknende Blut war klebrig. Wie ein Leichentuch haftete der Geruch an ihm und füllte seinen Kopf mit unerwünschten Erinnerungen.
Genauso unerwünscht war die Erinnerung an den Ausdruck auf Marian FitzWalters Gesicht, als er ihr die Botschaft ihres Vaters bezüglich William deLacey überbracht hatte.
Oder daran, als sie gesehen hatte, wie er den Keiler zerstückelt hatte.
Er hatte ihn nur töten wollen. Er hatte nur vorgehabt, ihn zu töten, bevor er mehr Schaden anrichten konnte.
Und dann war sie da gewesen und hatte ihm nur eine Möglichkeit gelassen.
Er hatte nicht die Absicht gehabt, überhaupt auf die Jagd zu gehen. Er war nur ausgeritten, weil sein Vater es erwartet, es befohlen hatte, und er war noch nicht in der Verfassung, sich den Wünschen seines Vaters zu widersetzen. Es war immer das Einfachste, nachzugeben. Das hatte ihn die Gefangenschaft gelehrt.
Er war erschöpft. Und ausgelaugt. Schon seit Monaten war er müde, seit über einem Jahr. Müde hatten sie ihn gemacht, ihn geistig ermatten lassen – Saladins Männer, aber auch die anderen. Selbst Männer seines eigenen Volkes.
Sie hatte gerufen, er solle sich in acht nehmen, als sein Pferd verletzt worden und zu Boden gegangen war. »Seid vorsichtig!« hatte sie gerufen. »O Mylord, paßt auf!« Danach jedoch nichts mehr. Denn zusammen mit dem Brüllen seines Pferdes in seinem Kopf und dem Gestank nach Blut in seiner Nase war das, was er tötete, kein Keiler mehr. Und er war kein Mann mehr, sondern bestand nur noch aus Körper, Geist und Seele, die in dem entsetzlichen Schmelztiegel eines heiligen Wahns neu zusammengeschmolzen und auf dem Amboß des Krieges geschmiedet worden waren.
Er wollte dem Mädchen mitteilen, wie ihr Vater gestorben war, damit er nicht länger allein wäre.
Er hatte das Wildschwein benutzt, um es ihr zu zeigen. Aber er wußte, daß er es ihr nie würde sagen können.
Eleanor umklammerte die Hinterbacken des Minnesängers und grub ihre Fingernägel in sein nacktes Fleisch. Es war nicht genug, nicht genug...
Sie beschimpfte ihn, dann ließ sie das gestraffte Fleisch los und griff nach seinem Haar. Sie bog ihre Hüften vom Boden weg, um mehr von ihm zu bekommen. Sie hörte, wie er keuchte und etwas gegen ihren Hals und ihre Brüste murmelte, aber seine Worte waren ihr unwichtig. Sie wollte mehr von ihm.
»Wo ist deine Lanze?« fragte sie schwer atmend. »Wo ist dein Schwert, mon petit? Wo versteckst du dich?«
Alan redete wirr vor sich hin.
»Halte nichts zurück«, befahl sie. »Gib mir alles –«
Er gab ihr, soviel er konnte.
» –mir –«, schrie Eleanor.
In dem Moment wurde die Tür zur Kammer aufgestoßen.
Energisch gestikulierend, zeigte der Earl den Weg in die Halle und zu der Tür an, die sich direkt beim Eingang befand. »Diese Tür – dort. Schafft ihn hinein und legt ihn ab ... du da – mach die Tür auf!«
Die Tür wurde entriegelt und aufgeschoben, und die Männer trugen Gisbourne auf den Schultern in die Kammer. Hinter ihnen kamen der Earl, sein Sohn, der Sheriff... und Prinz John, der, obwohl er gerade eben erst selbst angekommen war, übellaunig nach mehr Wein verlangte.
»Hier herüber«, befahl der Earl und deutete auf eine Ecke. Und dann rief er schockiert aus: »Mein Gott –«
Abgesehen von Gisbournes Schmerzstöhnen war es völlig still im Zimmer.
Eleanor deLacey, die mit wenig mehr bekleidet war als ihrem wirr hängenden Haar, brach in lautes Schluchzen aus. »Er hat mich vergewaltigt!« schrie sie, während sie sich auf den Knien zusammenkauerte. Dann deutete sie auf eine verfärbte Stelle ihrer haarbedeckten Brust. »Seht Ihr, was er mir angetan hat?«
Alan, der kraftlos an der Wand stand, öffnete seinen Mund, um ihr zu widersprechen, um die gejammerten Worte abzustreiten. Als der Sheriff jedoch mit weißem Gesicht und dunklen Augen auf ihn zutrat, wußte er, daß ihn dieses Mal seine flinke Zunge nicht retten würde.
»Verdammtes Miststück«, murmelte er, bevor der Faustschlag seine Lippen aufriß.
William deLacey suchte Zuflucht in der Einsamkeit, in der Dunkelheit erneuter Dämmerung, der düsteren Stimmung schwachen Kerzenscheins. Seinen Zorn hatte er abgelassen, seine Wut war verraucht.
»Eleanor«, murmelte er und ließ sich in den einzigen Stuhl fallen.
Das Zimmer war klein und sehr intim; der Earl hatte es, ohne ein Wort darüber zu verlieren, für angebracht gehalten, ihm dort eine Zeitlang Ruhe zu gönnen, bevor er wieder allen anderen gegenübertreten und die ersten wilden Gerüchte ertragen mußte, zu der die Szene bald Anlaß geben würde.
Es klopfte. Augenblicklich war er wütend, erzürnt darüber, daß jemand es wagte, ihn gerade jetzt aufzusuchen, da er Befehl gegeben hatte, nicht gestört zu werden. Die Wut ließ jedoch nach. Er war zu erschöpft und ausgelaugt.
»Lord Sheriff?« Die Stimme eines Dienstboten. »Lady Marian möchte Euch sprechen.«
Marian? Hier? Und jetzt? Er ging zur Tür und entriegelte sie.
Es war tatsächlich Marian – hier und jetzt und ohne ihre Amme. In der Dunkelheit waren ihre schwarzen Pupillen riesig, umschlossen von blauer Iris. Das Licht der Öllampen und Kerzenständer im Korridor beleuchtete sie gnadenlos, aber das tat ihr keinen Abbruch. Ruhig stand sie vor ihm, die Hände über ihrem Rock gefaltet, über dem bestickten Gürtel, den sie sich zweimal um die schmale Taille geschlungen hatte.
Ihr Besuch war höchst unschicklich, aber er tadelte sie nicht dafür. Sie raubte ihm den Atem.
DeLacey trat zur Seite. Es kostete ihn einige Mühe, zu sprechen, ohne etwas von seinen Gedanken preiszugeben. »Möchtet Ihr nicht eintreten?«
Sie schüttelte den Kopf.
DeLacey warf einen raschen Blick auf den Bediensteten, der mit abgewandtem Blick dastand. »Kommt herein«, erklärte er ihr ruhig. »Wenn es Euch kümmerte, was die Leute denken, hättet Ihr Eure Dienerin mitgebracht.«
Dieser Seitenhieb erzielte die beabsichtigte Wirkung. Er sah das bestätigende Flackern in ihren Augen. Sie trat ein, und er schloß die Tür hinter ihr.
»Wein?«
Wieder schüttelte sie den Kopf. Sie fühlte sich sichtlich unwohl, war aber entschlossen zu sagen, weswegen sie hergekommen war. Das verriet ihm einiges.
Er verwendete es, wie üblich, zu seinem Vorteil. »Ihr seid Eures Vaters Tochter, und Euer Herz ist vorhersehbar. Ihr seid gekommen, um Euch für den Minnesänger einzusetzen.«
Röte breitete sich auf ihren feinen Wangenknochen aus. »Was über das Urteil gesagt wird – ist nicht wahr, oder?«
»Es steht in meiner Macht.«
Offensichtlich schenkte sie dem Gerücht keinen Glauben. Sie hatte nicht ernsthaft geglaubt, daß er ein derartiges Urteil aussprechen würde. Es berührte ihn, wenn auch nur sehr kurz, daß sie ihn für einen anderen Mann halten konnte als für den, der er war. Ein Jammer, dachte er, daß ich sie eines Besseren belehren muß.
Marian holte Luft. »Aber –«
»Aber.« Er ließ sie nicht aussprechen, lächelte nur kurz. »Was soll ich Eurer Meinung nach denn tun? Ich bin der Lord High Sheriff... und die Frau ist meine Tochter.«
Er wartete, ließ ihr Zeit, die Tatsachen zu begreifen. Und das versuchte sie auch. Einen Augenblick lang sah sie ihn nur an und wägte seine Worte, seinen Tonfall und seinen Gesichtsausdruck ab. Er, der wußte, wie man andere anhand solcher Details beurteilte, sah, daß sie es ebenfalls tat, wenn auch mehr instinktiv als mit bewußter Hinterlist.
Die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Ihre Hände griffen nach dem Gürtel, als könnte er ihr Kraft geben. »Mylord ...« Er sah, wie ihr Kinn zuckte, sah die sanfte Furche quer über ihren Augenbrauen und sah, wie sich ihre Schultern fast unmerklich anspannten. Ruhig und betont sagte sie, was niemand anderes gewagt hätte. »Ihr habt keinen Grund dazu.«
»Ah.« Er wollte lächeln, lachen und ihr sagen, daß er sehr wohl wußte, was sie meinte, und daß er wußte, wieviel es sie gekostet hatte, es so offen auszusprechen. Sie war anständig und weichherzig und zauderte selbst, einen Mann zu verletzen, dessen Verhalten sie nun, neugierig hinsichtlich seiner Absicht, in Frage stellte. Er würde sich jedoch nicht abbringen lassen. Sie hatte noch keine Vorstellung davon, wie die Welt wirklich aussah. »Meine Tochter behauptet aber etwas anderes.«
Sie umging es. Sie würde Eleanor nicht des Lügens bezichtigen. Statt dessen setzte sie auf eine andere Anklage, darauf, das Urteil selbst anzuzweifeln. »Was Ihr vorhabt, ist barbarisch.«
Er zuckte leicht mit den Schultern. »Es steht in meiner Macht.«
Leidenschaft loderte auf, und die Röte stieg ihr ins Gesicht. »Das macht es noch lange nicht richtig!«
DeLacey nippte an seinem Wein. »Der Minnesänger kann sich glücklich schätzen, daß ich ihm nicht mehr nehme als seine Zunge.«
»Mylord –« Sie biß die Zähne zusammen. »Er verliert mehr als Eure Tochter.«
»Ah.« Sein Griff um den Kelch wurde fester. »Seid aufrichtig mit mir, Marian – sagt, was zu sagen Ihr gekommen seid.«
»Ich –« Doch sie konnte es nicht. »Ihr kennt die Wahrheit bereits.«
»Wirklich?« Er lächelte. »Um des Gesprächs willen stimme ich zu. Aber tretet nicht vor mich hin, von rechtschaffener Entrüstung erregt, und behauptet, sie verlor nichts.«
»Eleanor verlor nicht mehr, als sie bereitwillig gab –«
Er schnitt ihr das Wort ab. »Das meine ich nicht. Das hat sie schon vor langer Zeit verloren. Ich spreche von etwas anderem. Ich spreche von ihrer Zukunft.« Wut flackerte erneut in ihm auf. »Ich spreche von Sicherheit und Wohlstand und Rang und Privilegien.«
»All die Dinge, die Ihr wollt!«
Die Anklage hallte im Raum wider. Einen kurzen Moment lang überraschte und verblüffte es ihn, daß sie ihn derart herausforderte, aber dann überwog der Ärger darüber. Sie verstand es nicht. Sie konnte es nicht verstehen. Darum würde er sich bemühen, es ihr so zu erklären, daß sie es begreifen konnte.
Er schleuderte den Becher zur Seite, und Wein spritzte durch das Zimmer. Es ließ sie auf der Stelle verstummen. »Verlangt Ihr etwa, daß ich sie vor allen hier in der Burg eine Lügnerin nenne?« Er machte einen Schritt auf sie zu. »Verlangt Ihr, daß ich bekanntgebe, daß sie ihre Ehre bereits zu einem früheren Zeitpunkt verlor?« Er machte noch einen Schritt. »Verlangt Ihr, daß ich meine eigene Tochter um eines fahrenden Sängers willen ruiniere?«
Er stand dicht vor ihr. Er zitterte jetzt vor Wut, vor unterdrückter Demütigung. Er hatte zugesagt, seinem König untreu zu werden, um die Zukunft seiner Tochter zu befördern, auf daß seine eigene gesichert wäre, und Prinz John war um seiner eigenen Vorteile wegen damit einverstanden gewesen. Ihm war es gleichgültig, daß der Preis, den er deLacey versprochen hatte, nicht mehr zu zahlen war.
Das Bett, das ich mir bereitet habe, gefällt mir nicht mehr. Verzweiflung und Hilflosigkeit nahmen von seiner Seele Besitz. Und in diesem Moment ließ er Marian gegen seinen Willen sehen, wer er war. Er ließ sie sehen, daß er, obgleich er sehr wohl wußte, was seine Tochter getan hatte, nicht zustimmen konnte und nicht zustimmen würde, das über den Minnesänger verhängte Urteil aufzuheben.
»Wenn es dabei um Stolz geht –«, begann sie.
Er faßte sie hart bei den Schultern, erschreckte sie mit seiner Wucht. »Um Stolz und viel, viel mehr! Wißt Ihr, was sie getan hat? Sie hat mich Huntingtons Sohn gekostet! Glaubt Ihr, er will sie jetzt noch haben? Glaubt Ihr, auch nur irgendein Mann von Stand möchte eine entehrte Frau heiraten?«
Marian gab nicht nach. »Ist das die Zunge eines Mannes wert?«
Er ließ sie so schnell los, daß sie taumelte. »Andere Väter würden sich bei mir bedanken. Sicherlich auch Euer Vater.«
»Mein Vater!«
»Was wäre denn, wenn Ihr es gewesen wärt? Was, wenn Ihr Euch durch seine Liebkosungen zu mehr hinreißen ließet, als Ihr bereit wart, ihm zu geben?«
»Ich würde niemals –«
»Eine Frau kann nicht sagen, was sie niemals tun würde.«
Das brachte sie gänzlich zum Schweigen.
DeLacey streckte seine Hand aus und berührte eine Strähne ihres Haars. »Das könnt Ihr nicht wissen«, sagte er ruhig. »Niemand kann das, bis es einem widerfährt. Bis man mit dem Moment selbst konfrontiert ist, mit der Entscheidung, die zu treffen ist, gleich, was das Richtige wäre. Ich behauptete nie, nett zu sein, denn im Amt des Sheriffs ist nur wenig Raum für Liebenswürdigkeiten ... aber ich bin konsequent.« Er ließ die Locke wieder hinabgleiten und legte seine Hand an ihre Wange. »Mein Amtssiegel verleiht mir die Macht über Leben und Tod«, flüsterte er heiser, »und alles, was ich tun muß, ist, es auf das Pergament zu drücken. Das, Marian, ist Macht. Aber Macht muß ihr Gleichgewicht haben. Macht muß genutzt werden. Macht muß zur Schau gestellt werden, damit die anderen ihren Wert kennenlernen.«
Ihr Gesicht war sehr bleich. »Ein abschreckendes Beispiel also.«
»Eine Lektion.« Er zog seine Hand weg. »Ihr könnt nur hoffen, daß er seine Lektion lernt, oder er wird mehr als nur seine Zunge verlieren.«
Verzweiflung entstellte ihr Gesicht. »Aber Ihr beraubt ihn seiner Zukunft!«
Sie konnte es nicht begreifen. DeLaceys Mund kräuselte sich. »So wie er meine Tochter der ihrigen beraubte.«
Sie starrte ihn ausdruckslos an, länger, als er ertragen konnte. Dann ging sie zur Tür und war verschwunden.
DeLacey verstand. Er wünschte nur, sie könnte es auch. »Vergebt mir«, murmelte er in das Dämmerlicht des Raums.