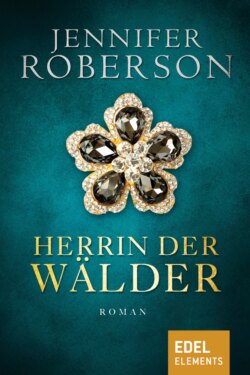Читать книгу Herrin der Wälder - Jennifer Roberson - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14. Kapitel
ОглавлениеKurz nach Tagesanbruch, als die anderen Frauen im Zimmer sich allmählich träge regten, legte sich Marian ihren Mantel über und hielt dem tadelnden Blick der alten Matilda stand. »Wir bleiben keinen Moment länger hier«, erklärte sie. »Ich habe getan, was ich konnte, um den Willen des Sheriffs zu ändern, aber er hört nicht auf mich. Auch seine Tochter nicht. Also gehen wir jetzt. Wir können unterwegs etwas zu uns nehmen.«
»Der Sheriff reitet heute selbst zurück nach Nottingham. Wir wären sicherer –«
»Wir sind sicher genug«, fiel ihr Marian mit fester Stimme ins Wort. »Die Straße nach Nottingham ist zu befahren, als daß Diebe große Aussicht auf Erfolg hätten.«
Wie immer appellierte Matilda an die Schicklichkeit. »Habt Ihr Euch vom Earl verabschiedet?«
Marian biß die Zähne aufeinander. Sie hatte weder die Zeit noch die Geduld, sich zu streiten, gleich wie löblich der Auslöser war.
»Wir gehen, Matilda!« Sie drehte sich auf dem Absatz um und marschierte, ihre Röcke und ihren Umhang raffend, auf die Tür zu. Die alte Amme, die am Morgen steif und langsam war, folgte ihr etwas bedächtiger.
Noch bevor sie die Tür erreichten, wurde sie geöffnet. Ein Dienstmädchen mit großen Augen machte einen linkischen schnellen Knicks. »Lady Marian?« Als Marian nickte, fuhr sie eilig fort: »Der Bader schickt mich. Ihr sollt zu Sir Guy kommen, Lady. Der Bader sagt, er fragt nach Euch.«
Das überraschte sie. »Sir Guy fragt nach mir?«
»Ja, Mylady. Werdet Ihr kommen?«
»Natürlich. Lauf schon voraus und sag ihm, daß wir gleich kommen.«
»Na also«, sagte Matilda, als sie zu Marian in den Korridor trat und die Tür zuzog. »Seht Ihr? Wir sollen eben nicht so schnell gehen.«
»Wir gehen, sobald wir bei ihm waren.«
Gisbourne atmete geräuschvoll zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch und umklammerte mit beiden Händen das Bettzeug. Der Schmerz des Keilerbisses strahlte bis zur Hüfte hoch und bedrohte seinen Magen.
Er wollte sich nicht übergeben. Sich zu übergeben hätte Bewegung bedeutet, und die Bewegung, gleich welcher Ursache, würde wieder neuen Schmerz hervorrufen.
Der Bader hatte das linke Hosenbein von seinem Bein entfernt und dann die schmerzhafte Wunde, so gut es ging, gesäubert und verbunden. Das hatte er jedoch gegen seinen Willen getan; die Wunde, so erklärte er, würde sicher brandig werden. Die beste Überlebenschance hätte Gisbourne, wenn das Bein abgenommen werden würde.
Gisbourne lehnte das ab. Er verkündete, wenn er denn sterben müßte, dann mit zwei Beinen.
Die Tür ging auf, und herein trat Marian, eingehüllt in einen dunkelblauen Umhang. Er erinnerte sich vom vorhergehenden Tag an ihn; das Blau hatte sich gegen das Grün des Waldes und gegen ihre offen getragenen Haare abgehoben. Jetzt trug sie eine weiße Leinenhaube, und ihr prächtiges Haar hing ihr in einem Zopf bis zur Taille. Aber weder der Umhang noch die Kopfbedeckung verbargen ihre Schönheit. Gisbourne, der plötzlich verlegen wurde, zog eine Decke über sein Bein.
Der Bader nahm Marian beiseite und redete leise und schnell auf sie ein. Gisbourne wußte, was er zu ihr sagte.
Aber da war sie auch schon an seiner Seite und kniete sich anmutig neben ihn. Ihre weiße Haut war ohne einen Makel und von gesunder Tönung. In ihren schwarzen Augen sah er aufrichtige Bestürzung.
»Sir Guy?« Ihre Stimme klang tief und war belegt. Er war nicht leidenschaftlich und überdies sehr zurückhaltend in seiner Lebensführung, doch sie klang wie keine andere Frau, die er kannte, im Bett oder anderswo.
Sein Gesicht wurde sofort heiß. Seine Kehle war trocken, aber er wagte nicht, sie zu befeuchten. Er fürchtete, das Wasser könnte ein Schlafmittel enthalten, und das konnte er nicht riskieren. Er könnte mit einem Bein weniger aufwachen – falls er überhaupt wieder aufwachte. »Lady«, krächzte er. »Wie geht es Euch?«
Ein aufrichtiges Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus; sie war, sah er, erleichtert, daß seine Worte Sinn ergaben. »Viel besser als Euch, glaube ich.«
Er schluckte. »Ich hatte Angst, der Keiler hätte Euch etwas zuleide getan.«
»O nein. Es bestand keine Gefahr. Robert tötete ihn, bevor er irgend jemand anders verletzen konnte.«
Wieder ging die Tür auf, und eine fette, alte Frau kam herein. Er wußte, es war Marians Dienerin, damit der Anstand gewahrt bliebe. »Robert – von Locksley?« Er fand es seltsam, daß sie so vertraulich seinen Vornamen benutzte, aber ihr selbst schien es nicht aufzufallen.
»Ja. Es war alles sehr schnell vorbei.« Marian machte eine Handbewegung. »Noch nie habe ich einen Mann gesehen, der so schnell und so geschickt war. Es war keine Angst in ihm, nur Entschlossenheit.«
Gisbourne, dem der bewundernde Unterton nicht entgangen war, blickte Marian ins Gesicht. Seine Fähigkeiten lagen mehr im Umgang mit Geld, Gewichten und Maßen. Er konnte eine Burg verwalten, aber keinen Keiler töten. Er wußte sehr gut, was davon Frauen mehr beeindruckte.
Marian warf über die Schulter einen Blick auf den Bader, der im Hintergrund wartete. Als sie sich wieder umdrehte, war ihr Gesichtsausdruck ernst. »Sir Guy, er sagt –«
»Er sagt, er muß mir das Bein abnehmen.« Er nickte angespannt. »Lady – das kann ich nicht zulassen.«
Sie versuchte es vorsichtig. »Er sagt, wenn nichts unternommen wird, könnte es gefährlich werden.«
»Er glaubt, ich werde sterben. Er glaubt, das Bein wird abfaulen.« Gisbourne schüttelte den Kopf. »Ich könnte es nicht ertragen, nur ein Bein zu haben. Und er hat noch nichts anderes versucht, außer mir einen Umschlag zu machen. Es gibt noch Ausbrennen. Laßt ihn erst die Wunde ausbrennen. Wenn das nichts hilft...« Gisbourne fuchtelte mit einer Hand. »Dann ist es besser, ich sterbe. Aber ich sterbe mit beiden Beinen.«
Stumm blickte sie auf ihn hinunter und wägte seine Worte ab. Dann lächelte sie und drückte ihm ihre weiche, kühle Hand auf die heiße Stirn. »Dann werde ich ihm das sagen. Es ist schließlich noch immer Euer Bein – Euren Wünschen muß Folge geleistet werden.«
Sie wandte sich an den Bader. »Habt Ihr mit dem Sheriff gesprochen? Habt Ihr dem Sheriff mitgeteilt, was Sir Guy wünscht?«
Der Bader bewegte sich schnell und ruckartig. »Lady, es hat ihn schwer erwischt. Wenn ich das Bein dranlasse –«
»Ihr werdet es dranlassen. Er wünscht es so. Habt Ihr schon mit dem Sheriff gesprochen?«
Der Bader war unglücklich. »Er sagt, ich soll mich nach besten Kräften um ihn kümmern.«
»Dann tut das. Säubert die Wunde und gebraucht Eisen. Pflegt ihn sorgsam, wie Ihr gebeten wurdet... habt Ihr verstanden?« Ihr Ton verriet Unnachgiebigkeit.
»Lady, ja, aber –«
»Nichts aber«, sagte sie mit fester Stimme. »Wenn es Euer Pflichtgefühl erleichtert, werde ich zum Sheriff gehen –«
»Das braucht Ihr nicht.« DeLacey war gerade in den Raum getreten. »Ich bin selbst gekommen; was wolltet Ihr mir sagen?«
Gisbourne entging nicht, wie ihre besorgte Haltung schwand und von einer körperlichen Steifheit und einer angespannten Selbstbeherrschung ersetzt wurde. Trotzdem kamen ihre Worte sehr ruhig, wenn auch noch immer mit Nachdruck. »Dieser Mann besteht darauf, Sir Guy das Bein abzunehmen. Das entspricht jedoch nicht Sir Guys Wünschen.«
Sie mag ihn nicht. Es erschien ihm erst unsinnig. Aber er war sich ganz sicher. Sie mag ihn nicht! Gisbourne zuckte zusammen, als sich der Schmerz wie ein Pfeil in seinen Schenkel bohrte und in die verblüffende Entdeckung mischte. Was hat er getan, um sie gegen sich aufzubringen?
DeLacey verneigte den Kopf vor ihr. Ein schneller Blick auf Gisbourne sollte seine aufrichtige Sorge für die Gesundheit und die Verfassung seines Kämmerers vermitteln.
Gisbourne, der wegen des Schmerzes die Zähne zusammenbiß, sah jedoch noch etwas anderes. Er benutzt meinen Zustand, um ihre Meinung über ihn zu beeinflussen.
DeLacey blickte den Bader streng an. »Ihr werdet tun, was die Lady angeordnet hat.«
»Sehr wohl, Mylord.« Der Bader machte eine Verbeugung.
Gisbourne wartete darauf, daß der Sheriff sich nun ihm zuwenden würde, doch abgesehen von dem sehr flüchtigen Blick in seine Richtung sah deLacey nur Marian an. »Wie ich höre, seid Ihr und Eure Dienerin im Aufbruch begriffen.«
»Ja, Mylord.« Das kam sehr steif.
»Dürfte ich Euch dann vorschlagen, in meiner Gefolgschaft zu reisen? Ich bringe Eleanor zurück nach Nottingham.«
Marians Tonfall war eisig. »Und der Minnesänger, Mylord?«
»Ja, ihn natürlich auch. Sie bringen ihn gerade hoch.« DeLacey warf einen Blick auf Matilda. »Ihr und Eure Dienerin seid herzlichst willkommen. Und Eleanor wird ein wenig Gesellschaft haben ...«
Marian ließ sich jedoch nicht beeindrucken, was Gisbourne erneut überraschte. Die meisten Menschen gaben deLaceys Wünschen nach. »Ich glaube nicht. Matilda und ich haben bereits unsere Pferde holen lassen. Ich habe die Abreise nur verzögert, um nach Sir Guy zu sehen.« Der Blick, mit dem sie ihn bedachte, war freundlich. »Ihr müßt Euch schonen, Sir Guy. Ich werde für Eure Genesung beten.«
»Lady–« Er wollte sie aufhalten, wollte, daß sie noch blieb, aber sie war sichtlich begierig darauf, der Gesellschaft des Sheriffs zu entfliehen. »Ich – danke, Lady Marian.«
»Marian.« DeLacey, der, wie Gisbourne befand, allzu freizügig mit ihrem Vornamen war, streckte seine Hand nach ihr aus, als sie gerade auf dem Weg zur Tür war. »Ich bestehe darauf –« Der Rest des Satzes ging jedoch im Lärm hinter der Tür und den hastigen Worten eines Wachmanns unter.
»Lord Sheriff? Mylord –« Der uniformierte Wachposten blieb, kaum im Zimmer, stramm stehen. Sein Gesicht war ausdruckslos. »Der Mann ist verschwunden.«
DeLacey kniff die Augen zusammen. »Der Minnesänger?«
Gisbourne, der den Gesichtsausdruck kannte, hätte am liebsten gekichert. Als ob die Skepsis noch etwas an der Tatsache ändern konnte!
Der Wachmann schluckte sichtbar. »Mylord. Ja.«
»Verschwunden?«
»Ja, Mylord.«
DeLacey war wie vom Donner gerührt. »Der Minnesänger ist aus dem Verlies des Earls entflohen?«
Marians Gelächter erfüllte den Raum. Es war ein unverstelltes und natürliches Lachen, das ihre ganze Freude verriet.
»Mylord.« Der Wachmann schaute grimmig drein. »Mylord, der Earl wünscht Euch zu sprechen.«
»Ja.« DeLaceys Tonfall war hart. »Das kann ich mir vorstellen.« Mit einer Miene, die nichts preisgab, warf er einen kurzen Blick auf Marian, dann wandte er sich wieder an den Wächter. »Geleitet die Lady und ihre Dienerin in den großen Saal. Sie wird in meinem Gefolge reisen. Ich möchte, daß Ihr ihren Wünschen nachkommt.«
»Mylord – nein!« Sie schüttelte den Kopf. Eine Welle von Röte überzog ihr Gesicht. Sie gewann jedoch rasch ihre Selbstbeherrschung wieder und sagte ruhiger: »Wir können nicht länger warten.«
»Aber natürlich könnt Ihr das.«
»Mylord.« Der Wachmann neigte den Kopf, als der Sheriff den Raum verließ. Dann blickte er zu Marian. »Mylady – wenn es Euch beliebt?«
Gisbourne erstaunte die Heftigkeit in ihrer Stimme »Nein, es beliebt mir nicht. Aber mir bleibt wohl keine andere Wahl, oder?«
Der Wachmann blickte verwirrt, als Marian an ihm vorbeirauschte.
Die Unterredung mit dem Earl war von kurzer Dauer und brachte keine Erklärung für den Ausbruch ans Licht. William deLacey biß sich auf die Zunge, um nicht zu sagen, was er zu gern gesagt hätte. Man beschuldigte den Earl von Huntington nicht solcherart.
Der Earl war, wie der Sheriff wußte, ebenfalls nicht zufrieden, wenn auch aus andern Gründen. Seine neue Burg, auf die er so stolz gewesen war, wies, wie sich nun herausstellte, einen immensen Fehler auf, der sie als Gefängnis unbrauchbar machte: eine Gruppe von Wachleuten, die bestechlich war.
Das war die einzige Erklärung, wie Huntington zuletzt verkündet hatte. Und da drei Wachmänner fehlten, lag die Lösung nahe. Irgend jemand hatte ihnen Geld gegeben, damit sie den Gefangenen freiließen.
Und welcher von all seinen Gästen, fragte der Earl anzüglich, hatte wohl das größte Interesse daran, daß er freikam?
DeLacey biß sich auf die Zunge; er hatte die unterschwellige Anspielung bemerkt, es aber nicht gezeigt. Statt dessen hatte er dem Earl beigepflichtet und sich von ihm verabschiedet.
Aufrührerisch blickte Eleanor deLacey ihrem Vater in die Augen. Sie merkte, daß er wirklich aufgebracht war, denn er ließ sich nur selten so gehen. Er nahm ihren Mantel und warf ihn ihr zu. »Zieh dich an. Wir gehen auf der Stelle.«
Der Umhang blieb kurz an ihrer Schulter hängen, dann glitt er hinunter und landete auf dem Boden. Sie machte keine Anstalten, ihn aufzuheben.
Ihr Vater neigte seinen Kopf. »Nun gut.« Er griff nach ihrem Handgelenk und drückte es fest, während er sie zu sich heranzog. »Hast du sie mit Geld bestochen? Oder mit deinem Körper?«
Die Gehässigkeit seines Tonfalls erschreckte sie. Er war ein leidenschaftlicher Mensch, der ebenso zu guter Laune wie auch zu schlechter Laune fähig war, es aber meistens nicht nach außen zeigte.
»Ich weiß nicht, was –«, begann sie.
»Lüg mich nicht an! Nicht jetzt!« Sein Atem ließ die feinen Haarsträhnchen, die ihr ins Gesicht hingen, wehen. »Hast du deine Beine auch für die Wachleute breit gemacht?«
»Ich habe nichts –«
»Lüg mich nicht an!« Er ließ ihr Handgelenk los und faßte ihr statt dessen an die Kehle. Seine Fingerspitzen lagen auf dem verfärbten Fleck, den Alans Mund hinterlassen hatte.
»Du warst es, habe ich nicht recht?«
Eleanor lachte ihm ins Gesicht. »Ich werde Euch nichts sagen!«
Langsam schüttelte er den Kopf. »Du stellst meine Geduld wirklich auf die Probe, mein Mädchen.«
Er faßte sie am Ellbogen und führte sie unsanft aus dem Zimmer hinaus in den Korridor. Sie versuchte einmal, sich seinem Griff zu entwinden, aber er packte sie nur noch fester, bis sie vor Schmerz aufschrie.
Sie dachte daran, was ihr Vater gesagt hatte: Alan war frei. Vage überlegte sie, daß sie sich eigentlich für ihn freuen sollte. Schließlich war er unschuldig, obgleich sie sich das nicht zu sagen getraute. Und falls sie jemand fragte, würde sie beschwören, daß er sie vergewaltigt hatte. Was blieb ihr anderes übrig?