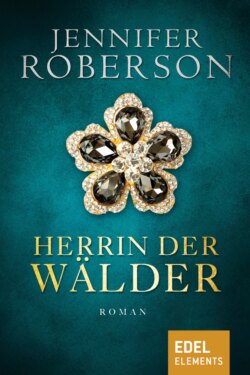Читать книгу Herrin der Wälder - Jennifer Roberson - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
10. Kapitel
ОглавлениеDas Frühstück verlief zwanglos. Während sich der morgendliche Nebel allmählich im schwachen Sonnenlicht auflöste, sammelten sich die Gäste in Grüppchen und lachten und plauschten miteinander. Um sie herum hielten die Bediensteten die nervösen Pferde, breiteten Leintücher auf dem noch feuchten Untergrund aus oder wanderten ziellos umher, bis ihnen jemand sagte, was sie zu tun hatten.
Als zu guter Letzt die vollbeladenen Wagen Brot, Käse und Wein von der Burg zur Wiese brachten, hatten alle großen Appetit. Huntington entschuldigte sich elegant für die Langsamkeit seines Küchenpersonals und wartete persönlich Prinz John auf, während sich die anderen hinsetzten.
Der Count von Mortain setzte sich nicht auf den Boden; einer der Wagen hatte einen Stuhl persönlich für ihn mitgebracht. Zu Pferde wartete er, bis der Stuhl auf dem Boden stand und saubergewischt war. Erst als ihm mitgeteilt wurde, der Stuhl stünde nun bereit, stieg er vom Pferd, nahm seinen ersten Becher an diesem Tag entgegen, der allerdings erst vorgekostet wurde, und setzte sich. Solchermaßen behaglich niedergelassen, nahm er auch ein Stück warmen Brotes entgegen.
»Ich würde ja, servierte man mir das Frühstück so spät, dafür Sorge tragen, daß mein Kämmerer die faulen Leibeigenen bestraft«, sagte John zum Earl von Huntington.
»Das werde ich auch tun, Mylord. Aber man muß bedenken, daß die Ankunft einer Persönlichkeit, wie Ihr es seid, gelegentlich Verwirrung unter dem Haushaltspersonal stiften kann. Sie sind so sehr darum bemüht, Euch zufriedenzustellen, Mylord – aber zu große Bemühung kann, ungeachtet der Aufrichtigkeit des Wunsches, in Unfähigkeit münden.«
John kniff die Augen zusammen, während er an seinem Wein nippte. Er versuchte, die Absicht der Bemerkung abzuschätzen. War letzteres auf ihn gemünzt? Eröffnete der Earl das Spiel?
Huntingtons Gesichtsausdruck paßte zu seinem tadellosen Benehmen: Er stellte vollkommene Gelassenheit und Ruhe zur Schau.
Wie beiläufig bemerkte John: »Man könnte auch denken, daß es für die Landbevölkerung etwas schwierig ist, sich an das Leben auf einer Burg zu gewöhnen.«
Huntington zuckte nicht zusammen. »Genau, Mylord.«
John biß ein Stück Brot ab, kaute und schluckte es dann hinunter. »Warum habt Ihr eigentlich eine Burg gebaut?«
Der Earl aß vom Käse und vom Brot und trank Wein. Ruhig erwiderte er dann: »Weil ich es mir leisten konnte.«
Das war offen und herausfordernd: wie ein frisch gewetztes Schwert, das zwischen ihnen in der Erde steckte und auf die Hand wartete, die es wagte, es aufzunehmen.
Johns Edelsteine glitzerten, während seine Hände unaufhörlich das Brot in Stücke rissen, jetzt noch schneller als zuvor. »Ein alter Name, Huntington – ein alter angelsächsischer Name. Und doch habt Ihr eine normannische Burg gebaut.«
Der Earl lächelte schwach. »Die Normannen bauen die besten Burgen, Mylord. Sie sind beinahe uneinnehmbar.«
»In der Tat.« John zupfte unheilverkündend am Brot herum und schnippte die Krumen weg, dann lächelte er wohlwollend. »Natürlich war der Zeitpunkt vielleicht etwas unglücklich gewählt. Das Geld, welches Ihr auf die Burg verwendet habt, könnte nun besser auf das Lösegeld meines Bruders verwendet werden.«
»Ohne Zweifel, Mylord. Aber Huntington Castle wurde noch zu Lebzeiten Eures Vaters begonnen.«
»Zu Lebzeiten meines Vaters herrschte hier noch Frieden.« Mit einem Fingernagel holte John ein hartes Stück Käse zwischen seinen schlechten Zähnen hervor.
Der Earl breitete die Hände aus. »Nur ein Narr vertraut auf ein Dach aus Pergament, wenn es gerade nach einem Wetterumschwung aussieht.« Geschickt machte er eine kurze Pause. »Ich ziehe Stein vor.«
John winkte einen Mann herbei, der seinen Käse in kleinere, mundgerechte Stücke schnitt, dann begann er eines nach dem anderen zu essen, ohne viel zu kauen. »Huntington liegt nicht an der Küste noch in der Nähe der Grenze zu Wales oder Schottland. Darum wundert man sich, warum es überhaupt eine Burg sein mußte.«
Der Earl nahm einen Schluck Wein aus einem Becher, der weniger prunkvoll war als der des Prinzen, dann stellte er ihn beiseite. »Wie Ihr bereits angedeutet habt, Mylord: Nun ja, ich wollte der Welt etwas hinterlassen.«
John aß mit gesenkten Lidern Käse. »Einige Männer würden ihre Hoffnungen in diesem Hinblick auf ihre Söhne setzen.«
Huntington lächelte friedfertig. »Ich setze meine Hoffnungen auf beides.«
Johns schwere Lider hoben sich. »Er wird selbst Söhne brauchen.«
»Selbstverständlich, Mylord.«
»Und eine Frau.« Der Prinz wandte sich träge um und warf einen Blick auf deLacey, der in ihrer Nähe saß. John merkte, daß der Sheriff es gehört hatte; er hatte einen verkniffenen Zug um den Mund. Der Prinz setzte ein falsches Lächeln auf und machte Zeichen, ihm mehr Wein zu bringen. »Ah, aber wir haben Zeit. Er ist ja noch jung, und es gibt so viele Frauen.«
Aus den Tiefen des Jagdreviers von Huntington erscholl das Signal eines Horns. Die Töne wurden, ebenso wie das wütende Gebell der Jagdhunde und die Rufe der Treiber und Jäger, von der Morgenluft klar herangetragen.
Als der Earl seinen Weidmann erblickte, empfahl er sich und bahnte sich den Weg durch das aufgemunterte Völkchen, das sich um das beschmutzte Tuch herumstellte und auf den Wald blickte. »Nun?« fragte der Earl ruhig. »Keiler oder Hirsch?«
Der Jäger blies in sein Jagdhorn. »Eine frische Fährte«, sagte er. »Ein großer Abdruck, der aber nicht zu schwer ist, und Hauerspuren an den Bäumen; ein junger Keiler, Mylord.« Der Jäger senkte seine Stimme. »Möchtet Ihr ihn wirklich ihm überlassen?«
Huntington lächelte nicht. »Er sagte Keiler, Dickon. Ich denke, wir sollten ihm einen Keiler geben.«
Beim Klang des Jagdhorns sprang Eleanor auf ihre Füße. »Endlich!« rief sie aus. »Endlich kann ich gehen!«
Marian erhob sich, vorsichtig ihre Röcke raffend, und versuchte Eleanor, die sich bereits abgewandt hatte, um nach ihrem Pferd zu verlangen, mit einer Handbewegung aufzuhalten. »Was ist, wenn er später nach Euch fragt?«
Die Tochter des Sheriffs ergriff ungeduldig die Zügel ihrer Stute, die ihr soeben gebracht worden war. »Er wird nicht nach mir fragen. Er ist viel zu beschäftigt damit, sich die Gunst des Prinzen zu erschleichen ...« Ohne viel Hilfestellung vom Pferdeknecht schwang sie sich in den Sattel. »Ich kann nicht sofort zurückreiten – wir müssen erst mit in den Wald reiten, dann werde ich umkehren.« Gebieterisch winkte Eleanor den Jungen weg. »Er wird nicht nach mir fragen, aber falls doch – sagt ihm nichts! Erinnert Euch an das Versprechen, das Ihr mir gegeben habt!«
Ein Stalljunge hielt Marian die Zügel ihrer Stute und eine Hand hin, doch sie zögerte. »Eleanor – ich glaube –«
Eleanor beugte sich zu ihr hinunter. »Kommt jetzt oder gar nicht, wie Ihr wollt. Aber es ist der einzige Weg, den ich kenne, das zu tun, was ich will.«
Marian gab keine Antwort.
Verachtung flackerte kurz in Eleanors Augen auf und wurde dann von etwas verdrängt, was sehr nahe bei Mitleid lag. »Ihr könnt nicht, oder?« fragte Eleanor. »Ihr könnt den Männern nicht nein sagen. Ihr habt kein Rückgrat.«
Und dann war sie auch schon fort.
Wütend schaute Marian ihr hinterher. Dabei dachte sie aber nicht an den Vater der Frau, sondern an Huntingtons Sohn. »Kein Rückgrat«, murmelte sie. »Dann ist es vielleicht an der Zeit, daß ich eins entwickle!«
Prinz John ritt bis zum Waldrand, wo er sodann befahl, seinen Stuhl abzuladen. Als der Stuhl bereit stand, ließ er sich auf ihm nieder.
Die Jagdgesellschaft, die sich bereits in das dicht bewaldete Jagdgebiet begeben hatte, löste sich verwirrt auf. Die vorausreitenden Jäger fielen fast wie ein Mann zurück und kämpften sich von neuem durch den ungezähmten Wald, um den Mann zu finden, der in Abwesenheit seines Bruders wahrscheinlich die Krone tragen würde.
Prinz John, der Count of Mortain, hielt ihnen jedoch vor Augen, daß sie sich auf einer Jagd befanden und daß sie nicht gut das Tier jagen konnten, wenn sie um ihn herumtanzten wie um einen Maibaum. Was ihn anbelangte, sagte er, würde er abwarten. Wenn der Keiler ausfindig gemacht und eingekesselt wäre, würde er hinzustoßen, um der Tötung beizuwohnen. Solcherart entlassen, zogen alle von dannen, um den Keiler zu suchen – außer einigen wenigen, die dem Prinzen persönlich aufwarten sollten. Einer von ihnen, entschied John, war William deLacey.
Der Prinz lächelte. »Wir haben unsere Unterhaltung über die Verwaltung Nottinghamshires noch nicht beendet.«
DeLacey bezweifelte, ob Nottinghamshire das Thema war.
John lächelte ihn warm an. »Das letzte Mal, als wir uns alleine trafen, stellte ich Euch eine Frage. Erinnert Ihr Euch noch an sie?« Er winkte, und ein Becher Wein, der bereits vorgekostet worden war, wurde ihm in die Hand gedrückt. »Es war gestern abend, Sheriff. Oder habt Ihr das bereits vergessen?«
DeLacey hatte nichts vergessen.
»Die Frage, die ich Euch stellte, war simpel: ›Was begehrt Ihr?‹ Und nun stelle ich Euch die Frage noch einmal, da Ihr ja eine Nacht darüber schlafen konntet.« John nippte am Wein.
Seines Kurses sicher, lächelte der Sheriff schwach. »Ich möchte das, was Ihr für mich für angemessen haltet.«
»Ah.« John erwiderte kurz deLaceys Lächeln, dann verblaßte es. »Niemand gibt mir etwas. Was ich haben will, nehme ich mir.«
DeLacey nickte. »Wir leben in verschiedenen Welten, Mylord. Ich bin Euch für meine Handlungen voll und ganz verantwortlich.«
»Während ich nur Gott verantwortlich bin – und mir selbst. Und Gott ist, dünkt mich, gütiger als ich. Er erwartet weniger von mir.« John nahm wieder ein paar Schlucke Wein, dann reichte er dem wartenden Diener den Becher. Übertrieben beiläufig, was deLacey aufmerken ließ, sagte er: »Ich denke, Gott würde nicht wollen, daß ein Mann König von England ist, der keinen rechtmäßigen Erben hervorbringen kann.«
Ach, dachte deLacey, da war es also heraus. Keine Ausflüchte mehr. Keine Andeutungen mehr. Nun lag es an ihm zu entscheiden, in welche Richtung er gehen wollte.
John beugte sich vor. »Ich glaube, das ist das Wesentliche an der Angelegenheit, deLacey. Richard zieht ins Heilige Land, wann immer er das Gefühl hat, daß Gott ihn zurücksetzt. Er möchte Gott bestechen. Vielleicht hofft er, daß Gott für einen Erben sorgt, ohne daß er dabei vonnöten sein wird ...« John ließ sich wieder zurücksinken und kaute müßig an seinem verbleibenden Daumennagel. »Solange er mit Knaben schläft, wird er keinen Erben haben. Und solange Berengaria nicht so klug ist, ihr Bett mit einem Stellvertreter zu füllen und das Ergebnis dann Richards Erzeugnis zu nennen, wird er keinen Erben haben.« Er zerriß den Nagel und spuckte den Splitter aus, während er deLacey über den derart brutal behandelten Daumen hinweg betrachtete. Sehr ruhig gab er zu bedenken: »Und solange der deutsche Heinrich seinen geschätzten Gast, meinen Bruder, nicht freiläßt, wird es keinen direkten Erben geben können. Es wird keinen Erben geben außer mir.«
DeLacey senkte den Kopf. Das habe ich nicht vorhersehen können. Kein gesunder Mann würde sich wünschen, eine derartige Entscheidung zu treffen, sich mit einem zukünftigen König gegen den, der es augenblicklich ist, zu verbünden – aber was bleibt mir anderes übrig?
Nachdenklich bemerkte John: »Huntington hat eine Burg. Eine normannische Burg sogar; die, wie er sich selbst ausdrückte, fast uneinnehmbar ist. Und ein Mann wäre ein Dummkopf, würde er sich nicht fragen, warum er sie bauen ließ.«
DeLacey sagte nichts.
John lächelte dünn. »Er hat auch einen Sohn. Einen alleinigen – und unverheirateten – Erben. Und Ihr habt eine unverheiratete Tochter, die, wie es unter den gegenwärtigen Umständen aussieht, nicht heiraten wird, bevor ihr die Zähne ausfallen.«
Die Verheißung war stärker als der Kummer. DeLacey fühlte sich benommen. »Mylord, ja. Eleanor.«
»Eleanor.« John nickte. »Ich habe den Namen schon immer gemocht.«
»Oh, Mylord – ja, es ist ein schöner Name –« Der Sheriff biß die Zähne aufeinander, um die Beherrschung wiederzuerlangen. Ruhiger sagte er: »Ich nannte sie nach Eurer Mutter, der Königin-Witwe.«
John interessierte das nicht. »Das taten alle.«
DeLacey holte Luft, um die eine Frage zu stellen, die ihm auf der Seele brannte. Wenn es John ernst wäre mit Locksley und Eleanor ... »Mylord –«
Der Prinz machte eine Geste. »Ich bitte Euch, verliert keine Zeit. Laßt den Keiler nicht länger warten.«
Er war entlassen. DeLacey verkrampfte sich. »Mylord –«
Plötzlich brach der einzig verbliebene Bruder des Königs in Lachen aus. Er hatte unvermittelt seinen Kurs geändert. »Und was werdet Ihr im Privaten sagen, wenn ich wieder weg bin?«
Der Sheriff begegnete Johns begierigem und standhaftem Blick. Seine Zukunft war damit besiegelt. Er hatte John die Wahrheit gesagt: William deLacey war dem Count von Mortain voll und ganz verantwortlich.
Er wußte, was John wollte. Er wollte an die Macht gelangen. Dazu war es nötig, möglichst viele Männer wie den Earl von Huntington in sein Gefolge zu bringen, wohlhabende und mächtige Männer, die sich sonst gegen ihn stellen könnten.
Der Knoten in seinem Bauch wurde fester. Aber Verbindlichkeit war angesagt. Es gab nur Verbindlichkeit – oder Vernichtung. Ruhig erklärte deLacey: »Ich würde sagen, wäre ich denn dumm genug, davon überhaupt zu sprechen, daß ich von Eurer Fähigkeit überzeugt bin, den Thron zu beerben – in jenem unglücklichen Falle, daß der Kreuzzug England des Wohlstands beraubt, den es braucht, um seinen geliebten Herrscher auszulösen.«
»Ah.« John lächelte. »Ich hoffte so sehr, daß Ihr ebenfalls erkennen würdet, daß mein Weg der einzige ist, um unserem geliebten England zu helfen.«
»Ja, Mylord.«
»Erhebt die Steuern, Sheriff.«
DeLacey saß starr da. »Mylord, ich würde meine Pflicht vernachlässigen, wenn ich Euch nicht mitteilte, daß es bereits Klagen bezüglich der Steuern gibt.«
»Natürlich.« John winkte gleichgültig mit seiner beringten Hand ab. »Ich habe es zur Kenntnis genommen, Sheriff.« Ein Flackern zeigte sich in seinen zusammengekniffenen Augen. »Erhebt die Steuern, deLacey. Ich habe Schulden. Nottinghamshire gehört mir. Treibt die Steuern ein und bringt sie zu mir nach Lincoln. Habt Ihr verstanden?«
DeLacey, der spürte, daß er entlassen war, erhob sich. »Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, Mylord.«
»Ich denke nicht.« John lächelte. »Sorgt dafür, daß die Steuern nirgends anders hingehen als nach Lincoln und in meine Schatzkammer. Habt Ihr verstanden?«
Der Sheriff verneigte sich. »Ja, Mylord.«
John ließ sich zurück in seinen Stuhl sinken und wedelte mit der Hand. Die Audienz war beendet.
DeLacey stieg auf sein Pferd, verbeugte sich vor seinem Herrn und ritt dann in den Wald hinein. Seine Hände, mit denen er die Zügel hielt, zitterten.