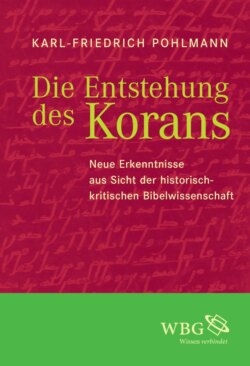Читать книгу Die Entstehung des Korans - Karl-Friedrich Pohlmann - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Der Koran und seine derzeitige Textausgabe als textus receptus
ОглавлениеFür die islamische Welt gilt als maßgebliche Textausgabe der sog. „Kairiner Koran“, der „auf Veranlassung von König Fuad von einem Gremium von Azhar-Gelehrten erarbeitet und 1923 in Kairo erstmals gedruckt wurde“28. Seine Textfassung29 ist inzwischen auch die maßgebliche Vorlage für Druckausgaben und Übersetzungen außerhalb der islamischen Welt30. Von den für den deutschsprachigen Bereich interessanten zweisprachigen Textausgaben seien hier die von Khoury (2004) sowie die von Bubenheim/Elyas (2002) genannt31. Üblicherweise verwendet man heute die sog. kufische Verszählung dieser offiziellen Kairiner Koranausgabe. Die Versangaben in älteren wissenschaftlichen Werken stimmen häufig damit nicht überein, da sie sich auf die sog. Flügel’sche Text-ausgabe32 (seit 1834) beziehen33. Die meisten Textausgaben und Übersetzungen klassifizieren nach den Vorgaben der islamischen Tradition die einzelnen Suren als mekkanisch oder medinensisch, also als von Mohammed in Mekka oder nach 622 n.Chr. in Medina verkündet34.
Einen speziellen Hinweis verdient noch jene Textausgabe des Korans, deren Druck und Verbreitung am 14. Januar 1962 vom „Ausschuß zur Überprüfung der Koranexemplare“ („ein Gremium des Lehrkörpers der Al-Azhar-Universität“) in Kairo genehmigt wurde35. Denn interessant ist an dieser Ausgabe, dass darin nicht mehr „jede mekkanische Sure … ‚ wie häufig der Brauch, im ganzen als eine solche ausgewiesen wurde; vielmehr wurde in nahezu allen mekkanischen Suren eine Reihe von einzeln aufgeführten Versen als Einschübe aus medinensischer Zeit bestimmt“36.
Der sog. Kairiner Koran kann zwar „als … die weitaus beste derzeit vorliegende Ausgabe gelten“37; es handelt sich aber keineswegs um eine wissenschaftlich edierte historisch-kritische Textausgabe, vergleichbar etwa den in den Bibelwissenschaften erarbeiteten Ausgaben des alttestamentlichen und neutestamentlichen Schrifttums.
Wie oben skizziert ist zumindest aus muslimischer Sicht eine solche Textausgabe auch kein wirkliches Desiderat. Aber auch in der älteren sog. westlichen Koranforschung gab es Stimmen, die sich von einer solchen Ausgabe keinen besonderen Gewinn versprachen.
Pretzl führte 1938 in GdQ III zum „Stand der Handschriftenforschung“ aus: „Aus der engen organischen Verbindung der Koranlesung mit dem Othman’schen Korantext scheint sich als notwendige Folge zu ergeben, daß ein Studium der Handschriften … nichts Neues bieten würde … Tatsächlich haben auch die Koranhandschriften selbst in der muslimischen Koranwissenschaft spätestens seit dem 4. Jahrhundert d.H. keine Rolle mehr gespielt … Bei oberflächlicher Orientierung konnten sich auch okzidentalische Gelehrte der Mühe einer Kollation der Handschriften enthoben fühlen“ (GdQ III, 249). Pretzl verweist dann auf die von ihm und von Bergsträßer geplanten Forschungsarbeiten und die ersten Anfänge „der Erforschung eines bedeutenden Quellenmaterials“ (GdQ III, 250).
Pretzls, Bergsträßers und auch schließlich Jefferys dann leider wegen ihres frühen Todes abgebrochene Arbeiten erwähnt 1975 Paret in seinem Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband „Der Koran“. Er meint dazu: „Es ist allerdings fraglich, ob die Auswertung der handschriftlichen überlieferten Lesarten und der Lesartenliteratur speziell für die historische Deutung des Korans in seiner ursprünglichen Gestalt besonders ergiebig geworden wäre. Ein wertvolles praktisches Ergebnis des von Muslimen immer noch gepflegten Studiums der Lesarten steht uns heute jedoch jederzeit greifbar zur Verfügung: die amtliche ägyptische Koranausgabe vom Jahr 1924“38.