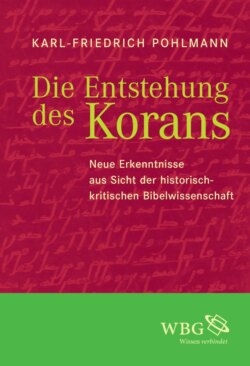Читать книгу Die Entstehung des Korans - Karl-Friedrich Pohlmann - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Fazit: Einsichten und Anregungen zu einer kritischen Korananalyse
ОглавлениеDer obige knapp gehaltene Überblick über die Geschichte der Erforschung atl. Prophetenbücher zeigt, dass in ihrem Verlauf bestimmte Problemstellungen und entsprechend Lösungsmodelle mit solchen in der Koranforschung vergleichbar sind:
a) Ähnlich wie die lange Zeit verbreitete Einschätzung, dass die atl. Prophetenbücher jeweils überwiegend authentisches Textgut des betreffenden Propheten wiedergeben, dass also nur sporadisch mit redaktionellen Textanteilen zu rechnen ist, gilt für eine Mehrheit von Spezialisten der derzeitigen Koranforschung immer noch, dass der Koran lediglich die authentische Verkündigung Mohammeds und somit keinerlei anderweitig redaktionell erstelltes Textgut enthalten kann.
b) Hier wie dort wurden das Vorkommen und die Problematik von Texten mit unterschiedlicher oder gar widersprüchlicher Aussagerichtung damit erklärt, dass dergleichen Spannungen mit der Entstehung dieser Texte in zeitlich auseinanderliegenden, unterschiedlichen Wirkungsphasen und entsprechend neu darauf abgestimmten Verkündigungsanliegen des Propheten zusammenhängen.
c) Hier wie dort orientierte man sich an dem von der jeweiligen Tradition vorgegebenen Zeitrahmen der prophetischen Verkündigungstätigkeit.
Die atl. Prophetenbuchforschung berücksichtigt inzwischen, dass für dieses Erklärungsmodell die nicht reflektierte Übernahme theologisch-dogmatischer Prämissen ausschlaggebend sein kann, nämlich, möglichst umfangreiche Textmengen trotz ihrer Widersprüchlichkeiten dem Propheten als dem Offenbarer zuweisen zu können. „Wandlungen“ eines Propheten sind zwar nicht grundsätzlich als Erklärungsgrund für die Konzipierung von Texten mit neuen Aussageanliegen auszuschließen; aber damit kann nicht von vornherein festgelegt sein, dass solche Texte in keinem Fall aus der Hand späterer Ergänzer und Bearbeiter des prophetischen Textguts stammen. Ferner hat sich gezeigt, dass auf die Vorgaben der Tradition nicht unbedingt Verlass ist, dass z.B. die Angaben über mehrere Jahrzehnte währende Wirkungszeiten von Propheten aus späteren prophetentheologischen Erwägungen resultieren. Aus der Erkenntnis, dass kaum wissenschaftlich haltbare Aussagen zu den Hintergründen der komplizierten Textverhältnisse in den atl. Prophetenbüchern und damit zu ihrer Genese erreicht werden konnten, solange man sich weiterhin an Vorgaben der Tradition und damit an theologisch-dogmatischen Prämissen orientierte, wird man für die Koranforschung folgern, dass erste und wichtigste Aufgabe die Klärung der Frage wäre, ob die muslimische Vorstellung bzw. das Dogma von der mohammedschen Authentizität des gesamten koranischen Textguts mit den tatsächlichen Textverhältnissen in Einklang zu bringen ist oder auch nicht. Das heißt, es wäre zunächst grundsätzlich offen zu halten, ob die Vorgaben der islamischen Tradition im Wesentlichen historisch zutreffende Informationen über den Entstehungsprozess des Korans liefern oder ob diese Vorgaben erst im Abstand von den tatsächlichen Vorgängen lediglich aus den Vorstellungen Späterer resultieren.
Es darf also bei Versuchen, die Genese des Korans aufzuhellen, nicht von vornherein das Ziel sein, Texteinheiten und literarische Beziehungsgeflechte zwischen unterschiedlichen Suren und Texteinheiten so zu sondieren und zu sortieren, dass für ihre Verortung nur das von der Tradition vorgegebene historische Umfeld „Mekka und Medina“ und der für Mohammed veranschlagte Wirkungszeitrahmen (von 610 bis 632) in Frage kommen, um so sicherzustellen, dass entsprechend das gesamte koranische Textgut in engster Verbindung mit dem Propheten Mohammed gesehen werden kann. Es ist methodologisch geboten, auch mit der Möglichkeit zu rechnen, dass im Koran auch Textgut enthalten ist, das sich gegen eine Einordnung in eben diese Rahmenbedingungen sperrt, dessen Herkunft von Mohammed folglich nicht in Frage kommen kann, wofür also spätere Autoren verantwortlich zeichnen.
Allerdings steht man hier vor der großen Schwierigkeit, nach welchen Kriterien zu entscheiden wäre, ob und welche Texte noch den traditionellen Vorgaben entsprechend einzuordnen sind oder eben nicht. Feststellungen derart, dass bestimmte Texteinheiten ergänzen, verbessern, ja korrigieren etc., was z.B. im AT oft in als redaktionell erkannten Textanteilen der Fall ist, müssen für den Koran ja noch nicht zwingend bedeuten, dass hier nicht mehr von Mohammed herzuleitendes Textgut zu veranschlagen ist; denn sowohl der Zeitrahmen als auch die für Mekka und Medina vorgestellte Ereignisabfolge lassen „Wandlungen“ des Propheten Mohammed zu, also im Vergang der Zeit aufeinander folgende, unterschiedliche Äußerungen, Stellungnahmen etc.144. Zwar stehen – wie bereits vermerkt – diese Vorgaben der islamischen Tradition unter dem Verdacht, dass sie aus dem Anliegen resultieren, so den Offenbarungsgehalt des Korans sicherzustellen; doch ist zuzugestehen, dass solcher Verdacht allein noch nicht ausschließt, dass diese Vorgaben wie auch immer historisch zutreffende Erinnerungen spiegeln.
Meines Erachtens gibt es aber mindestens ein sicheres Kriterium, nach dem über die Einstufung von koranischen Textfolgen entschieden werden kann: Ein Text, dessen Analyse eindeutig zeigen kann, dass sein Abfassungsgrund und die Art seiner Verklammerung im koranischen Kontext allein aus dem Anliegen resultieren, bereits literarisch vorgegebene koranische Textanteile aufzunehmen und dazu sie ergänzend sowie neuakzentuierend und korrigierend gleichsam eine theologisch weiter reflektierte Neuauflage zu schaffen – ein derart literarisch konzipiertes, ja kompiliertes Textgebilde müsste als ein Ergebnis von im eigentlichen Sinne redaktioneller Arbeit an vorgegebenem koranischem Textgut eingestuft werden, für das nicht mehr ein Prophet und Verkündiger Mohammed als verantwortlich in Frage kommen kann. Als „Sitz im Leben“ solcher Texteinheiten ist nicht eine Verkündigungssituation, ein Kommunikationsprozess zwischen dem Verkünder und seiner Gemeinde zu veranschlagen, sondern allein die theologisch motivierte literarisch redaktionelle Weiterarbeit am koranischen Textgut auf dem Weg zum Koran als Buch. Wollte man dennoch solche Texte auf Mohammed zurückführen, hätte sich dieser vom offenbarenden Propheten und Verkünder zum schriftgelehrten Exegeten der eigenen Texte und theologisch reflektierenden Literaten gewandelt, der bei Durchsicht des bereits literarisch fixierten koranischen Textguts Überarbeitungsbedarf erkannt und entsprechend auf der literarischen Ebene sich redaktionell um Abhilfe bemüht hätte.
Soweit ich die wichtigsten Untersuchungen zur Genese des Korans überschaue, gibt es bislang keine wirklich konsequenten Ansätze, die Spurensuche nach solchen, möglicherweise nicht mehr von Mohammed herzuleitenden, redaktionellen Textanteilen im Koran aufzunehmen.
In jüngst erschienenen Untersuchungen von Neuwirth145 und Sinai („Fortschreibung und Auslegung“ [2009]) soll zwar gezeigt werden, dass das koranische Textgut in der überlieferten Version durchaus das Ergebnis einer Fortschreibungsgeschichte darstellt; aber solche Fortschreibungen wären jeweils die Folge von sukzessiven Kommunikationsprozessen zwischen dem Verkünder Mohammed und seiner Gemeinde. Neuwirth und Sinai gehen also weiterhin davon aus, entsprechende Textbearbeitungen wären mit Mohammeds Tod abgeschlossen gewesen und das gesamte koranische Textgut wäre als Verkündigung des charismatischen Gemeindegründers zu werten146. Neuwirth betont jüngst147: „Vorläufig läßt sich als die wahrscheinlichste Theorie festhalten, daß beim Tode des Verkünders die zu dieser Zeit noch erhaltenen Offenbarungen schriftlich fixiert waren, und zwar in Form von Niederschriften, die mit seinem Wissen von einzelnen Gefährten angelegt worden sein dürften, wenn diese auch noch nicht in allen Teilen einer Endredaktion in einem Kodex durch ihn selbst unterzogen worden waren“. Was genau mit „Endredaktion“ gemeint ist und wie man sich dergleichen konkret vorzustellen hat, wird (abgesehen vom Hinweis auf die Anordnung der Suren nach Umfang, vgl. a.a.O., 246f.) nicht erläutert.
Das folgende Kapitel mit Analysen ausgewählter Texte und Textbereiche stellt daher einen Versuch dar, die bislang offene Frage zu klären, ob und inwiefern in koranischen Suren angesichts der unterschiedlichen Textsorten und zahlreicher Indizien für nachträgliche Texteinschübe ähnlich wie in atl. Prophetenbüchern mit einer sukzessiven Abfolge sich überlagernder Neu- und Uminterpretationen zu rechnen ist, deren literarische Konzipierung entgegen der traditionellen Vorstellung keinesfalls noch als Wiedergabe authentischer Botschaften des Propheten und Verkünders Mohammed eingestuft werden kann.
Falls sich solche Textanteile eindeutig identifizieren lassen, ließe sich klären, welche Kreise innerhalb der koranischen Gemeinde für die entsprechend zu postulierende redaktionelle Ausgestaltung des vorgegebenen koranischen Textguts verantwortlich zeichneten und welche Anliegen dabei eine Rolle spielten.
117 So z.B. Weiser, Einleitung in das Alte Testament (1963), 175; Fohrer sprach von den „Wandlungen Jesajas“ ([1981], vgl. bes. 13f.16ff.).
118 Ezechiel 1–24 (1969/1979), 109∗.
119 Vgl. zu den Unterschieden zwischen der hebräischen Textfassung (M) und der griechischen (LXX) z.B. Kaiser, Grundriß der Einleitung. Band 2 (1994), 67ff.; s. dort auch die immer noch aktuellen Hinweise zur redaktionsgeschichtlichen Erklärung des Buches.
120 Gerstenberger, „Gemeindebildung“ in Prophetenbüchern? (1989), 46; vgl. auch a.a.O., 47: „Die Sehnsucht nach den ‚ipsissima verba‘ schlägt unter Alttestamentlern beim Umgang mit dem ‚allerheiligsten‘ Prophetenkanon noch unreflektierter durch als bei neutestamentlichen Kolleginnen und Kollegen, die gelernt haben, auch zentrale Jesusworte als ‚Gemeindebildung‘ ansehen zu dürfen“.
121 Schottroff, Jeremia 2, 1–3. Erwägungen zur Methode der Prophetenexegese (1970), 283f.
122 Kommentatoren wie z.B. Duhm zogen generell in Zweifel, dass von planmäßig vorgenommenen redaktionellen Gestaltungen eines Prophetenbuches auszugehen sei. Sein Urteil über die Entstehung des Jeremiabuches lautete: „Das Buch ist also langsam gewachsen, fast wie ein unbeaufsichtigter Wald wächst und sich ausbreitet, ist geworden wie eine Literatur wird, nicht gemacht, wie ein Buch gemacht wird; von einer methodischen Komposition, einer einheitlichen Disposition kann keine Rede sein“ (Das Buch Jeremia [1901], XX).
123 Unter „Redaktion“ versteht man in „der neuzeitlichen Bibel- und Einleitungswissenschaft die Bearbeitung eines vorgegebenen Texts im Rahmen der schriftlichen Überlieferung und dessen Umgestaltung zu einem neuen Ganzen“ (vgl. Kratz, Art. „Redaktionsgeschichte“ [1997], 367). Im Unterschied zur redaktionsgeschichtlichen Betrachtungsweise konzentriert sich das von B. S. Childs vertretene Programm eines sog. „canonical approach“ lediglich auf den Endtext, ohne dessen Vor- bzw. Entstehungsgeschichte mitzuberücksichtigen; es kommt dabei zu „Textinterpretationen, die die literarische und sachlich-theologische Komplexität der Texte, die sich gerade bei einer genauen Beobachtung der Schlußfassungen zeigt, nivelliert (sic!)“ (a.a. O., 372).
124 Vgl. Pohlmann, Studien zum Jeremiabuch (1978), 18.
125 Vgl. dazu z.B. Levin, Noch einmal: die Anfänge des Propheten Jeremia (1981).
126 Vgl. Ex 7, 7 mit Dtn 34, 7.
127 Vgl. dazu Kuhl, „Wiederaufnahme“ (1952).
128 Zu den genaueren Hintergründen vgl. Pohlmann, Hesekiel (2001), 495f.
129 Zu Einzelheiten vgl. Pohlmann, Ferne Gottes (1989), 132ff.
130 Levin, Verheißung (1985), 155, Anm. 29.
131 Vgl. ähnlich die Botenformel in Jer 6, 22, die jetzt die Klageaussagen (vgl. die „Wir-Rede“)in V. 24 u. 26 als Jahwewort deklariert.
132 Maier, Die Tempelrolle (1992), 11.
133 Zu Einzelheiten vgl. Pohlmann, Ezechiel (2008), 75–97.
134 Vgl. bes. in den buchkonzeptionell wichtigen Visionen Ez 1–3; 8–11; 37∗; 40ff. sowie Ez 38/39.
135 Vgl. z.B. Ez 20; 36, 16ff.; 37, 15ff.; 39, 25–29.
136 Vgl. Ez 1, 1; 3, 12–27; Ez 8–11∗; 24, 24–27; 33, 21ff.
137 Damit wird die Gruppierung bezeichnet, die mit König Jojachin 597 v.Chr. ins babylonische Exil verschleppt wurde; vgl. Ez 1, 1f.; 2. Kön 24, 12–16.
138 Ähnliche literarische, buchredaktionelle Prozesse sind auch in anderen Prophetenbüchern erkennbar; vgl. z.B. eine ebenfalls buchprägende golaorientierte Redaktionsschicht im Jeremia-Buch; s. dazu Pohlmann, Studien zum Jeremiabuch (1978); vgl. ferner Becker, Exegese des Alten Testaments (2005), 92f.
139 Kratz propagiert in seinen Ausführungen zur Frage der Redaktionsgeschichte der Prophetenbücher, es werde „zunehmend darauf ankommen, nicht nur jedes Prophetenbuch für sich zu betrachten, sondern analoge Erscheinungen in verschiedenen Büchern – wie etwa … (u.a.) gola –, diasporaorientierte Redaktionen … miteinander zu korrelieren und daraus literatur- und theologiegeschichtliche Entwicklungen zu rekonstruieren. Der rasche Durchgang durch die ‚Endgestalt‘… reicht dafür nicht aus“ (vgl. den Artikel „Redaktionsgeschichte“ [1997], 376).
140 Vgl. dazu Pohlmann, Ferne Gottes (1989), 1–111.
141 Unter dem Eindruck, dass hier der Prophet jeweils im Gebet vor Jahwe seine innersten Gedanken, seine Anfechtungen und Glaubenszweifel artikuliere, spricht man in der alttestamentlichen Forschung von den „Konfessionen“ Jeremias.
142 Vgl. besonders Jes 13, 9ff.; 30, 18–26; 59, 1–20; 65, 8–16; 66, 1–16; Jer 25, 30–38; Jer 30, 23f.; Zeph 3.
143 Vgl. zu Einzelheiten, Pohlmann, Jeremia als Identifikationsfigur im Frühjudentum (2003).
144 Die von Neuwirth vertretene Koranforschung z.B. führt dergleichen auf fortschreitende Kommunikationsprozesse zwischen Mohammed und seiner wachsenden Gemeinde zurück; vgl. dazu unten bei Anm. 145.
145 Vgl. zu Neuwirth bereits oben bei Anm. 81.
146 Vgl. Sinai, Fortschreibung (2009), X.
147 Der Koran als Text der Spätantike (2010), 243.