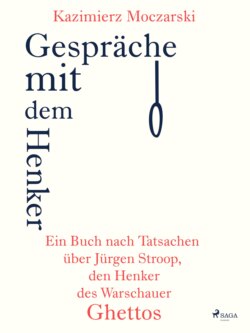Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Kapitel Auge in Auge mit Stroop
Оглавление2. März 1949. Abteilung XI des Warschauer Gefängnisses Mokotów. Eben brachte man mich in eine Zelle, in der schon zwei Männer sitzen. Kaum ist die Tür verriegelt, beginnen wir uns, wie bei Häftlingen üblich, vorsichtig zu »beriechen«. Innerhalb der Zellenordnung sind mir die beiden im Augenblick überlegen, denn ich wurde zu ihnen in ihre Zelle verlegt. Ich habe zwar gewisse Möglichkeiten: Um eine schützende Distanz zu schaffen, könnte ich »Salzsäule« oder »Mann vom Mond« spielen. Die beiden Männer wären nicht in der Lage, sich ähnlich zu verhalten, denn sie bilden eine wechselseitige Gemeinschaft.
»Sind Sie Pole?«, fragt der Ältere, mittelgroß, schlank, mit blau geäderten Händen, einem Kartoffelbauch und großen Zahnlücken. Er trägt eine feldgraue Jacke, Drillichhosen und Holzpantinen, das Hemd ist auf der Brust weit geöffnet.
»Ja. Und Sie? «
»Deutsche. Sogenannte Kriegsverbrecher.«
Ich richte mich notdürftig ein, stopfe meine wenigen Habseligkeiten in einen Winkel. Der Ältere hilft mir, ohne dass ich ihn dazu auffordere. Es herrscht angespanntes Schweigen. Also Deutsche, denke ich. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich auf engstem Raum mit ihnen zusammen sein. An solche Nazis erinnere ich mich noch aus der Besatzungszeit so deutlich, als wäre es gestern gewesen. Eine schwierige Situation, aber in Mokotów wurden Gefangene häufig ohne Rücksicht auf ihre Nationalität in eine Zelle gesperrt. Von ihnen trennen mich Welten – die Last der Vergangenheit ebenso wie die Weltanschauung. Uns verbindet nur das Dasein als Zellengenossen. Kann das allein einen Abgrund überbrücken?
Meine chaotischen Gedankensprünge werden jäh unterbrochen, denn die Gewohnheit, stets auf der Hut zu sein, signalisiert mir: Warum drückt sich der andere Nazi so schweigsam in die Fensterecke? Ist er gefährlich, oder hat er Angst?
Beim Unterbringen meiner Sachen hilft mir Gustav Schielke1 aus Hannover, viele Jahre kleiner Beamter bei der Sittenpolizei. Während des Krieges SS-Untersturmfuhrer, Archivar beim Befehlshaber der Sipo und SD in Krakau, das heißt beim Führer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Generalgouvernement.
»Schon verurteilt?«, frage ich ihn.
»Nein.«
»Lange im Knast?«
»In Polen 1 Jahr, 9 Monate, 27 Tage. Davor saß ich bei den Alliierten in Westdeutschland.«
Er zählt noch die Tage, malt wahrscheinlich Striche an die Zellenwand und hofft, später einmal seinen Enkeln vom polnischen Gefängnis erzählen zu können – denke ich.
Der andere, der mich etwas beunruhigt, ist hochgewachsen und wirkt auf den ersten Blick breitschultrig. Er steht mit dem Rücken zum Licht und verdeckt einen Teil des Fensters. Es ist schwierig, ihn zu beobachten. Ich kenne diese Methoden. Typischer Untersuchungsgefangenen-Komplex, aber er verhält sich richtig, stelle ich fest.
»Stroop«, stellt er sich endlich vor. »Mein Name ist Stroop, mit zwei ›oo‹. Vorname: Jürgen. Ich bin Generalleutnant oder divisiongénéral ... Enchanté, monsieur.« Er ist erregt, seine Ohren sind gerötet. Ich bin es wohl auch. Das Erscheinen eines unbekannten Häftlings und eine fremde Zelle können schon aufregend sein.
Kaum hatte ich meinen Namen genannt, als ein Kessel mit dem Mittagessen hineingeschoben wird. Essengeruch breitet sich aus. Die Kalfaktoren2, ebenfalls Deutsche, geben meinen Zellengenossen durch Zeichen zu verstehen, dass ich kein Spitzel bin. Sie kennen mich längst aus verschiedenen Begegnungen hier in Mokotów.
Stroop bekommt immer eine doppelte Portion zugeteilt. Er isst systematisch, mit Appetit. Das Essen verläuft schweigend. Ich bemühe mich, ganz entspannt zu kauen, um meine neuen Zellennachbarn nicht merken zu lassen, wie aufgewühlt ich bin.
Das also ist Stroop, der Vertraute Himmlers, SS- und Polizeiführer, Vorgänger des von uns hingerichteten Kutschera3, der Mann, der das Warschauer Ghetto liquidieren ließ? Er sitzt neben mir und verzehrt sein Mittagessen. Stroop ist etwa Mitte fünfzig. Auffallend sorgfältig gekleidet. Dunkelrote Windjacke, weißes Halstuch, kunstvoll unterm Kinn geknotet. Helle Hose. Dunkelbraune, leicht abgetragene, aber auf Hochglanz polierte Schuhe.
Schielke schaufelt das Essen in sich hinein. Er ist rasch fertig, summt vor sich hin: »In Hannover an der Leine haben Mädchen dicke Beine« und fragt wie nebenbei: »Sitzen Sie schon lange?« Ich antworte. Daraufhin schlägt er vor, mein Essgeschirr zu spülen. Ich muss sein Anerbieten ablehnen, denn diesen Gefallen nimmt man nur der Not gehorchend oder aus Freundschaft an. Stroop aß immer noch. Schließlich reichte er Schielke zwei Schüsseln zum Abwaschen. Dann lockerte er seine Hose und schloss sie mit einem Reserveknopf, den er sich »für alle Fälle«, je nach Bauchumfang, angenäht hatte.
Schielke säubert das Geschirr. Stroop sitzt, auf die Ellenbogen gestützt, das Gesicht in den Händen vergraben, am Fenstertisch. Zwischen den Fingern ragt seine fleischige Nase hervor. Die Haltung eines schmerzgebeugten Weisen.
Seine Denkerpose begann mich zu interessieren. Sie passte zu den Fotos und dem »Altar«, den sich Stroop auf dem Tischchen aufgebaut hat. Neben der Bibel lagen ein Päckchen Briefe aus der Bundesrepublik, einige Bücher, ein Heft, Bleistifte. Was mich am meisten verblüffte, war ein dreiteiliger Fotorahmen mit Aufnahmen von Stroops Familienangehörigen. Unter jedem Bild stand sorgfältig in gotischer Schrift: »unsere Mutter«, »unsere Tochter«, »unser Sohn« und »meine Frau«. In den Ecken des »Altars« kleine Andenken: die zarte Feder einer Blauracke und ein kleines, vertrocknetes Birkenblatt.
Stroops Nachdenklichkeit wirkt melancholisch, und ich frage ihn, worüber er sinniert. Ich nahm an, er würde antworten: »Das ist meine Privatangelegenheit«, was bedeutet hätte, dass er an seine Familie denkt und nicht gestört werden will. Aber Stroop entgegnete: »Ich habe vergessen, wie ein kleiner Vogel auf Polnisch heißt, mit dessen Namen man bei euch junge Frauen bezeichnet. Irgendwas mit schi ... schi ... schibka oder so ähnlich.«
»Wo haben Sie dieses Wort gehört?«
»Während eines Rundgangs, als Häftlinge aus den allgemeinen Untersuchungszellen eine weibliche Gefangene mit einem tollen Busen ansprachen, die in der Wäscherei arbeitet. Ich kann mir dieses Wort nicht merken, obwohl ich es jeden Tag wiederhole. Es klingt wie ›schibka, schtschirka‹ ...«
»Vielleicht riefen sie ›ścierka‹? Das ist aber kein Vogel.«
»Es war ganz sicher ein Vogel. Und bestimmt nicht ›schtscherka‹.«
»Da Sie auf einem Vogel bestehen, war es vielleicht ›sikorka‹?«
»Ja«, strahlte er auf, »schykorka, schykorka, die Meise. Dieses junge Ding aus der Wäscherei verdrehte den Hals wie eine Meise.«
»Wenn der General sich gestärkt hat«, röhrte Gustav Schielke, »wird er ganz geil nach so jungen Dingern. Die Zeiten sind vorbei, Herr General! Und außerdem, solange ich lebe, habe ich noch keine Meise mit Brüsten gesehen.«
Der General maß Schielke mit einem strengen Blick. Zum ersten Mal sah ich Stahl in den Augen Stroops aufblitzen.
In der Zelle befand sich ein einziges Bett, das tagsüber hochgeklappt und an der Wand festgemacht wurde (im Gefängnisjargon »Liegematte« genannt). Bisher hatte Stroop darauf geschlafen, während Schielke seinen Strohsack auf dem Boden ausbreitete. Gegen Abend mussten wir eine neue Schlafordnung aufstellen. Stroop wandte sich an mich: »Ich lege mich auf den Boden. Das Bett steht Ihnen zu, da Sie Angehöriger des hier herrschenden, also siegreichen Herrenvolkes sind.« Ich erstarrte. Stroop spielte keine Komödie, das war weder Höflichkeit noch Pose. Er hatte einfach seine Ansicht über die Art zwischenmenschlicher Beziehungen kundgetan. Die ihm seit Kindesbeinen eingetrichterten Eigenschaften, Anbetung der Macht und Unterwürfigkeit – das unvermeidliche Produkt blinden Gehorsams waren zum Vorschein gekommen.
Schielke pflichtete Stroop bei. Ich begründete meine Ablehnung mit der banalen Feststellung, dass während ihres Häftlingsdaseins alle Gefangenen gleich seien. Und bis zum letzten Tag meines Zellendaseins mit Stroop und Schielke schliefen wir alle drei auf dem Boden.
Kurz nach dem Meisen-Zusammenstoß mit Schielke bot mir Stroop an, seine Bücher durchzublättern. Er hatte mindestens 180 in der Zelle, die meisten aus der Gefängnisbibliothek. Alle in deutscher Sprache. Es waren wissenschaftliche Abhandlungen darunter, historische, geografische, ökonomische Werke, Schulbücher, Romane, Broschüren und sogar Propagandaschriften der NSDAP. Gierig griff ich nach allen Büchern – ein normaler Vorgang in einem Gefängnis. Anfangs blätterte ich die Texte, Abbildungen und Landkarten nur durch. Später las ich mich fest. Wir begannen zu diskutieren. Ich fraß Informationen über Deutschland in mich hinein und Kommentare der beiden Nazis zu verschiedenen, für einen Polen unverständlichen Vorgängen. Dabei vertiefte ich meine deutschen Sprachkenntnisse, lauschte den Berichten, Analysen und Meinungen und – was unvermeidlich war – mitunter auch persönlichsten Bekenntnissen.
Ich verfolgte aufmerksam die Erzählungen über deutsche Städte und Dörfer, über Berge, Täler und Wälder und erfuhr mehr über das Leben in den Städten und in einzelnen Familien. Ich nahm den Geruch der Küchen und Korridore wahr, der Esszimmer und Salons, der Kneipen und Gärten, der Feldschlachten und des Heimwehs. Ich, der ehemalige Soldat der polnischen Landesarmee4,5, begleitete Schritt für Schritt das Leben des Nationalsozialisten Stroop, folgte ihm und war gleichzeitig sein Gegner und sein Feind.
Jürgen Stroop. Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Ehemaliger Angehöriger des Preußisch-Detmold’schen Infanterie-Regiments. Mitbegründer der NSDAP im früheren Fürstentum Lippe. Im Gebrüll der Hitler umjubelnden Massen marschierte er durch die Straßen Nürnbergs. Mit tatkräftiger Unterstützung der SS klettert er, trotz einer mittelmäßigen Ausbildung, die Ämterleiter hinauf. Er ist in Münster und Hamburg tätig, regiert mit harter Faust, brutal und oft mörderisch – in der Tschechoslowakei, in Polen, in der Ukraine und im Kaukasus, in Griechenland, im westlichen Deutschland, in Frankreich und in Luxemburg. Er liebt seine Gattin und auch andere Frauen, aber nur seine eigenen Kinder, spricht mit Politikern des Dritten Reiches, mit Himmler und den Spitzen der SS. Seine Autos heißen »Horch« und »Maybach«. Er reitet über die Felder des Teutoburger Waldes und der Ukraine, trägt ein Monokel und sonnt sich in der Würde eines Nazi-Generals. Und nie wird er von Hitler oder Himmler anders sprechen als von »Adolf Hitler« und »Heinrich Himmler«; immer nennt er ihre Vornamen, womit er seine Treue und Ergebenheit gegenüber diesen »großen deutschen Gestalten des zwanzigsten Jahrhunderts« zum Ausdruck bringt. Ich folgte Stroop auch ins Warschauer Ghetto, obwohl es mir manchmal schwerfiel, seinen Berichten über die »Großaktion« in jenen April-Tagen zuzuhören. Denn ich spürte noch den Brandgeruch meiner im Jahre 1943 bezwungenen und zerstörten Stadt.
Und ich begleitete ihn auch während des Fememordes an Generalfeldmarschall von Kluge im Jahre 1944 und war bei der Liquidierung der in Kriegsgefangenschaft geratenen amerikanischen Flieger im westlichen Rheinland dabei.
Wir sprachen über viele Dinge, vor allem in den letzten Wochen unseres gemeinsamen Zellenaufenthaltes. Stroop war kein Schwätzer, aber er neigte dazu, viel von sich zu reden und sich selbst zu loben. Es waren die typischen Gewohnheiten eines Amtsträgers, die sich da bemerkbar machten. Er genoss es, ein Publikum zu haben. Jetzt waren Schielke und ich seine einzigen Zuhörer. Dieser Umstand erlaubte es mir, viele glaubwürdige, wenn auch nur mündlich weitergegebene Einzelheiten zu erfahren.
Stroop beschrieb sein Leben nicht chronologisch. Manchmal diskutierten wir stundenlang über ein einziges Problem. Ein andermal sprangen wir von Thema zu Thema. Ich bemühte mich, aus all diesen Gesprächen ein möglichst systematisch gegliedertes Buch zusammenzustellen. Gustav Schielke beurteilte manche Tatsachen und Ereignisse anders als Stroop. Er war psychisch geradliniger. In ihm waren noch Reste eines sozialdemokratischen Bewusstseins lebendig, Erinnerungen an die Bindung an Gewerkschafts- und Arbeiterkreise in seiner Jugend. Die von Schielke meist spontan, kaum bewusst geäußerten Überzeugungen bildeten einen Gegensatz zu Stroops Einseitigkeit. Sie waren auch eine Art Kontrollorgan und eine Ergänzung der Bekenntnisse Stroops. Anfangs war unser Verhältnis in der Zelle von Vorsicht und leiser Verwunderung geprägt, die sich aus der Ungewöhnlichkeit der Situation ergaben; später folgte ein diplomatisches Vorgehen und das Reden »zwischen den Zeilen« und schließlich das offene Artikulieren von Meinungen und Informationen.
Waren es ehrliche Gespräche? In den meisten Fallen gewiss, besonders als wir uns schon besser kannten. Angesichts des Unabwendbaren werden die Bekenntnisse von Todgeweihten ehrlich und einfach. Aber es war eine passive Offenheit, die darauf beruhte, alles zu vermeiden, was zufällig zum »Verzinken« des Mitgefangenen führen konnte. Außerdem herrschte in der Zelle das ungeschriebene Gesetz, grundsätzlich alle besonders kritischen Themen zu meiden oder sie zumindest behutsam zu behandeln.
Meinen Lesern gegenüber muss ich betonen, dass ich mich stets um größte Ehrlichkeit bemühte, um dadurch die volle Wahrheit über Stroop und sein Leben zu erfahren. Der Schock des Augenblicks, als ich mich plötzlich den zwei Nazis gegenüberfand, war rasch dem Entschluss gewichen: Wenn ich schon mit Kriegsverbrechern Zusammenleben muss, dann will ich sie genau kennenlernen, will versuchen, ihr Leben und ihre Persönlichkeit bis zur letzten Faser aufzudecken. Sollte mir das gelingen, so wäre ich in der Lage, wenigstens bis zu einem gewissen Grade mir selbst die Frage zu beantworten, welcher historische, psychologische und soziologische Mechanismus einen Teil der Deutschen zu Massenmördern werden ließ, die das Dritte Reich beherrschten und ihre »Neue Ordnung« in Europa und in der Welt einzuführen gedachten.
Ich befand mich also während meines fast neun Monate dauernden Aufenthaltes in Stroops Zelle Auge in Auge mit einem Massenmörder. Unsere Beziehungen verliefen im Rahmen einer eigentümlichen Loyalität. Obwohl es mir anfangs schwerfiel, bemühte ich mich, in Stroop nur den Menschen zu sehen. Er hatte meine Haltung begriffen, obwohl ich immer wieder meine Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber der Ideologie, der er diente, und den Handlungen, die er begangen hatte, nachdrücklich unterstrich. Stroop seinerseits versuchte nicht, einen Freund der Polen zu mimen und seine eigenen Taten zu verurteilen.
Diese gemeinsam verbrachte Zeit wurde zum Impuls und lieferte das Quellenmaterial für dieses Buch. Das Bild, das ich hier zeichne, ist gewiss nicht vollständig. Und es ist nicht frei von meinen eigenen Kommentaren, obwohl ich versucht habe, sie zu vermeiden.
Gebe ich den Sinn der Worte und der Verhaltensweisen von Stroop und Schielke wahrheitsgetreu wieder? Ich glaube schon. Umso mehr, als ich mir kurz nach Verlassen des Gefängnisses Aufzeichnungen gemacht habe und einige Aussagen Stroops in den Archiven und den mir zugänglichen historischen Dokumenten überprüfte. Nirgends fand ich einen Hinweis, dass Stroop in unseren Gesprächen die Unwahrheit gesagt oder Schönfärberei betrieben hätte.
Bestimmte Teile der »Gespräche mit dem Henker« könnten zu Missverständnissen führen. Sollte dies der Fall sein, so ließen sie sich meiner Meinung nach nur damit erklären, dass es dem Leser unmöglich ist, seine Erfahrungen und seinen Wissensstand mit den hier beschriebenen Tatsachen gleichzusetzen; oder mit meiner subjektiven Unfähigkeit, diesen Bericht niederzuschreiben. Ich betone: Bericht; denn im Falle dieses Buches scheint mir jegliche literarische Fiktion unpassend.
Noch eine Anmerkung zu den Dialogen, die in einigen Kapiteln der »Gespräche mit dem Henker« vorkommen. Möglich, dass es zu viele sind. Aber mein 2556 Tage währendes Leben in dem Dreieck »Stroop, Schielke und ich« (nur für kurze Zeit war ein vierter Mitgefangener dabei) setzte sich aus Dialogen zusammen, jener Grundform sprachlicher Kontakte in kleinen Zellen. Warum sollte ich mich dieser Form nicht bedienen, da es um die Wahrheit geht?