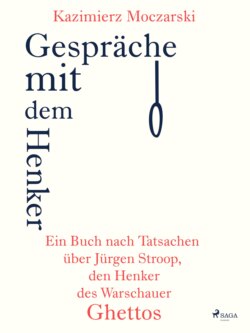Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII. Kapitel Gehorsam, satt und würdevoll
ОглавлениеNach vierzehn Jahren Mühe und Erwartung hatte sich endlich vor Joseph Stroop das Tor zur Karriere geöffnet. Künftig wird er die Chance wahren, die ihm der Sieg der NSDAP in Lippe geboten hat. Er wird die Spitzenpositionen des »Schwarzen Korps« erstürmen; das Korps wird seine Karriere und seine Existenz absichern. Himmler persönlich war auf Stroop während der Wahlen zum lippischen Landtag aufmerksam geworden. Er wird Stroop nicht vergessen (Treue um Treue!) – und ihn entsprechend ausnutzen.
Vorläufig war die Zeit für Beförderungen noch nicht reif – die NSDAP hatte gerade mit dem Umwandeln des Reiches begonnen.
»Ich wurde in Lippe gebraucht. Wir mussten das Land durchkämmen«, erinnerte sich Stroop, »die Schmarotzer und Feinde der nationalen Revolution herausfischen und die errungene Macht festigen.«
Hitlers Gefolgsleute nahmen sich vor allem die SPD und die KPD vor. Etwas sanftere Methoden wandte man gegenüber der Zentrumspartei an. Immer offener wurde die Reaktion umworben. Vor allem aber ging man daran, die ersten Abschnitte des antijüdischen »Programms auf Raten«, wie Stroop es nannte, zu verwirklichen. Die »Arisierung« des Grundbesitzes wird eingeleitet, die jüdische Intelligenz immer brutaleren Verfolgungen ausgesetzt. Rücksichtslose Plünderungen, Kennzeichnungen durch Judensterne, physische Vernichtung und Ausrottung werden »zu gegebener Zeit« folgen.
Einen wesentlichen Teil dieser »dringenden Aufgaben« führt Stroop in Lippe-Detmold als Leiter der dortigen Hilfspolizei durch. Gleichzeitig übernimmt er den Ausbau und die Schulung der SS-Kader. Es ist eine ruhige Arbeit. Stroop mag kein »verrücktes« Improvisieren, wie es die Jahreswende 1932/33 erfordert hatte. »In Lippe war im Allgemeinen alles gut verlaufen«, erzählte er.
»Nur einmal hatten wir Probleme mit einem großen Teil der öffentlichen Meinung ...«
»... Habt ihr sie wirklich ernst genommen? Sie scherzen wohl!«, unterbrach ich ihn.
»Doch«, meinte Stroop, »denn wenn so viele dagegen sind, gibt es meist Schwierigkeiten.«
»Worum ging es denn der öffentlichen Meinung?«
»Um die Unabhängigkeit von Lippe, das, wenn es auch klein war, seit Jahrhunderten ein selbstständiges Land innerhalb Deutschlands gewesen war. Und plötzlich hatte man uns einen Reichsstatthalter vor die Nase gesetzt. Und zwar keinen, der nur für unseren Freistaat zuständig gewesen wäre, sondern einen gemeinsamen für Lippe-Detmold und Lippe-Schaumburg. Die Einwohner waren empört, viele fühlten sich aufs Äußerste verletzt.«
»Sie auch?«
»Auch ich war nicht ganz zufrieden. Schließlich war ich in der Tradition einer halb souveränen Autonomie unseres Ländchens aufgewachsen, obgleich ich heute verstehe, dass die Politik der Kleinstaaterei dem Reich ausnahmslos geschadet hat.«
»Wissen Sie, dass Lippe seit Kriegsende wieder in gewisser Weise selbstständig wurde? Nicht so wie zur Kaiserzeit oder in der Weimarer Republik, aber die Alliierten und Adenauer haben einen Zustand wiederhergestellt, der dem Jahr 1932 ähnelt.«
»Das geht mich nichts an«, reagierte Stroop gereizt.
»Mögen Sie die Freiheit nicht?«
»Diese Freiheit? Nein.«
»Schließlich sitzen Sie auch im Knast.«
»Sie aber auch.«
»Ja, aber ich achte jede Art von Freiheit.«
Die Lage Stroops entwickelt sich in den Jahren 1933/34 günstig und vielversprechend. Er hat enge Beziehungen zu höhergestellten Nazis. Man hält große Stücke auf ihn. Er ist fleißig, sorgt für die Parteiorganisation und vergisst dabei auch seine eigenen Interessen nicht, was in jener Zeit allgemein üblich war.
Ein einschneidendes Erlebnis, auf das Stroop im Gefängnis immer wieder zu sprechen kam, war die »Siegesparade« in Nürnberg im Herbst 1933. Als noch junges NSDAP-Mitglied reagiert er begeistert, wie die meisten Bewohner des Lippelandes, auf die Feierlichkeiten, Aufmärsche, Appelle und Ansprachen, die Anwesenheit des Führers und seines Stabes, auf Fahnen, Standarten, Ströme von Bier und Berge von Würsten und auf den »ruhig-festen Schritt«. Bis zum Rand seiner schwarzen SS-Mütze hat er in Nürnberg den »historischen Sieg« in sich aufgesogen.
»Aus Nürnberg brachte ich ein bis aufs Blut aufgescheuertes Bein mit«, erinnerte sich Stroop in der Zelle. »Für die Herbstparade 1933 hatte ich mir neue Stiefel anfertigen lassen. Der Schuhmacher nahm für die Ferse zu hartes Leder. Als ich wieder in Detmold war, habe ich ihm in die Fresse geschlagen, obwohl er beteuerte, unschuldig zu sein. Er sagte: ›Herr Truppführer, Sie sind nicht zur Anprobe gekommen und befahlen, die gerade fertig gewordenen schwarzen Marschstiefel sofort zu schicken‹ ... Und trotzdem war dieser elende Schuster schuld. Anprobe oder nicht. Die Lieferung von unbequemen Stiefeln für eine Parade ist Sabotage.«
Stroop wird zum Offizier der SS befördert. Diese Ernennung ist jedoch von Schwierigkeiten begleitet. Die Kameraden vom SS-Abschnitt Münster verlangen, dass Stroop wie alle anderen Rang um Rang befördert wird. Stroop dagegen ist der Meinung, seine Verdienste bei den Wahlen in Lippe rechtfertigten eine Beförderung außer der Reihe. Er gibt sich trotzig, erinnert an die Karrieren verschiedener »Schnösel«, wie er sie nannte, die schon längst SS-Hauptsturmführer waren.
Schließlich interveniert Himmler, den Stroop »ganz zufällig« traf. Der »treue Heini« wundert sich, dass der in den lippischen Wahlen hochverdiente Stroop nur SS-Truppführer ist. Er befiehlt, das Unrecht wiedergutzumachen und Stroop um drei Ränge – einen Unteroffiziers- und zwei Offiziersgrade – zu befördern; im März 1934 wird Stroop zum SS-Hauptsturmführer ernannt, was beim Heer dem Hauptmannsrang entspricht.
»Das war eine große Sache für mich.« Stroop gerät ins Schwärmen. »Ich habe mir sofort eine neue Uniform angeschafft. Schwarze Stoffpatten am Kragen, mit Aluminium eingefasst. Links zwei glänzende Spiegellitzen und drei viereckige Sternchen. Rechts ein silbernes Achselstück.«
Seine Frau ist hingerissen. Die Mutter ebenfalls, wenn auch etwas gedämpfter. Mutti hätte es lieber gesehen, wenn Joseph Hauptmann der Wehrmacht geworden wäre.
Stroop hat beste Verbindungen zur Führung des heimatlichen XVII. SS-Abschnitts, dessen Hauptquartier sich in Münster befindet. Zu diesem Abschnitt gehören drei SS-Standarten: 19, 72 und 82.
Im Jahre 1934 zieht das Ehepaar Stroop mit der sechsjährigen Tochter Renate nach Münster.
Als Stabschef des XVII. SS-Abschnittes steckt Stroop im Zentrum der politischen und organisatorischen Parteiarbeit im Bereich Münster. Er hat Zutritt zu allen SS-Karteien, den geheimen und öffentlichen. Er nimmt Meldungen und Berichte entgegen, feuert an, bildet aus, kommandiert, beurteilt und »lernt« Politik. Er regiert mit harter Faust, ist streng und peinlich genau, gestattet sich und anderen kein Mitleid und kein Nachgeben. »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!« Zugleich ist er bemüht, einen eleganten, gebildeten und würdevollen Eindruck zu machen. Seine Umgebung spürt, dass er mächtige Gönner hat. Man weiß, dass er Hitler, Himmler, Göring persönlich kennt. Von Göring sagt er »unser Hermann«. Die SS-Kameraden nehmen den zurückhaltenden Detmolder ernst, der auf Schritt und Tritt zu verstehen gibt, dass er etwas darstellt.
»Erst in Münster hat man mir eine anständige Uniform angefertigt. Die hatten bessere Schneider. Und meine Reitstiefel waren damals ein Gedicht!«
»Wechselten Sie oft die Unterwäsche?« frage ich ihn.
»Jeden Tag. Und gebadet habe ich auch täglich, wie ein Gentleman.«
»Haben Sie auch täglich Parfüm benutzt?«
Er nickte. »Nach dem Bad muss man sich immer mit Kölnisch Wasser einreiben.«
Stroop muss damals eine Kreuzung zwischen einem »Revolutionär« und einem hochnäsigen Gutsbesitzerssohn gewesen sein, denke ich. So etwas ist keine Seltenheit bei einem Streber, auf dessen Schultern »die Last der Idee, des Volkes und Staates« ruht. Und der manchmal von Verhören in den Hinterzimmern der SS-Quartiere direkt in die Arme der gepflegten Gattin zurückkehrt und liebevoll sein Kind streichelt.
In Münster kommt 1934 Stroops erster Sohn Jürgen zur Welt, der jedoch nach wenigen Tagen stirbt. Stroop ist verzweifelt, er wirft seiner Frau vor, am Tod des Kindes schuld zu sein. Noch 1949, im Gefängnis, wirft er seiner Frau vor, sie »hätte es nicht fertig gebracht, seinen Erstgeborenen ordentlich zur Welt zu bringen«. Viele Jahre später spielt er den Tod des Kindes, der für ihn eine »heilige Erinnerung« ist, im politischen Sinne aus. Als Stroop im Jahre 1941 den Antrag auf Namensänderung von Joseph auf Jürgen stellt, begründet er diesen Schritt schriftlich unter anderem mit dem Tod Jürgens im Jahre 1934. Das tote Kind muss die These von der weltanschaulichen Sauberkeit des Vaters stützen. Denn Jürgen ist ein »rein germanischer« Name.
Aus den Erzählungen Stroops über die Zeit, in der er eine immer gewichtigere Rolle zu spielen beginnt, ist mir sein Bericht über einen Besuch beim Erzbischof von Münster, Clemens August Graf von Galen1, besonders in Erinnerung geblieben.
Es war im Jahre 1934. Erzbischof Graf von Galen hatte soeben die NS-Rassenlehre verurteilt und die Sterilisation für verwerflich erklärt. Seine Beziehungen zur NSDAP waren denkbar schlecht.
»Der Bischof von Galen war ein richtiger Herr, ein wahrer Aristokrat, der Typ eines Kirchenfürsten der Renaissance«, erzählte Stroop. »Er empfing uns höflich, aber stolz.«
Aus dem Bericht Stroops ging hervor, dass er gemeinsam mit einem Verwandten des Erzbischofs, einem Mitglied der SS-Führung in Münster, von Galen aufgesucht hatte, um Näheres über dessen Ansichten zu erfahren und, wie ich glaube, in der Absicht, dem Erzbischof inoffiziell zu drohen, man würde Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben, die scheinbar kompromittierend für Priester und Klostergeistliche waren – falls von Galen sich nicht »beruhigen« sollte. Es ging, wie Stroop meinte, um irgendwelche sittlichen Verfehlungen von Geistlichen, Mönchen und Nonnen, um Devisenvergehen und die Auslegung des Eigentums- und Besitzrechts der Kirche.
Der Erzbischof war liebenswürdig in seinem Auftreten, zugleich aber angriffslustig und herrisch. Der Anfang der Audienz verlief angenehm, denn von Galen sprach von den Verdiensten von Stroops Mutter, einer aktiven Katholikin aus Detmold. Im Verlauf des Gesprächs, das immer mehr einer theoretisch-weltanschaulichen Diskussion glich, ließ sich von Galen nicht von der Richtigkeit der ideologischen Höhenflüge Rosenbergs überzeugen. Er verurteilte entschieden das Gesetz zur Verhütung von erbkrankem Nachwuchs und geißelte alle Versuche, die altgermanische Religion einzuführen. Die Hochzeitsfeiern vor Wotan-Altären und Holzfeuern fand er lächerlich. Die Riten bei Beerdigungen von Bauern, die der SS angehörten, wobei deren Asche auf den Feldern ausgestreut wurde, kritisierte er besonders scharf.
»Von Galen muss gewusst haben, dass ich einige Tage zuvor an einem SS-Begräbnis teilgenommen hatte«, erläuterte Stroop diesen Teil des Gesprächs. »Es war eine erhebende Feier. Ein westfälischer Bauernhof. Der Vater des Hofbesitzers, eines SS-Mannes, war gestorben. Der Sohn holte die Asche aus dem Krematorium, versammelte seine Familie und seine Freunde, legte die Jacke und die SS-Mütze ab, band eine große Säer-Schürze um, schüttete die Asche des Vaters hinein und ging aufs Feld hinaus, wobei er alle paar Schritte eine Handvoll Asche ausstreute. Aus Erde war er gekommen, zur Erde kehrte er wieder. Ein wunderbarer Brauch. Anschließend wurde eine Feier veranstaltet, nach altgermanischer Sitte. Galen wusste, dass ich dabei gewesen war. Aber woher? Da sehen Sie, was für einen gut funktionierenden Geheimdienst diese Jesuiten haben. Einmal wurde Galen wütend«, fügte Stroop hinzu, »und zwar als er von Gelüsten sprach, den Kirchenbesitz anzutasten.«
Als sich die Offiziere anschickten, den Audienzsaal des Erzbischofs zu verlassen, erklärte von Galen (ich gebe die Worte Stroops wieder):
»›Eines kann euch die Kirche, unser aller Mutter, nicht vorwerfen – Mangel an Patriotismus. In vieler Hinsicht seid ihr leichtfertig und irregeleitet. Aber das Vaterland eint alle, ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit. Eure Partei und Reichskanzler Hitler regieren Deutschland. Wir deutschen Katholiken‹, fuhr Galen fort, ›beten stets für unser Volk, die Regierung, das Vaterland und den Führer. Als erster deutscher Bischof habe ich im Oktober 1933 vor Göring meinen Treueeid abgelegt. Vergessen Sie das nicht, meine Herren. Auf Wiedersehen!‹«
»Wie also war Erzbischof von Galen Ihrer Meinung nach?« frage ich Stroop. »War er für oder gegen euch?«
»Galen bekämpfte einige unserer Reformen, besonders auf dem Gebiet der nationalsozialistischen Moral. Er war ein Anhänger des Papsttums, gleichzeitig aber auch Nationalist!«
»Und Chauvinist«, warf Schielke ein.
»Chauvinismus ist die geballte Liebe zum eigenen Volk. Ein guter Deutscher muss Chauvinist sein.«
»Wie also war Galen?«
»Ein guter, weil mustergültiger Nationalist. Aber mit dem deutschen Nationalismus verband er gleichzeitig die Idee und Politik des Papsttums, die Deutschland jahrhundertelang viel gekostet hat. Das Führungszentrum, dem von Galen sich untergeordnet hatte, lag außerhalb der Grenzen Deutschlands und deshalb hat uns Galen letzten Endes doch geschadet. Aber nicht allzu sehr.«
Stroop begann sich in Einzelheiten zu verlieren. Er umkreiste mit gleichmäßigen Schritten die Zelle, deren farbliche Tönung an jenem Nachmittag an Bilder von Renoir erinnerte. Die untergehende Sonne warf flache, blassrosa Strahlenbündel durch das vergitterte Fenster. Sobald Stroop aus dem Schatten in die schmalen Lichtstreifen trat, nahm seine rötliche amerikanische Jacke an einigen Stellen die Farbe frischen Blutes an. Die wechselnde Licht- und Farbszene begleitete Stroops Ausführungen über den deutschen Katholizismus, die Reformation, den Glauben der Germanen usw., im Spektrum der Ansichten von Ludendorff, Rosenberg2, Streicher3 und vor allem Hitler. Aus der Flut dieser Meinungen und Konzeptionen will ich einige herausgreifen.
»Pacelli4, der böse Geist Papens, der einzige Ausländer in Deutschland mit tatsächlichem, großem Einfluss.«
Überhaupt: »Die katholische Kirche ist eine in tiefster Konspiration arbeitende Weltgemeinschaft, eine Clique, ein Orden, ein Bündnis der verschiedensten Gruppierungen, die nur scheinbar miteinander verfeindet sind. Diese Elemente können sich sogar gegenseitig bekämpfen, aber in allen wesentlichen Fragen werden sie immer gemeinsam vorgehen oder sich zumindest gegenseitig unterstützen. Das Beispiel des letzten Krieges beweist es. Im Jahre 1943 sagte mir Heinrich Himmler, er habe sachliche Beweise für eine enge Zusammenarbeit der Mitglieder des engsten Stabes des Papsttums mit der tief im Untergrund arbeitenden Führung der Freimaurer. Diese, wie man annehmen sollte, ungewöhnliche Zusammenarbeit hatte die vollständige Vernichtung Deutschlands durch den Krieg zum Ziel.«
Stroop gab auch seine Ansichten über das Christentum zum Besten, das, seiner Meinung nach, »nicht nur eine Gemeinschaft der vom Judaismus durchdrungenen Religionen, sondern eine Institution ist, die aus jüdischen Anregungen entstanden ist«.
»Und Christus?« frage ich.
»Christus war ein sehr kluger Mann. Ein Philosoph, Romantiker. Rassisch gesehen: halbnordisch. Seine Mutter war Tempeldienerin und besaß das Wohlwollen eines wichtigen Priesters. Sie wurde von einem Soldaten, einem blonden Germanen, geschwängert, einem Angehörigen jener germanischen Stämme, die von den Karpaten nach Süden bis Kleinasien zogen. Deshalb war Christus blond und unterschied sich auch psychisch von den Juden, die seine Lehre für ihre Ziele »umfrisierten« und anschließend auf den internationalen Markt warfen, um die Menschen durch das Einimpfen von Schuldgefühlen weich zu machen und zu erniedrigen.«
Ich hörte geduldig zu, ohne ihn zu unterbrechen. Einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, nichts, gar nichts vom Leben zu wissen.
Während des einen Jahres in Münster (Mai 1934–Juni 1935) wurde Stroop endgültig in die SS-Elite aufgenommen. Im Stab des XVII. SS-Abschnittes brachte man ihm »ideologische Erkenntnisse« bei, dazu die Geheimnisse der Parteibürokratie und die »höheren Methoden« bei der Durchführung von Verhören und der Anwendung von Terror.
Wahrscheinlich hier in Münster setzte bei Stroop jener rasche Deformierungsprozess ein, den man immer dort feststellen kann, wo eine plötzliche Verbesserung der Lebensbedingungen eintritt; sie ist Menschen mit einem unterentwickelten Intellekt, einem unscharfen Verstand und wenig gefestigtem Charakter eigen; diese verbesserten Lebensbedingungen werden begleitet von Privilegien und einer Entfremdung gegenüber dem gewohnten Milieu.
»Kaum etwas hat die Nazis, besonders die Angehörigen der SS-Stäbe, so von der Bevölkerung isoliert«, meinte Schielke, »wie die vier Autoreifen. Damals gab es im Reich noch verhältnismäßig wenige Autos, aber diese Leute waren ständig mit ihren Wagen unterwegs. Verdeckte Einkünfte und geheime Prämien haben die SS-Führer rasch verändert. Eigene Versorgungsquellen durch die NSDAP, eigene Schneider und Schuhmacher, Heime der SS, Krankenhäuser, Hotels, Kurorte, Klubs nordischer Menschen, getarnte Bordelle des ›Lebensborn5‹ – alles das entfremdete sie dem Volk. Als ich jung war, sagten mir Sozialdemokraten oft, ›das Sein prägt das Bewusstsein‹. Und sie hatten damit wohl Recht«, schloss Schielke.
Am Ende seiner Stabstätigkeit in Münster wird Stroop zum SS-Sturmbannführer (Major) befördert und anschließend auf einen wichtigen Posten nach Hamburg versetzt. Es ist Juni 1935, als Stroop die Führung der 28. SS-Standarte (Regiment) in dieser großen Hafenstadt, dem Zentrum von Handel und Industrie, übernimmt. Eine Hansestadt mit einem liberalen Bürgertum und einem seit langem organisierten Proletariat, vor allem unter den Werftarbeitern und Matrosen. Hamburg war eine schwierige Stadt für die Nazis, sie erregte ihr Misstrauen. Man musste sie mit Schlägereinheiten überziehen. Eine dieser Einheiten führte Stroop.
»Unser Hauptquartier lag nicht in den historischen Grenzen Hamburgs, sondern in der Vorstadt Altona, einer damals selbstständigen preußischen Stadt, die von der Freien Hansestadt Hamburg unabhängig war«, erzählte Stroop.
»Sie als Führer der 28. SS-Standarte herrschten also in Altona?«
»Auf Altona brauchten wir nicht besonders aufzupassen. Unsere Aufmerksamkeit richtete sich auf das Zentrum von Hamburg und den Hafen- und Industriebereich.«
Ich war bereits im Bilde und begriff, worum es ihm ging. Die 28. SS-Standarte war offensichtlich als Interventionseinheit gedacht, die da zuschlagen sollte, wo sie gerade gebraucht wurde. Wie ein bissiger Hund. Er wurde von der Leine gelassen, wenn die Interessen der NSDAP in Gefahr waren. Allein das Wissen, dass die 28. SS-Standarte wacht, musste auf einen Teil der Hamburger Bevölkerung beruhigend wirken.
Stroop, der ähnlich wie die Mehrzahl der SS-Führer nicht mit zahllosen Alltagspflichten und politischen Aktionen beschäftigt war, hatte andere Aufgaben. Unter anderem musste er Schulungen durchführen. Bei ihm in Altona wurden Lehrgänge abgehalten, ideologische Schulungen, »Diskussionen«, Übungen usw. Dort wurde auch ein religiös-germanisches Zentrum errichtet. Stroop erzählte:
»Unsere Wissenschaftler hatten in der Nähe von Bardowick Reste eines urgermanischen Holzbaus entdeckt. Wir haben ihn nach Altona gebracht und rekonstruiert. Aber es gab Probleme. Die Brandschutz-Bestimmungen Hamburgs verboten die Errichtung von Häusern aus leicht brennbarem Material. Die Hamburger Bürokraten schützten gesetzliche Bestimmungen vor und erlaubten uns nicht, einen Holzbau zu errichten. Wir mussten eine Menge Geld ausgeben, um jeden Balken, jedes Brett und jede Dachschindel mit einer besonderen Flüssigkeit feuersicher zu imprägnieren. Dazu mussten wir hoch bezahlte Fachleute einstellen, aber schließlich wurde alles so gemacht, wie wir es haben wollten.«
In einem wunderschönen Park, inmitten von Eichen, wurde ein historischer Bau errichtet ...
»Wohl euer Tempel?«
»Jawohl. Wir statteten ihn mit Dingen aus, die alten germanischen Kultgegenständen nachgebaut waren. Es gab einen Saal mit einer offenen Feuerstelle und einem an Ketten hängenden Metallkessel. In diesem Saal wurden Trauungen nach germanischem Ritus durchgeführt, wir versammelten uns dort ...«
»Zu Gottesdiensten?«
»Na, nicht gerade zu Gottesdiensten, aber es war etwas Ähnliches. Versammlungen, SS-Tagungen und so weiter.«
Schielke hörte interessiert zu, wurde aber immer unruhiger. Sein angeborenes Gefühl für Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ließ ihn schließlich explodieren: »Wozu zum Teufel habt ihr für teures Geld diese Pseudokirche aufgebaut?!«, brach es aus ihm heraus. »Allein das Imprägnieren des Holzes kostet zehnmal so viel wie das Errichten eines modernen Gebäudes! Die Menschen mussten damals schwer arbeiten, oft für einen Hungerlohn, und ihr habt Tausende von Brettern und Schindeln mit kostbarer Flüssigkeit getränkt, einfach so zum Vergnügen! Verrückte Verschwender!«
In der Zelle kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, die zur Folge hatte, dass Stroop und Schielke mindestens drei Tage lang kein Wort miteinander sprachen. Ich spürte, dass Schielke sich endlich als ein selbstständiger Mensch zu fühlen begann. Wenigstens für eine Weile schien er sich aus der den Deutschen angeborenen Bewunderung für einen Generalsrang gelöst zu haben. Das konnte für ihn den Durchbruch bedeuten.
In Altona bewohnt Stroop die Hälfte einer großen Villa. Ein Wagen steht ihm zur Verfügung, er hat Geld, ist gepflegt, die Köchin kocht ausgezeichnet. Die Tochter wächst, sie ist bereits acht. Im Februar 1936 bringt seine Frau einen Sohn, Olaf, zur Welt. Stroop ist stolz und glücklich. Endlich hat er den sichtbaren Beweis, auch ein guter Zuchthengst zu sein. Seit einiger Zeit beteiligt er sich zwar an der Aktion »Lebensborn«, aber es ist ein großer Unterschied, ob man einen eigenen Sohn mit dem skandinavischen Namen Olaf hat oder am Gedeihen einer SS-Nachkommenschaft mit Hilfe geheimer Lebensborn Praktiken teilnimmt. Die Treffen im »Lebensborn« vermitteln zwar das prickelnde Gefühl eines Ehebruchs, sie haben den Nachgeschmack heimlicher Hotel-Abenteuer, befriedigen verbotene Sinnlichkeit und schaffen Gelegenheiten zu einem offiziellen, wenn auch geheim gehaltenen Abenteuer mit der Bürosekretärin – aber das alles bedeutet nichts im Vergleich zu dem Bewusstsein, mit der eigenen Ehefrau im eigenen Bett und in der eigenen Wohnung einen Sohn gezeugt zu haben. »Wusste Ihre Frau, dass Sie im ›Lebensborn‹ waren?« »Sie hat es niemals erfahren.«
1936 ist für Stroop ein Jahr des Erfolges und der Zufriedenheit. Er hat einen Sohn, und zwei Monate nach Olafs Geburt wird er zum SS-Obersturmbannführer (Oberstleutnant) befördert. Anschließend schickt man ihn zu einem vierwöchigen Reitlehrgang in die SS-Reitschule in Forst an der Lausitzer Neiße.
Ich sprach schon davon, dass Stroop ein Pferdenarr und ein leidenschaftlicher Reiter war. Der Aufenthalt in Forst bedeutet für ihn Erholung, es ist eine Zeit der Entspannung, auf die er immer wieder zu sprechen kam. In der Zelle zeigte er uns, wie man einen Sechsspänner lenkt, wie man Achten und Schnörkel fährt, mit der Peitsche umgeht. Und alles in wettkampfmäßigem Tempo. Seine Augen strahlten, die Wangen röteten sich, seine Bewegungen wurden elegant und präzise.
Manchmal, als meine er den Schimmel ganz links außen, stieß er einen so lauten Schrei aus, dass der Wärter an die eiserne Zellentür klopfte und wir notgedrungen in tiefem Schweigen die Fahrkünste Stroops verfolgen mussten.
Von Hamburg aus wurde Stroop zum Erlernen der russischen Sprache in die SS-Zentrale nach Berlin geschickt. Schon damals begann man ihn für seine künftige Tätigkeit im Osten zu schulen. Stroop War jedoch sprachlich so unbegabt, dass er bis auf einige primitive Redewendungen kein Wort Russisch lernte. Aber man hatte ihm befohlen, Russisch zu lernen, also paukte er.
Im Herbst 1937 betritt Stroop den exklusiven Elitekreis der SS. Er wird zum SS-Standartenführer (Oberst) befördert. Endlich gehört er zu den »Eichenlaubträgern«. (Alle SS-Offiziere vom Standartenführer aufwärts trugen auf beiden Kragenspiegeln der Uniform Rangabzeichen, die sich aus verschiedenen Kombinationen von Eichenblättern zusammensetzten und manchmal mit einem viereckigen Stern ergänzt wurden. Nur Himmler war ein mit einem Lorbeerkranz eingefasstes Eichenlaub vorbehalten.)
Er gehört also jetzt zu den Eichenlaubträgern. Der Sprung in den Ring der Partei-Aristokratie ist vollzogen. Er führt weiterhin die 28. SS-Standarte in Hamburg-Altona. Das Söhnchen gedeiht prächtig. Renate wächst und versucht, Olaf zu bemuttern. Die Wohnung ist wunderbar. Die Einrichtung wurde ausgewechselt.
»Die neuen Möbel hatte ich von einem deutschen Kaufmann erworben, der wahrscheinlich jüdischer Abstammung war«, berichtete Stroop. »Er hatte einen ausländischen, ich glaube südamerikanischen Pass und wickelte in Hamburg verschiedene Geschäfte ab, eigene und die von Emigranten. Meine Leute hatten ihm bei irgendetwas geholfen. Er bat, ich möchte ihm die Möbel abkaufen, weil er es eilig hatte. Ich habe sie ziemlich billig gekriegt, und schon am nächsten Tag hatte sich der große Unternehmer in Hamburg eingeschifft.«
Stolz und selbstzufrieden erzählte Stroop von Hamburg, von Empfängen, Bällen und Abendgesellschaften. Von den Museumsbauten der Partei. Von der Hamburger Gesellschaft, das heißt von den Werftkönigen, den Übersee-Transportmagnaten, den Großkaufleuten der Hansestadt, den Bankiers, Ingenieuren, Ärzten, Gelehrten und Schriftstellern. Vor allem aber schilderte er uns den Reichtum und die Pracht der Stadt. Ich nehme an, dass dies ihm an Hamburg am meisten gefiel und sich deshalb tief in sein Gedächtnis eingegraben hatte. Dieser Luxus während der Empfänge im Stadtrat, in den Chefetagen der Konzerne und Aktiengesellschaften! Die Herolde in hanseatischen Trachten, die mit Fanfaren die Ankunft der Würdenträger in den Sälen des Rathauses ankündigten! All die Getränke, das Obst, das Fleisch, die Frauen, die Roben, der Schmuck und die Autos! Er war hingerissen von diesen Äußerlichkeiten des Lebens; und je kostbarer und üppiger, umso »schöner« schien ihm alles.
Seine finanziellen Probleme sind bestens geregelt. Seine Frau ist stets elegant gekleidet und lässt sich für die Geburt des Sohnes mit Glitzerkram verwöhnen. Man reist in Kurorte. Die Stroops führen ein sorgloses Leben, obwohl – wie aus den Erzählungen Stroops im Gefängnis hervorging – beide fühlen, dass sie sich trotz allem nur am Rand der Hamburger Gesellschaft bewegen, auch wenn die Mächtigen und Tonangebenden der Stadt das Ehepaar Stroop höflich anlächeln. Höflich, aber reserviert.
Und Stroops Beziehungen zum Hamburger Proletariat? Er sprach selten davon. Vielleicht hatte er nur wenig unmittelbaren Kontakt zu Arbeiterkreisen. Auf meine diesbezügliche Frage murmelte er, die SS hätte mit den Arbeitern in Hamburg keine Schwierigkeiten gehabt, der Prozess der Eingliederung in den Nationalsozialismus sei glatt verlaufen, die Dock- und Werftarbeiter und die Matrosen hätten Hitler »voller Freude« empfangen usw.
Als ich Stroop eines Tages fragte, ob er gegen die Nazis gerichtete Zeitungen und Broschüren gekannt hat, die unter den Hamburger Arbeitern verteilt wurden, entgegnete er:
»Ja, aber die waren aus dem Ausland eingeschmuggelt.« Über Streiks wollte er nicht reden. Und als ich ihn fragte, ob die SS-Führer vom Oberabschnitt Nordwest in Hamburg, vom Abschnitt Altona und von den einzelnen Standarten einen besonderen Begleitschutz hatten, meinte er:
»Jawohl. Es gab SS-Einheiten, die für unsere Sicherheit verantwortlich waren.«
»Ständig?«
»Ja.«
»Und wenn Hitler nach Hamburg kam, hattet ihr viel mit seinem Schutz zu tun?«
»Es ging. Diese Arbeiter empfingen Adolf Hitler mit großer Herzlichkeit. Sogar mit Enthusiasmus.«
»Ich finde, Sie übertreiben«, meinte ich. »Aber sagen Sie mir doch, wussten die Arbeiter in den einzelnen Betrieben, dass Hitler tatsächlich zu ihnen kommen würde, wenn seine Besuche in den Fabriken und Werften angekündigt wurden?«
»Manchmal schon. Meistens aber wussten sie nicht Bescheid. Schließlich wurden auch wir häufig vor vollendete Tatsachen gestellt. Da wir den vorgesehenen Besuchsweg Hitlers kannten, besetzten wir diejenigen Hallen, die der Führer aufsuchen wollte. Aber der persönliche Begleitschutz änderte meist den Weg und wir hatten dann Probleme.«
»Sehen Sie, daraus geht doch hervor, dass Hitler euch auch nicht traute ... euch, seiner Leibgarde.«
»Uns traute er bestimmt, aber konnte er zu Hamburg Vertrauen haben?«, platzte Stroop heraus.