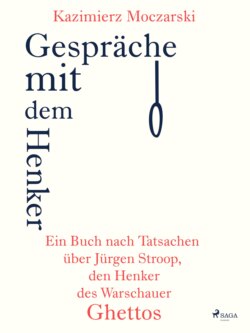Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Kapitel Die Münchener Offenbarung
ОглавлениеErst im Frühjahr 1932 trat Joseph Stroop einem nazistischen Verband bei. Aber welche Einstellung dem Führer gegenüber hatte er in den Jahren davor? Hier muss es einen dunklen Punkt in der Biografie dieses »mustergültigen Nationalsozialisten« gegeben haben. Diesen Eindruck zumindest gewann ich während unserer Gespräche über die Anfänge der »Ära Adolf Hitler«. Die ersten Zeichen der »großen Bewegung« drangen nach Detmold schon früh.
»Die erste Kunde brachten ehemalige Kriegsteilnehmer«, berichtete Stroop.
»Wir waren stolz, dass ein Frontsoldat und Träger des Eisernen Kreuzes ...«
»Herr General haben auch das EK aus dem Ersten Weltkrieg«, warf Schielke ein.
»Ich erhielt das Eiserne Kreuz für den Frankreichfeldzug, allerdings II. Klasse. Adolf Hitler trug das EK I.«
»Aber bei Kriegsende war er Gefreiter, Sie dagegen Unterfeldwebel. Also hätte Hitler 1918 vor Ihnen strammstehen müssen«, meinte ich.
»Vor mir? Der Führer? Niemals!«, stotterte Stroop; er sah mich an, als hätte ich gerade eine Gotteslästerung begangen. Schielke pfiff leise durch die Zähne und grinste.
Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Stroop machte eine wegwerfende Handbewegung. Er verzichtete stets auf wörtliche Auseinandersetzungen, wenn er sich zwei Gegnern gegenübersah.
»Die ehemaligen Frontsoldaten brachten Hitler Sympathie, Verständnis und Hoffnung entgegen. Schließlich war er Kriegsteilnehmer, Germane und hasste die Judenkommune«, philosophierte Stroop. »Er sagte deutlich, was er wollte, machte keine großen Umstände. Das deutsche Volk brauchte konkrete politische Ziele und eine Bewegung, keinen fauligen Sumpf von Weimar. Der größte Teil des Volkes hatte genug von den kosmopolitischen, jüdischen Märchen und vom Liberalismus, der immer in die Anarchie führt. Das Volk verlangte nach soldatischer Tatkraft in Politik, Verwaltung und im Alltag. Eine Massenbewegung musste kommen, die zugleich in ihren Anlagen durch und durch gesund war.
Nach Stroops Vorstellung bedeutete »gesund«: nationalsozialistisch und straff geführt. Diese Eigenschaften besaß die Arbeit von Hitler, Göring und Himmler, als sie in München die Partei aufbauten. »Soviel mir bekannt ist, war Hitler gar nicht der Gründer eurer Partei. Er war Nummer 7 in der Reihenfolge der Beitritte zur Deutschen Arbeiterpartei, der späteren NSDAP, die von Drexler1 gegründet worden war«, erinnerte ich ihn.
»Das alles ist Propagandageschwätz, Herr Moczarski. Adolf Hitler war, ist und bleibt das erste Mitglied und der Begründer der NSDAP.«
»Aber Röhm ist doch noch vor Hitler in die Partei eingetreten und hat ihn, soweit mir bekannt, nicht nur zu Drexlers Partei, sondern auch zum militärischen Geheimdienst angeworben.«
»Adolf Hitler war niemals ein Agent des Geheimdienstes«, brauste Stroop auf.
»Ich weiß es nicht genau«, entgegnete ich. »Aber soweit ich mich in der Geschichte und den Methoden politischer Organisationen auskenne, musste Hauptmann Röhm Hitler zur Bekämpfung marxistischer Arbeitervereinigungen angeworben haben. Röhm, Invalide des Ersten Weltkriegs, aktiv und ehrgeizig, war damals zuständig für den politischen Geheimdienst der Reichswehr beim Armeestab in München.«2
Darauf Stroop:
»Entschuldigen Sie, Herr Moczarski, aber Sie sind von der Lügenpropaganda der jüdisch-kommunistisch-angelsächsischen Presse angesteckt. Ich wiederhole: Der Führer war niemals ein mieser Agent des Geheimdienstes. Röhm konnte viel erzählen. Er war ein homosexuelles Schwein.«
»Und dafür wurde er im Jahre 1934 beseitigt?«3
»Ja. Röhm war ein Verräter am Führer und an der Bewegung. Er pflegte abartige Veranlagungen, die eines Germanen nicht würdig waren, und es ist schade, dass dieser Päderast nicht schon früher liquidiert wurde!«
Schielke, der das Milieu der deutschen Homosexuellen gut kannte, mischte sich in das Gespräch ein. Er hatte lange genug bei der Sittenpolizei gearbeitet, wo Karteien über aktive und passive Päderasten geführt wurden. Er meine, man hätte nur ganz wenige Homosexuelle in der NSDAP so unsanft behandelt wie Röhm.
»Herr Schielke, mit ›unsanft‹ bezeichnen Sie Taten, die ein Berufspolizist schlicht Mord nennen sollte«, wandte ich mich an den Mann von der »Sitte«.
»Sie haben ja Recht, Herr Moczarski, regen Sie sich bloß nicht auf! Ich stelle also fest, dass nur wenige Parteigenossen, die Päderasten gewesen sind, ermordet wurden. Die anderen, und es waren ziemlich viele, blieben am Leben, sie arbeiteten, machten Karriere, es ging ihnen nicht schlecht. Manche dieser Homosexuellen, wie zum Beispiel der bekannte Tennisspieler Baron von Cramm, besaßen die Protektion, ja sogar den besonderen Schutz der Superbonzen von der NSDAP.«
Stroop unterbrach Schielke plötzlich mit folgendem Kommentar:
»Der Tennisspieler von Cramm war ein Vetter eines Fürsten zu Lippe von der Reiter-SS, denn die Mutter des Fürsten entstammte der Familie von Cramm ...« Aber es gelang Stroop nicht, die Diskussion in andere Bahnen zu lenken, denn Schielke fuhr ungerührt fort:
»Durch die Fürsprache Görings konnte von Cramm ins Ausland reisen, obwohl er, wie es die Vorschriften damals verlangten, eigentlich ins Kittchen gehört hätte. Ich führte damals die Untersuchungen in diesem Fall. Hätte man alle Homosexuellen unter den Nazis so behandelt wie Röhm, dann hätten Tausende von Parteigenossen wegen ›Besudelung der Partei‹ sterben müssen.«
Der Ausgang des Hitler-Putsches vom 9. November 1923, der unter Mitwirkung von Ludendorff organisiert worden war und mit einem Fiasko und den Toten vor der Feldherrnhalle endete, musste in dem Kriegsteilnehmer Stroop den Glauben an den Erfolg des Nationalsozialismus erschüttert haben. In der Zelle fantasierte er zwar einige Male von dem Heldenmut und den Verdiensten der Blutordensträger4, nach meiner Meinung war es aber bloßes Deklamieren, sozusagen als Hinweis, dass er von Anfang an der Bewegung treu gewesen sei; oder es war einfach das Herunterleiern von Sprüchen, die man ihm im Parteiapparat jahrelang eingetrichtert hatte.
Andererseits waren die aggressiven Verteidigungsreden Hitlers vor dem Münchner Gericht im Februar und März 1924 durchaus dazu angetan, Stroop rasch wieder zu den Fahnen Hitlers zurückzuholen. In jenen Jahren bediente sich Stroop in seinem Privatleben der gleichen Methode, die Hitler nach Verlassen des Gefängnisses anwandte: Er ging den Weg eines scheinbaren Legalismus. Abwarten, nicht allzu sehr auffallen, sich nach außen hin gegenüber den gerade an der Macht Befindlichen loyal verhalten und im Stillen das Seine tun. Hitler fiel zwar immer wieder auf, doch gewitzt durch die Erfahrungen des Jahres 1923, strebte er die legale Übernahme des Reichskanzleramtes an. Denn politische Lügen, Tricks und Kniffe sind immer legal.
Aus den Erzählungen Stroops über jene Zeit schloss ich, dass er und seine Detmolder Freunde möglicherweise nur Angst hatten, allzu früh in die NSDAP einzutreten, obwohl die Mehrzahl von ihnen dank der Traditionen, in denen sie erzogen waren, gewiss zu den potenziellen Anhängern Hitlers gehörten. Hitler bedeutete für sie eine Offenbarung. Nur war die Lage vorläufig nicht so einfach.
»Seit 1918 regierte im Land Lippe die Sozialdemokratie«, berichtete Stroop. »Der Einfluss der Kommunisten wurde immer größer. Der Fürst zeigte liberale Neigungen. Die bei uns ansässige Freimaurerloge musste ernst genommen werden. Die Mehrzahl der Grundbesitzer fürchtete das Adjektiv ›sozialistisch‹ im Namen der Partei des Führers.«
Die NSDAP hatte trotzdem immer mehr Zulauf. In den Wahlen zum Reichstag 1930 errang sie überraschend 107 Sitze (1924 waren es 14, und 1928 12). Folgerichtig nahmen 1930 die politischen Aktivitäten im Freistaat Lippe zu. »Die bisherigen Parteien verstärkten ihre Tätigkeit und arbeiteten in einer Richtung, die für unsere Partei unerwünscht war«, meinte Stroop.
Er war gerade zum Vermessungsobersekretär ernannt worden. Nach außen hin befürwortete er Parteilosigkeit und »nationalen Objektivismus«. Er war für Uniformen und Soldatentum, was einem Durchschnitts-Deutschen immer gefiel. Politisch legte er sich nicht fest. Vielleicht fürchtete er seine bisherigen Vorgesetzten, deren Macht ebenfalls von germanischen Göttern stammte. Oder Stroop besaß ebenso wie der Fürst einen sechsten Sinn für Diplomatie und genügend Schlauheit, wie jener Konservenhersteller, dem Stroop in der Zeitung der ehemaligen Frontsoldaten zum Ruhm verholfen hatte.
Die Ereignisse zu Beginn des Jahres 1932 deuten darauf hin, dass Hitler zielstrebig und rücksichtslos auf dem Weg zur Macht ist. Stroop wird Mitglied nicht etwa der Partei, sondern des Beamtenbundes bei der NSDAP und erhält in dieser »Berufsorganisation« die Mitgliedsnummer 2418.
In Detmold arbeiten bereits starke nationalsozialistische Zellen, die leider mit »Ziegenhütern« und »Zieglern« durchsetzt sind, aber diese Personalstruktur in den Reihen der lippischen NSDAP sollte sich schon bald grundlegend ändern, wie Stroop meinte.
Endlich trifft er eine Entscheidung, gegen den Willen der Mutter und ohne Unterstützung seitens seiner Frau. Er entscheidet sich jetzt, weil er für die nahe Zukunft eine allgemein günstige Entwicklung voraussieht. Eine geniale Weitsicht hinsichtlich seiner eigenen Laufbahn sollte man ihm noch nicht abverlangen ...
Alle Zweifel sind überwunden, der »richtige Weg« entdeckt. Stroop betritt den modernen Weg der Cherusker und wird am 1. Juli 1932 Mitglied der SS, später – erst am 1. September 1932 – der NSDAP. Sein SS-Ausweis trägt die Nummer 44611, der Parteiausweis dagegen eine wesentlich höhere: 1292297.
Jahre später, in Warschau, wird er vor Gericht nach Entlastungs- und Rechtfertigungsgründen suchen und erklären, er wäre niemals Politiker, sondern immer nur Soldat, sogar »Berufssoldat« gewesen, und dass er dem Einfluss der vaterländisch-patriotischen Elemente unter seinen ehemaligen Kriegskameraden erlegen sei, die ihn, den »Militärfachmann«, gebeten hätten, in die SS, eine paramilitärische Organisation, einzutreten.
Ich kann mir denken, wie froh und hoffnungsvoll er im Juli 1932 gewesen ist, als die Partei Hitlers 230 von 608 Sitzen im Reichstag errungen hatte. Die Deutschnationalen erhielten nur 37 Sitze, die großkapitalistischen Liberalen (Deutsche Volkspartei) 7, das katholische Zentrum 97 (leichter Anstieg), die von Stroop verachteten Sozialdemokraten 133 und die Kommunisten 89 Mandate.
»Damals, in den Jahren 1932 und 1933, habe ich wahnsinnig viel gearbeitet«, erzählte Stroop. »Ich hatte mich völlig in den Dienst der Partei und des Führers gestellt. Ständig Appelle, Versammlungen, Agitationsfahrten, Exerzieren, Übungen, Kurse, Schulungen.«
Der NSDAP war ein so systematischer, pedantischer Mann nützlich; ergeben, treu und dabei jeder von oben weitergegebenen Wahrheit blind glaubend – zum Beispiel der, dass nach dem Kampf die fette Ernte in die Scheuer eingefahren wird. Stroop war einer der ersten SS-Männer im Land Lippe: Er wurde SS-Anwärter und führte, trotz seines Aspiranten-Status, eine SS-Einheit in Detmold.
»Gehorchten euch die Mitglieder der SA? Hattet ihr Unterstützung in der Bevölkerung?«
»Einige SA-Leute mussten wir ruhigstellen. Die, welche für Hitler waren, aber wie Sozialisten redeten. Mit der Bevölkerung war es verschieden.«
Er hatte offensichtlich wenig Lust, darüber zu reden, aber eines Tages kehrte er zu den Erlebnissen der Jahre 1932–1933 zurück:
»Wissen Sie, das Ziel der Weimarer Republik, das inspiriert war durch die Engländer, die Franzosen, die USA, von der Sozialdemokratie, den Freimaurern, der jüdischen Internationale und sowjetischen Agenten, war, das Reich und damit Europa in die Anarchie zu treiben. Diesen Bestrebungen setzten wir entschiedenen Widerstand entgegen. Auch in Detmold musste man die Bevölkerung beruhigen und sie auf den Weg von Zucht und Ordnung führen. Am einfachsten ging es mit den ehemaligen Soldaten, den wohlhabenderen Bürgern und den Industriellen. Mit den Juden sind wir sehr schnell auf legale Weise fertig geworden.«
Ich stellte ihm eine Fangfrage: »Legal? Und was war mit dem Demolieren einiger Geschäfte und mit dem Juden, dem man in einem Waldstück die Knochen gebrochen hatte?«
Stroop wurde blass, sah mich verlegen und argwöhnisch an und flüsterte Schielke zu: »Vorsicht!« Mein Gehör war damals nicht besonders gut (ich hatte große Schmerzen im linken Ohr), aber das von Stroop geflüsterte Wort hatte ich mitbekommen und reagierte sofort:
»Zum Teufel, denken Sie etwa, ich wäre ein Zinker?« Stroop begann sich eifrig zu entschuldigen und erläuterte, wie er das Wörtchen »Vorsicht« im gegenwärtigen Zusammenhang gemeint habe. Ich glaubte ihm, denn damals kannten wir uns schon eine Weile, und meinte: »Herr Stroop, bei Ihrem Prozess werde ich nicht als Zeuge auftreten. Das wissen Sie genau. Aber ich erinnere mich an Zeitungsberichte, aus denen hervorging, dass eure Sturmtruppen mit dem Gegner kurzen Prozess zu machen pflegten. Oder wollen Sie das leugnen?«
Ich fand Unterstützung bei Schielke, der berichtete, zu welch drastischen Handlungen und Unterlassungen man sie, die Kriminalpolizei, in den Jahren ab 1933 »gezwungen« hatte. Er sprach vom Terror gegenüber Juden, auch solchen, die zu den größten deutschen Patrioten zählten. Er erzählte von Gewalthandlungen in den Straßen, die zum Teil vor der Bevölkerung verheimlicht wurden, von der Zerstörung und Plünderung von Geschäften, vom Prügeln und vom Anzünden jüdischer Wohnungen.
»Und wir, die Hüter von Recht und Ordnung«, schloss Schielke, »waren gezwungen, diesem Unrecht tatenlos zuzusehen und blind über die Sicherheit dieser Rotzjungen von der SA zu wachen.«
Angesichts dieser Offenheit gab Stroop nach. Er wollte sich nicht gegen die gemeinsame Haltung von Schielke und mir auflehnen und gab uns Recht; dabei erzählte er ein wenig von den Aktionen der SS in Detmold, die von den Nationalsozialisten »befohlen« worden waren. Und dann wiederholte er wohl zum hundertsten Mal: »Befehl ist Befehl!«
Eines Tages, schon gegen Ende unseres gemeinsamen Aufenthaltes in der Zelle, schnitt ich noch einmal das Thema des Umbruchs von 1932/33 an und meinte beiläufig, wobei ich mich der Ausdrucksweise Stroops bediente:
»Sie fühlten sich als Schwert Hermann des Cheruskers. Mit Hilfe dieses Schwertes haben Hitler, Goebbels, Göring und Himmler in eurem Fürstentum für Ordnung gesorgt.«
»Das ist wohl ein allzu ehrenvoller Vergleich«, antwortete er ernst und fügte nach kurzem Nachdenken hinzu: »Herr Moczarski, Sie müssen begreifen, dass auf uns, den Berufs- und Reserve-Soldaten der deutschen Armee die Verantwortung für das Schicksal unseres Volkes ruhte. Wir repräsentierten die germanische Ehre und danach beurteilten uns die wertvollsten, patriotischen Bevölkerungsschichten.«
Während er von der politischen Arbeit um die Wende des Jahres 1932/33 sprach, unterstrich Stroop einen wesentlichen Punkt des nationalsozialistischen Programms, und zwar die Notwendigkeit, das »furchtbare Unrecht des Versailler Diktats« zu tilgen; das hieß: Wiederaufbau einer starken Armee und Rückgewinnung der von den Franzosen, Belgiern, Dänen, Italienern, Tschechen und Polen widerrechtlich besetzten Gebiete. Und es bedeutete das fraglose Gebot »historischer Gerechtigkeit«, das Gebot, neuen »Lebensraum« für das große, kultivierteste, zivilisierteste und fleißigste Volk zu gewinnen, das in den damaligen Reichsgrenzen »zu ersticken« drohte.
Im Jahre 1932 war Stroop zu einem in jeder Beziehung vollkommenen Nationalsozialisten geworden. Er trank das Elixier des nationalsozialistischen Evangeliums und verschluckte sich vor Begeisterung wie ein Foxterrier, der an einem Hühnerknochen würgt.
Er beherrschte bereits fließend die Sprache der Partei, trug nur noch Stiefel, besaß eine Peitsche und zwei Schäferhunde. Auf das Monokel verzichtete er. Nicht etwa deshalb, weil seine Augen sich gebessert hätten (damit hatte er niemals Probleme), sondern weil ein Monokel in der Partei nicht gern gesehen war. Erst in den 40er Jahren, nachdem er zum SS-General ernannt worden war, kehrte er zum Monokel zurück. Auch in der Zelle trug er es manchmal.
Zu den Versammlungen, Übungen, Parteikontrollen und bei Spaziergängen in Detmold pflegte er zu reiten.
»Woher hatten Sie Pferde?« fragte ich ihn einmal.
»Von den Bauern, Grundbesitzern und anderen Pferdezüchtern. Sie selbst boten uns ihre Hilfe an.«
Er spürte die wachsenden Möglichkeiten, mehr Macht zu gewinnen und hatte, wie er in der Zelle bekannte, einen heimlichen Wunsch: an der Spitze einer Reiter-SS-Einheit über die Hügel und Täler des Lippelandes zu galoppieren. Er, der Sohn eines Oberwachtmeisters, sollte unbedingt der Anführer sein; und hinter ihm die Grafen- und Grundbesitzersöhne und die künftigen Erben von ein paar reichen Kaufleuten.
An einem Sonntagmorgen herrschte in den Gefängnisfluren feiertägliche Ruhe. Stroop führte uns in der Zelle vor, wie man reitet. Auf angewinkelten Beinen schaukelte er gleichmäßig, zuerst im Schritt, dann im Trab und schließlich in scharfem Galopp. Er stieß kurze Rufe aus, schnalzte mit der Zunge, trieb sein Fantasieross mit der Reitgerte an, schnaubte und wieherte wie ein Pferd.
Stroop hatte nie, und das bedauerte er außerordentlich, den berittenen Einheiten der SS angehört. Aber er zählte im Fürstentum Lippe zu ihren Mitbegründern.
Die Rolle der SS-Reiterstaffeln im Dritten Reich ist bisher kaum untersucht worden. Nach meiner Meinung war die Zugehörigkeit zur Reiter-SS vorwiegend ein Ausdruck des Opportunismus von Leuten, die im politischen Spiel und im Wirtschaftssystem jener Zeit etwas zu verlieren hatten. Zur berittenen SS gehörten in der Mehrzahl Aristokraten und Großgrundbesitzer, die sowohl große Sportsmänner als auch Mitglieder der Parteielite waren. Die Reiter-SS stellte ein bequemes Sprungbrett für eine künftige politische Karriere in der Nazi-Hierarchie dar, sie bot aber auch die Möglichkeit, eine Verantwortung für den Nationalsozialismus zu umgehen. Stroop hatte dafür Verständnis, denn er wusste vieles, was mit Pferden zusammenhing. Eines Tages erzählte er mir, warum einer der Fürsten zu Lippe nach dem Krieg vom üblichen Schicksal der SS-Leute verschont geblieben war. Er erläuterte dabei den Hintergrund jenes Absatzes im Nürnberger Urteil, der im Kapitel über die SS bestimmt: »Nicht mit einbegriffen sind die Mitglieder der sogenannten Reiter-SS.«
Stroop behauptete, dass die Mitglieder der Reiter-SS deswegen aus der Zugehörigkeit zur SS herausgelöst worden sind, die in Nürnberg als verbrecherische Organisation eingestuft wurde, weil die »Internationale« der Aristokraten und Großgrundbesitzer auf diese Weise ihre zum Teil nur formell durch eine Zusammenarbeit mit Himmler kompromittierten Freunde schützen wollte. Ob Stroop Recht hatte, vermag ich nicht zu beurteilen.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1932 schwamm der 37-jährige Joseph Stroop auf einer Welle wachsender Anerkennung, er kommandierte und verteilte nach allen Seiten Instruktionen. Man quälte und prügelte brutal »all diejenigen Weichlinge ohne Rückgrat«, die man prügeln durfte.
»Bei uns in Detmold und im Fürstentum gab es nur wenige Juden«, erzählte Stroop. »Sie wurden bald hinausgeworfen. Sie fragen nach den Freimaurern? Ehrlich gesagt, habe ich die Freimaurer nicht angefasst, obwohl ich das Innere des Gebäudes kannte, in dem ihre Loge untergebracht war. Sie hatten zu enge Verbindungen zu den Fürsten, Grundbesitzern und unseren Plutokraten. Katholiken gab es in Detmold auch nur wenige. Wir versuchten, ihre ideologische Agitation auszuhöhlen. Die wissenschaftliche Tätigkeit von Frau Doktor Ludendorff hat uns da sehr geholfen.«
»Aber seien Sie mal ehrlich«, fragte ich ihn einmal, »als Sie in Detmold gegen die Katholischen vorgingen, fürchteten Sie nicht ein wenig Ihre Mutter, die doch eine aktive Katholikin war?«
»Ich wollte ihr keine Unannehmlichkeiten bereiten. Außerdem kannte sie viele Leute in der Stadt. Und schließlich sind ja die Katholiken in der Mehrzahl gute, wenn auch etwas verschwommene Patrioten. Natürlich rede ich nicht von Jesuiten und den verdammten Politikern des Vatikans in Deutschland. Aber im Allgemeinen haben wir die Detmolder Schöngeister, diese ganze marxistisch-katholischjüdische Bande ganz schön an die Wand gedrückt. Die hatten später nichts mehr zu sagen!«
»Aber wohl erst viel später, 1933?«, fragte ich.
»Ja. Wir haben sie 1933 endgültig fertig gemacht ...«
»Na, wohl nicht so ganz endgültig«, mischte sich plötzlich Schielke ein. »Wir brauchen hier in der Zelle doch nicht zu übertreiben! Obwohl die Nazis ...«
»Sie meinen wohl: wir Nationalsozialisten«, unterbrach ihn Stroop bissig.
»Sie haben Recht, Herr General«, gab Schielke gehorsam zu. »Aber heute bin ich kein Nationalsozialist, denn die Partei gibt es schon lange nicht mehr. Also wenn auch die Nazis die Sozialdemokraten, Jesuiten, Freimaurer, Juden und andere ideologisch fremde Reaktionäre rücksichtslos geduckt hatten, so ließ sich ein Teil der Bevölkerung doch nicht so ohne weiteres gleichschalten.«
»Weil es immer, in jedem Land, Gruppen von Unruhestiftern, Individualisten und Idioten gibt«, entgegnete Stroop heftig, »die nicht begreifen, dass nur die Treue zu einer Idee, eine auf eine einzige Person konzentrierte Führung und hundertprozentiger Gehorsam die Voraussetzung für die Existenz einer Nation sind. Treue, nur Treue, unbedingte Treue, das ist die wichtigste Eigenschaft eines wahren Menschen. ›Meine Ehre heißt Treue‹, dieser Satz, der im Ehrendolch und im Ehrendegen der SS eingraviert ist, besaß den edelsten Sinn für einen Staatsbürger.«
»Sie sprechen so oft von Treue«, meinte ich. »Treue ist eine schöne und seltene Eigenschaft. Aber wem soll man treu sein? Jedem Menschen, jeder Idee, jeder Sache? War es richtig, dass Sie Menschen die Treue hielten, die ihr Land in die Katastrophe geführt haben?«
Stroop reagierte erregt.
»Wir haben den Krieg nur deshalb verloren«, stieß er gepresst hervor, »weil die Machenschaften der reaktionären angelsächsischen, jüdischen, sozialistischen, kommunistischen, katholischen und freimaurerischen Internationale unser Volk zersetzt hatten. Wir waren zu liberal, wie es sich gezeigt hat ... Das Reich konnte nur unter Mithilfe eines Teils der deutschen Gesellschaft niedergeschlagen werden, mit Hilfe von solchen Canaris’5, Gördelers6, Stauffenbergs7, Thälmanns8, Schumachers9, Niemöllers10, von Kluges11, Paulus’12, Piecks13, und solchen unverschämten norwegischen Bengeln wie Willichen Brandt14 und vielen anderen Kanaillen, die man hätte härter rannehmen müssen.«15