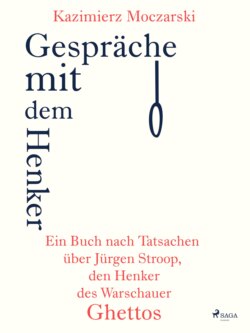Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. Kapitel Der Redakteur
ОглавлениеNach der Rückkehr nach Detmold wich die Hochstimmung allmählich. Die Hoffnungen welkten wie die Lippen der schönen Marta während des vierjährigen Wartens auf das Kriegsende. Stroops Uniform, die er anfänglich während seiner Arbeit im Katasteramt trug, wurde rasch unansehnlich und wirkte wie der halb zivile Aufzug eines ehemaligen Kriegsteilnehmers.
»Die Stimmung im Reich war nicht gut«, erinnerte sich Stroop, »nach einem verlorenen Krieg, der die ›Schmach von Versailles‹ und innenpolitische Erschütterungen mit sich gebracht hatte.«
Und doch waren die heftigen Gewitterstürme, die Deutschland aufwühlten, nicht bis in das abgelegene Ländchen Lippe-Detmold vorgedrungen. Das soll nicht heißen, dass die »neue Zeit« völlig an dem kleinen Fürstentum vorübergegangen wäre. Auch dort lebten Anhänger fortschrittlicher Traditionen, die von Menschlichkeit, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit sprachen, einige Liberale, und eine größere Anzahl von Sozialdemokraten, die nach dem Krieg in Lippe regierten. Ein Teil des Bürgertums büßte seinen Wohlstand ein. Das zahlenmäßig geringe Proletariat übernahm seine Vorbilder vom Ruhrgebiet, vor allem aber aus den Nachbarstädten Bielefeld, Essen, Dortmund, Elberfeld und Barmen.
Der weltanschauliche, situationsbedingte Gärungsprozess machte sich nun auch in Lippe bemerkbar, wenn auch auf etwas verwirrende Weise. Die Katastrophe des verlorenen Krieges hatte längst eingerostete Verklammerungen aufgesprengt – und genau in diesem Punkt begann der Fürst zu handeln. Dem damaligen Herrscher von Lippe-Detmold kann man weder Intelligenz noch Tatkraft und einen geschärften Sinn für wirtschaftspolitische Entwicklungen absprechen. Er entstammte einer Familie, die es glänzend verstand, bestimmte Situationen zu erfassen, mit dem Wind zu segeln und den materiellen Besitz – die Güter, Wälder und schließlich auch das langsam wachsende Potenzial der »kleinindustriellen Anlagen« der Dynastie derer von Lippe-Detmold zu schützen und zu bewahren.
Schon im September 1918, als der Fürst zu Lippe (»stets huldvoll, demokratisch und menschlich«, wie Stroop ihn charakterisierte) die Niederlage der kaiserlichen Armeen witterte, richtete er sein Augenmerk auf die revolutionären Umtriebe in seinem kleinen Land.
»Der Fürst tolerierte das allgemeine Geschrei um die neuen Parolen«, erzählte Stroop, »denn er wusste, dass es am bequemsten war, revolutionäre Stimmungen durch eine Art demokratischer Redefreiheit in den Griff zu bekommen.«
Stroop hatte wohl Recht, denn der Fürst muss gewusst haben, dass auch die aufrührerischsten Reden auf Versammlungen, in Gasthöfen und Bierkneipen in seinem Fürstentum keine organisierte Form annehmen würden, da größere, geschlossene Gruppen eines Industrieproletariats fehlten; und in Kreisen der Intelligenz wagte es kaum jemand, sich als »Bolschewik« zu erkennen zu geben. Die Bauern und Kleinbürger, die jetzt lauthals über die Berater des Kaisers, die Großindustriellen, Fürsten, Grafen, Freiherren und andere »Ausbeuter« und sogar »Blutsauger« schimpften, vergaßen schon am nächsten Tag ihren Zorn und kehrten zu ihrer gewohnten Arbeit auf ihre bäuerlichen Anwesen oder ihren städtischen Besitz zurück.
Doch die Lage wurde für die Fürstenhäuser immer bedrohlicher. Daher verfügte der Fürst zu Lippe »freiwillig« einen Wandel in der staatsrechtlichen Struktur seines Ländchens. Am 12. November 1918, unmittelbar nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes, wurde das Fürstentum in einen Freistaat umgewandelt und erhielt am 21. Dezember 1918, zufällig dem gleichen Tag, an dem Stroop die Armee verließ, eine »republikanisch-parlamentarisch-demokratische Verfassung«.
»Nach meiner Rückkehr nach Detmold sind mir dort kaum irgendwelche negativen Veränderungen aufgefallen, abgesehen von einem generellen Minus, das heißt dem ständig wachsenden Einfluss der Sozialisten, der jüdisch verseuchten Bolschewiken und der Freimaurer«, berichtete Stroop einmal; »die Stadt war moderner geworden und auf 17 000 Einwohner angewachsen.«
In Detmold hatten sich einige kleine Industrieunternehmen und eine starke Gruppe von Neureichen niedergelassen. Das Straßennetz war teilweise ausgebaut worden. Noch vor Kriegsausbruch hatte man in Detmold das im Jahre 1912 niedergebrannte Theater wiederaufgebaut.
Am Beispiel Detmolds lässt sich die allgemein bekannte Tatsache belegen, dass Deutschland während des Ersten Weltkrieges im Landesinnern kaum Zerstörungen davongetragen hatte. Die militärische Niederlage Detmolds jedoch bestand darin, dass das Schwert des Cheruskers eine fest eingeplante Kriegsbeute schuldig geblieben war: das Gold des Feindes.
Das Hermannsdenkmal stand, wohlkonserviert, an seinem alten Platz. Und allen jüngsten Erfahrungen zum Trotz lehrte es, dass der einzig mögliche Weg zur Erlangung teutonischer Ziele über das Militär führt.
»Während meines ersten Spaziergangs nach Rückkehr in die Heimat pilgerte ich zum Standbild dieses großen Soldaten«, erinnerte sich Stroop.
Dort, auf dem Denkmalshügel des Cheruskerführers, dachte er sicherlich über die Worte nach, die Mackensen in Ungarn gesprochen hatte. Der geflügelte Helm Hermanns und die Bärenfellmütze Mackensens bildeten eine unauflösliche Einheit.
Als kleiner Angestellter des Katasteramtes verdiente Stroop nicht viel. Seine Vorgesetzten teilten ihm minderwertige Aufgaben zu, ohne ihn dabei im Geringsten diskriminieren zu wollen. Stroop war pedantisch und gewissenhaft, er hatte eine bestechend schöne Handschrift und konnte gut zeichnen. Er lehnte sich niemals auf und wurde sogar hin und wieder gelobt. Seine Schuhe waren immer blankgeputzt, der Anzug sorgfältig gebürstet, wie früher in der Kaserne. Stets war er glatt rasiert, sorgfältig gekämmt und roch förmlich nach Sauberkeit. Was ihm wehtat (wie ich seinen Bekenntnissen im Gefängnis entnehmen konnte), war die Unmöglichkeit, Menschen zu befehligen. Wo waren die Zeiten, da er vor einer Zweierreihe von Rekruten seine kurzen Befehle bellte, die automatisch ausgeführt wurden! Auf der Stadtpromenade begegneten ihm seine alten Waffenkameraden und deren Mädchen. Diese jungen Dinger schufen einen unsichtbaren Glorienschein um die kurz geschorenen Köpfe der ehemaligen Krieger. Kleine, schon etwas mutigere, Liebesromanzen begannen, denn man hatte ja die rumänisch-goralische Schule hinter sich.
Stroop hasste die »Mitschuldigen« am verlorenen Krieg. Eines Tages begegnete er in der Paulinenstraße einem Jugendfreund, dem Juden Max R. Er tat, als würde er ihn nicht kennen und grüßte nicht, obwohl Max Kriegsinvalide war und mehrere Tapferkeitsauszeichnungen trug. »Max neigte zu marxistischen Überzeugungen«, erläuterte Stroop, der außerdem weder Wissenschaftler noch Professoren, Schriftsteller, Musiker, Ärzte oder Journalisten mochte. Diese Gruppen waren damals in Detmold tonangebend. Stroop verachtete auch die »Ziegler« und die »Ziegenhüter«.
Beide Bezeichnungen galten der ärmeren Bevölkerungsschicht in den Vororten Detmolds, in den Kleinstädten und Dörfern des Freistaates. Es handelte sich um Landwirte, Besitzer oder Pächter kleiner Grundstücke, die es sich nicht leisten konnten, eine Kuh zu halten. Sie besaßen in der Regel nur eine Ziege. Daher der wegwerfende Name »Ziegenhüter«. Und »Ziegler« nannte man diejenigen, die saisonweise in die nahen Industriereviere zogen, wo der Bedarf an ungelernten Arbeitskräften ständig wuchs, und zwar insbesondere in den Ziegeleien.
Die »Ziegler« und die »Ziegenhüter« hatten die Last des Krieges am ärgsten zu spüren bekommen. Scharenweise waren sie fürs Vaterland gefallen.
Trotz seines niedrigen Einkommens löste sich Stroop rasch aus seinen Nachkriegsdepressionen. Schließlich war ihm der Ruhm eines Kriegsteilnehmers geblieben. Er war ein nur vorübergehend pensionierter Held. Das fürstliche Schloss hatte Vertrauen zu Joseph Stroop, auf den der Herrscher sich verlassen konnte und der immerhin Träger des Eisernen Kreuzes war. Die Gemeinschaft der ehemaligen Soldaten war nicht auseinandergebrochen. Die Hoffnung auf Vergeltung einigte sie sogar immer stärker. Stroop hielt die Verbindung zu den Unteroffizieren und Offizieren beider Detmoldschen Regimenter sorgfältig aufrecht. Die meisten lebten im Fürstentum Lippe. Viele waren wohlhabende Bauern oder einflussreiche Beamte, einige besaßen Läden und Geschäfte.
Eines Tages trafen in Detmold Abgesandte von geheimen und halb geheimen Militärbünden ein. Vervielfältigte Befehle, Schriften und Aufrufe machten die Runde. Man traf sich unter dem Hermannsdenkmal. Manchmal wurde Stroop zu ehemaligen Frontoffizieren gerufen. In kämpferischer Bereitschaft stand der Zivilist in Habt-acht-Stellung vor ihnen.
»Aber der Krieg hatte mich müde gemacht, ich kränkelte ein wenig und ließ mich deshalb nicht beim Freikorps anwerben.«
Meiner Meinung nach war er zu sehr Kleinbürger und auch Detmolder, um sich damals schon hervorzuwagen.
Die Bewohner von Detmold, besonders die Frauen, hielten Stroop für eine Art Offizier. Dieser scheinbare soziale Aufstieg schmeichelte ihm. Er begann, ein Monokel zu tragen, außerdem schaffte er sich einen Schäferhund an. Und eine Peitsche.
Die Gerüchteküche der Kleinstadt erfand eine leidenschaftliche Kriegsliebe zwischen ihm und einer feurigen ungarischen Gräfin. So veränderte Lona C. aus Brzezany, ohne es zu wissen, ihre Nationalität und gesellschaftliche Stellung, denn die Familie Stroop wünschte nicht, dass die ihrer Meinung nach kompromittierende Neigung ihres Sohnes zu einer Slawin an die Öffentlichkeit dringe. Die Detmolder Mädchen waren dem Liebeswerben der demobilisierten Krieger durchaus nicht abgeneigt, besonders wenn sie Ordensbändchen trugen. Sie wussten aus den Erzählungen ihrer Mütter und älteren Schwestern, »wie schwer es ist, wenn in Kriegszeiten der Mann fehlt«.
So ließen sie sich von Joseph zu Spaziergängen begleiten, flüsterten in den Hausfluren, und die Mutigsten unter ihnen lauschten dem Gesang der Nachtigallen im Detmolder Wäldchen. Stroop imponierte ihnen mit seinem soldatisch-männlichen Mut und seinen forschen Komplimenten. Er hingegen stellte fest, dass man zu Hause, im heimatlichen Lippe, viel bequemer zum Ziel kam.
Eines Tages lernte Stroop ein etwa drei Jahre jüngeres Mädchen kennen, das ihm sofort gefiel. Es war eine Tochter »aus der guten Gesellschaft«, wie er sich ausdrückte, »aus Kreisen der protestantischen Intelligenz. Die Familie ihres Vaters, Georg B., gehörte seit Generationen zur Elite deutscher Seelsorger, er selbst war Wissenschaftler und Pädagoge.«
Die Tochter des Pastors oder gar Superintendenten verliebte sich auf der Stelle in den Krieger-Adonis. Die bescheidene Herkunft des Auserwählten kümmerte sie nicht, was für sie sprach. Aber die Tatsache, dass ihr das intellektuelle Niveau von Joseph Stroop nicht bewusst wurde, beweist, dass es dem gelehrten Pastor nicht gelungen war, seiner Tochter etwas von seiner eigenen Lebenserfahrung mitzugeben.
Die Familie des Mädchens war in der Stadt angesehen: ein untadeliger Ruf, »beste Traditionen«, ein gutes Einkommen und ein gewisses Vermögen, das in einer reichhaltigen Bibliothek, in Gemälden und in einer gediegenen Hauseinrichtung bestand, garantierten bürgerlichen Wohlstand.
Die Freundschaft dauerte ziemlich lange. In der Stadt erzählte man sich, dass Stroop recht feurig mit seinem Mädchen umgehe. Er war selbstsicher und unbekümmert. Bei Tanzabenden sah ihm Käthe hingebungsvoll in die Augen.
Stroops Mutter war eine Schwiegertochter aus diesen Gesellschaftskreisen durchaus willkommen, doch widersetzte sie sich aus Glaubensgründen dieser Ehe: Joseph war katholisch, Käthe Protestantin. Eine Verbindung zwischen den beiden war in den Augen von Frau Stroop eine Todsünde, und so verbot sie dem Sohn jegliche Kontakte zu Käthe. Ohne es zu ahnen, wurde sie darin vom Vater des jungen Mädchens unterstützt, der, obgleich Geistlicher, nicht so dogmatisch eingestellt war. Er widersetzte sich jedoch dieser Ehe nach dem ersten Gespräch mit Joseph Stroop.
Nachdem er sich die Angelegenheit hatte durch den Kopf gehen lassen (er dachte über alles immer sehr gründlich nach), begann Stroop seinen Plan energisch voranzutreiben. Er war sich der Gefühle des verliebten Mädchens sicher und sah auch den Nutzen dieser Verbindung deutlich: eine gesicherte Stellung innerhalb einer angesehenen Familie, eine gute Mitgift und die Aussicht auf ein einträgliches Erbe nach dem Ableben des angejahrten Herrn Pastors.
Es kam, wie er es geplant hatte. Nach tagelangem Familienstreit gab seine katholische Mutter nach. Der künftige Schwiegervater war inzwischen gestorben. Am 5. Juli 1923 heiratete Stroop die aus Stendal stammende Käthe B.
Der Eheschließung waren umfangreiche Vorbereitungen vorangegangen. Eine Wohnung wurde gemietet, Esszimmer, Schlafzimmer, Salon, Bettdecken und Vorhänge gekauft. Küche, Speisekammer und Keller wurden üppig ausgestattet. Stroop äußerte immer neue, allerdings nicht allzu anspruchsvolle Wünsche. Sie wurden sämtlich erfüllt. Ein Ehevertrag wurde aufgesetzt, und nach der kirchlichen Trauung fand sich das junge Paar im Ehebett wieder; in der anschließenden Hochzeitsnacht gab der katholische Ehemann seiner romantischen Protestantin jene Erfahrungen weiter, die er von einer orthodoxen rumänischen Goralin erworben hatte.
Stroop wurde rasch zu einem angesehenen Mann. Er gewöhnte sich einen gemessenen Gang an, schlenkerte aber trotzdem immer noch mit den Armen. Der Familie und den Nachbarn stattete er Besuche ab, begab sich mit seiner Gattin zum Sonntagsspaziergang in den Schlosspark und besuchte die fürstliche Oper. Er fügte sich vollendet in die Detmolder Gesellschaft ein, aber wäre er zu einer anderen Lebensweise überhaupt fähig gewesen?
Im Büro wurde er sofort befördert. Nachdem Käthe zu der Überzeugung gelangt war, dass er sich weiterbilden müsse, besuchte Stroop mehrwöchige Fortbildungskurse und bereitete sich mit Hilfe seiner Frau auf die Beamtenprüfung vor. Fast fünf Jahre nach der Hochzeit, im Februar 1928, legte er ein Examen als Vermessungsinspektor ab. Trotzdem hatte er kaum mit Vermessungen zu tun, da man ihn vorwiegend mit Steuerangelegenheiten beschäftigte.
Ebenfalls im Februar 1928 wurde seine Tochter Renate geboren. Der Nachkomme der Cherusker und Träger des Eisernen Kreuzes hatte sich natürlich einen Sohn gewünscht. Viel später bedauerte er tief, es zugelassen zu haben, dass seine Tochter den Namen Renate erhielt. »Meine Frau und ihre Familie hatten auf diesem Namen bestanden, der mir damals ebenfalls ganz hübsch vorkam«, erzählte er in der Zelle.
»Aber erst nach Jahren habe ich begriffen, dass Renate kein Name für eine richtige Deutsche ist. Renate klingt irgendwie französischmittelmeerländisch. Ich dagegen bin ein Anhänger nordischer Vornamen wie Christine, Ingeborg oder Sigrid. Als später mein Sohn zur Welt kam, besaß ich bereits das nötige Wissen und nannte ihn Olaf.«
»Aber Ihre Mutter und Ihre Frau hatten doch auch hübsche Vornamen; beide hießen Katharina. Und Ihre Schwiegermutter hieß Maria, wie die Mutter Christi«, meldete sich Schielke.
»Maria! Ein typisch jüdischer Name, Gott sei Dank hieß bei uns nur meine Schwiegermutter so.«
Sooft Stroop von seiner Ehe erzählte, betonte er den Ruf, die Bedeutung und den gesellschaftlichen Rang seines verblichenen Schwiegervaters. Er sprach von ihm wie von einer ihm besonders nahestehenden Person, die das Haupt seiner Familie von Intellektuellen gewesen sei. In der Zelle hielt Stroop sich selbst für den wahren Vertreter der Familie B.
Mit besonderer Begeisterung erzählte er von der Bibliothek seines verstorbenen Schwiegervaters. In diesem Punkt fand er mein besonderes Interesse. Als ich begann, ihn nach den Büchern auszufragen, die der alte Pastor besessen hatte, antwortete Stroop: »Ach, er hatte sehr viele Bände, sicherlich ein paar Tausend. Es waren alte Familienbestände, mehrere Generationen hindurch ergänzt. Ich kann sie Ihnen nicht näher beschreiben, aber ich habe sie alle gesehen. Viele hatten Ledereinbände, auch Goldrücken. Manche waren vergilbt und hätten eigentlich in einen Krämerladen gehört zum Einwickeln von Heringen. Alles in allem altes Zeug.«
»Was haben Sie mit dieser Bibliothek gemacht? Sicherlich doch in Ihrer vornehmen Wohnung untergebracht?«
Sichtlich geschmeichelt durch das Wort »vornehm« begann Stroop lebhaft von seinen Erfolgen zu berichten, die mit dem wertvollen bibliophilen Besitz der Familie B. verbunden waren.
»Diese Bibliothek war wirklich fabelhaft«, meinte er.
»Niemals hätte ich vermutet, dass Bücher so teuer sein können. Sie waren allerdings ziemlich schwer. Und eben wegen ihres großen Gewichts und mit Rücksicht auf die schwachen Zimmerdecken in dem Haus, das wir bewohnten ...«
»Und aus Geldmangel ...«, warf ich ein.
»Stimmt, damals besaß ich nur wenig Geld. Deshalb wollte ich die Bibliothek verkaufen, und das habe ich auch getan.«
»Und Ihre Frau hatte nichts dagegen?«
»Ich war doch Herr im Haus und nicht meine Frau. Ich hatte ja auch die Verfügungsgewalt über das Erbe meiner Frau.«
»Wie sind Sie denn diese Bibliothek losgeworden?«
»In Detmold wollte sie niemand kaufen. Also schrieb ich an ein Antiquariat in Bielefeld. Es war eine anständige Firma, sie schickten einen Sachverständigen. Er saß eine ganze Woche bei uns, machte ein genaues Verzeichnis mit einem Durchschlag für mich. Nach einem Telefongespräch mit seinem Chef bot er mir einige Tausend Mark für die Bücher. Vor lauter Glück fiel ich meiner Frau um den Hals und ließ mir sofort eine Anzahlung geben. Am nächsten Tag kam ein Lastwagen und verlud den ganzen Kram. Aber vorher wurde jedes Buch einzeln verpackt. Ich hätte nie geglaubt, dass so ein Scheiß so viel wert sein kann.«
»Waren auch besonders seltene Bücher darunter?«
»Keine Ahnung. Ich verstehe nichts davon. Aber es waren irgendwelche religiöse oder philosophische Schwarten aus dem 17. Jahrhundert dabei. Und noch ältere.«
Stroop führte damals, wie er in der Zelle meinte, ein herrliches Leben, obwohl nicht alle seine materiellen Wünsche befriedigt waren. Ein »herrliches« Leben! Alles bestens geregelt, unter Kontrolle und in gleichförmigen Bahnen verlaufend. Denn alles, was in diesem Städtchen die Normen des Gewohnten und Schicklichen auch nur um eine Winzigkeit überschritt, trug den Stempel des Skandalösen oder einer Verrücktheit. Ein solch »herrliches« Leben mag das Ideal vieler Menschen sein.
»Jeder lebt so gut er kann, der eine liebt Gedichte, der andere hat Schweißfüße«, pflegte Gustav Schielke in unserer Zelle zu sagen.
Zu Hause führte Stroop ein eisernes Regiment. Seine Frau behandelte er wie sein Eigentum. »Kirche, Küche, Kinder«, diese abgedroschene Formel über das Leben deutscher Frauen fand in der Ehe Stroops ihre getreuliche Bestätigung.
Seine Gedankenwelt wurde von der Tagespresse bestimmt. Dazu besaß er ein ausgeprägtes Gefühl für Konjunktur. Er hatte Vertrauen zum Fürsten und dessen Hofbeamten, den Industriellen, Großkaufleuten, Direktoren, Hofräten, pensionierten Offizieren und dem ländlichen Adel. Vor allem aber vertraute er seinen ehemaligen Kriegskameraden. Auf diese Weise setzte sich seine ideologische Schulung fort, an der die Tradition, die Eltern, seine Truppenführer und Vorgesetzten beteiligt waren. Denn »Ordnung muss sein!«
In jener Zeit erwarb und vertiefte er eine für ihn wichtige Tugend: die der Reserve allen Menschen gegenüber. Er hielt persönliche Zurückhaltung für eine ausgezeichnete Sache, denn sie hindere den Menschen daran, sich bloßzustellen. Gleichzeitig bildete sich bei Stroop eine andere Eigenschaft heraus: Er bemühte sich, nicht zu lügen.
Damals legte Stroop endgültig seine Handlungsweise fest: grundsätzlich die Wahrheit zu sagen, aber möglichst viel zu schweigen. Und sich in unbequemen Situationen niemals zum Reden provozieren zu lassen.
Ob es ihm immer gelungen ist, dieser Methode treu zu bleiben? Ich glaube nicht, denn das Leben bringt Freuden und Kümmernisse mit sich, die den Einzelnen aus seiner selbst auferlegten Reserve locken. Und es gab Stunden, in denen Stroop reden, sich erinnern und sich hervortun musste.
In den Jahren 1922–1931 bemühte er sich mit Erfolg, mit seiner Umgebung in Frieden zu leben. Von Zeit zu Zeit gab er klein bei, manchmal wand er sich wie eine Schlange, und selten drängte er zu höheren Sprossen der sozialen und gesellschaftlichen Leiter.
Seine berufliche Karriere, gefördert durch »Beziehungen« von Mutter und Ehefrau, brachte ihm nur geringe materielle Vorteile. Doch für den sparsamen Stroop wurde jeder Zehnmarkschein einer Gehaltserhöhung oder Prämie zu einem Ereignis, über das er monatelang stolz war.
Politisch betätigte er sich lediglich unter seinen ehemaligen Kriegskameraden, die sich schon damals in einflussreichen Vereinen zusammengeschlossen hatten. Man traf sich immer häufiger, leerte viele Bierkrüge und sang Märsche, dass es durch die engen Gassen Detmolds hallte. Man lauschte den Vorträgen ehemaliger Vorgesetzter und verehrte Hermann den Cherusker, Barbarossa, den »Alten Fritz«1 Bismarck, Hindenburg, Mackensen und Ludendorff2. Den letzten Namen erwähnte Stroop im Gefängnis besonders häufig. Er sprach von General Erich Ludendorff als dem »genialen« Organisator der Armee. Mit besonderer Verehrung aber äußerte er sich über Frau Doktor Mathilde Ludendorff3.
»Die Ideen von Frau Doktor Ludendorff und ihrem Mann sagten uns sehr zu. Sie war es, die die Wahrheit über die unheilvolle Rolle der katholischen Kirche in Deutschland offenlegte. Sie hat uns zu den wahren germanischen Göttern zurückgeführt. Sie hat uns die reinen urgermanischen Sitten ins Gedächtnis zurückgerufen und die Fäulnis der christlich-jüdischen Moralfesseln aufgezeigt, die den Organismus des Reiches seit zwölfhundert Jahren gefangen hielten. Wäre sie ein Mann, unsere Frau Doktor Ludendorff, wir hätten sie zum Ehrenmitglied unserer soldatischen Vereine ernannt. Dank der Lehren, die ich das Glück hatte, den Büchern von Frau Doktor Ludendorff zu entnehmen, gelang es mir mit Leichtigkeit, alle religiösen Vorurteile zu überwinden, um schließlich unter ›Glaubensbekenntnis‹ hinschreiben zu können: ›Gottgläubig‹.«
»Und was sagte Ihre Mutter dazu?«
»Mit Mutti hatte ich Schwierigkeiten. Sie war mir böse. Ich musste Rücksicht auf sie nehmen, denn sie war unsere Mutter, hatte Einfluss in der Stadt, und der Fürst mochte sie. Aber schließlich war und bin ich ein moderner, fortschrittlicher Mensch. Und so ist es mir gelungen«, er reckte sich voller Stolz, »mich wie ein Soldat aus der Gefangenschaft des Katholizismus zu befreien.«
»Aber Sie glauben an Gott?«
»Natürlich. Aber ich glaube an die wahren Götter, die Götter unserer germanischen Vorfahren. Sie lenken jeden Schritt eines Deutschen und beschützen ihn.«
»Sie auch?«
Er gab keine Antwort.
Joseph Stroop ließ keine Feierstunde aus, die in Detmold von ehemaligen Kriegsteilnehmern veranstaltet wurde. Sie mussten einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht haben, denn dreißig Jahre später erzählte er von ihnen so, als hätten sie erst gestern stattgefunden.
»Also an den Ehrenplätzen standen unsere Kriegshelden, die pensionierten Offiziere, in ihren schönen Uniformen; viele trugen auch Uniformen aus dem 19. Jahrhundert. Bärenfellmützen, Pickelhauben, Schirmmützen, Rundmützen mit Verbrämungen, Sporen, Gurte und Orden. Wie in Stein gemeißelte Gesichter. Ergraute Bärte. Stander, Fahnen, ein Orchester. Trommelwirbel. Der Feuerschein von hundert Fackeln erleuchtete unsere soldatische Gemeinschaft. Wir schlossen die Feier mit dem gemeinsamen Absingen des ›Niederländischen Dankgebetes‹. Tausende waren aus dem gesamten Fürstentum gekommen. Darunter fast alle Grundbesitzer aus der Umgebung.«
»Kannten Sie alle diese Grundbesitzer persönlich?«
»Ja. Viele von ihnen waren doch Reserveoffiziere. Manche kannte ich aus dem Krieg, deshalb luden sie mich manchmal zu sich ein. Feine Kerle. Sehr vaterländisch gesinnt und dazu große Draufgänger. Glänzende Reiter. Konnten ein Glas vertragen und mochten derbe Männerspäße.«
»Haben Sie an ihren Eskapaden teilgenommen?«
»Natürlich. Aber erst, nachdem ich aus dem Feld zurückgekehrt war. Der Sohn von Baron von O. lud mich ein und der einzige Sohn des Freiherrn von B. Der hatte eine hübsche und mutige Schwester. Wir galoppierten über die Felder und durch die Wälder der Umgebung. Unsere Grundbesitzer waren edelmütige Patrioten, sie ließen sich nichts gefallen. Eben echte Nachkommen der Cherusker.«
Eines Tages erklärte Stroop, er sei einmal Journalist gewesen. Offen gesagt, war ich zuerst sprachlos. Er eignete sich zweifellos, je nach den jeweiligen Umständen, für eine Menge unvorhergesehener Berufe oder auch gut bezahlter Aufgaben, dass er aber als Redakteur gearbeitet haben soll, ging mir entschieden zu weit. Von einem Journalisten erwartet man doch ein gewisses Maß an Allgemeinbildung und Intelligenz, gepaart mit einer ausgeprägten Fantasie; außerdem die Fähigkeit zu selbstständigem Urteilen und objektiver Kritik.
»Was haben Sie redigiert? Die Kompaniezeitung in Bukarest?«
»Nein. Ich leitete die Zeitschrift, die im Fürstentum Lippe von den ehemaligen Soldaten des 55. und 256. Infanterieregiments herausgegeben wurde. Der örtliche Frontkämpferverband hatte mich zum Redakteur bestimmt. Eine schwierige Aufgabe! Meine Frau arbeitete ebenfalls mit.«
»Ehrenamtlich?«
»Aber nein! Wir wurden dafür bezahlt. Meine Frau bekam sogar ein ganz schönes Sümmchen – 100 Mark monatlich.«
»Wie groß war denn die Auflage?«
»Etwa 800 Stück. Ich erinnere mich, wie wir in einer Nummer eine Reportage über das Leben eines ehemaligen Gefreiten brachten, der auf seinem Bauernhof nach dem Kriege Konserven herstellte und damit ein Vermögen gemacht hatte. Nach Erscheinen der Reportage schickte dieser Regimentskumpel meiner Frau große Pakete mit Fleischkonserven. Ja, Herr Moczarski, die Presse ist eine Macht!«