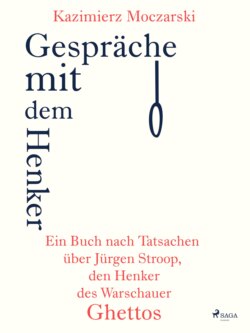Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеUnmittelbar nach der von der Roten Armee kontrollierten Machtübernahme, begann die kommunistische Regierung, den aus Moskau kommenden Direktiven Stalins folgend, einen gnadenlosen Kampf gegen alle nationalen, unabhängigen Kräfte im Lande. Man verfolgte rücksichtslos Soldaten und Offiziere der Heimatarmee, denen es gelungen war, dem Tod von der Hand der Deutschen zu entgehen. Die polnischen Gefängnisse füllten sich mit den besten und tapfersten Kämpfern gegen die NS-Gewalt. Die unglaubliche Perfidie Stalins gab ihm ein Konzept ein, das für Menschen, die in einer normalen, demokratischen Welt aufgewachsen sind, schwer zu begreifen ist. Der Tyrann hielt es für richtig, Menschen, die in den Reihen der Heimatarmee gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatten, wie Verbündete der Nazis zu behandeln. Die besten polnischen Patrioten erklärte die offizielle Propaganda plötzlich zu Faschisten und Handlangern der Gestapo. Sie wurden unter der Anklage der Zusammenarbeit mit dem Feind und des Verrats am polnischen Volk vor Gericht gestellt, der unglaublichsten Verbrechen für schuldig befunden und massenweise zum Tode beziehungsweise zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Natürlich fanden diese Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die Angeklagten hatten kein Recht auf Verteidigung. Unter dem Einfluss furchtbarer körperlicher und seelischer Folterqualen wählten viele den Freitod, andere bekannten sich zu nie begangenen Verbrechen, nur um ihren Leiden ein Ende zu machen. Diese Menschen gingen durch eine Hölle.
Einer von ihnen war Kazimierz Moczarski. Am 18. Januar 1946 war er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Aufgrund einer im Jahre 1947 in Kraft getretenen Amnestie wurde die Strafe zunächst auf fünf Jahre herabgesetzt. Im Januar 1949 begannen für ihn die »höllischen Verhöre« im Mokotów-Gefängnis zu Warschau. Sie dauerten mehr als zwei Jahre. Da er einen unbeugsamen Charakter besaß, wurde er mit besonderer Grausamkeit gequält. Seine Folterknechte waren unsicher und ratlos angesichts seiner Tapferkeit; das steigerte ihre verbissene Wut umso mehr.
Um ihn noch mehr zu demütigen und ihn moralisch zu zerbrechen, verlegten ihn die Schergen der Geheimpolizei in die Zelle des SS-Generals Jürgen Stroop.
Stroop hatte als einer der brutalsten SS-Führer besondere Berühmtheit erlangt. Auf seinem Gewissen lasteten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er hatte den Aufstand im Warschauer Ghetto, der am 19. April 1943 gegen die gewaltsame Räumung und den Abtransport der mehrere Hunderttausend dort zusammengetriebenen Juden in die KZs und Vernichtungslager ausgebrochen war, auf bestialische Weise liquidieren und Zehntausende von Juden an Ort und Stelle ermorden lassen. Die Amerikaner, die ihn nach dem Krieg gefangen nahmen, hatten ihn den polnischen Behörden ausgeliefert; in Warschau sah er seinem Prozess entgegen und wurde später, am 23. Juli 1951, zum Tode verurteilt und am 6. März 1952 hingerichtet.
In die Zelle dieses Mannes warfen die stalinistischen Folterknechte Kazimierz Moczarski.
So war eine in ihrer Art einmalige Situation entstanden, die an Shakespeares Dramen erinnerte: In der gleichen Zelle lebten neun Monate lang, vom 2. März bis 11. November 1949 zwei Todfeinde; ein SS-General, der Hunderttausende unschuldiger Opfer auf dem Gewissen hatte, und ein Offizier der Untergrundarmee, der fünf Jahre lang mutig gegen die Nazis gekämpft hatte, um sein Land und die elementaren Grundsätze der Menschlichkeit zu verteidigen.
Die brutale Skrupellosigkeit des Stalinismus setzte zwischen beide Männer ein Gleichheitszeichen. Der überführte Mörder Stroop wurde zum Leidensgenossen eines Mannes, der nicht das geringste Verbrechen begangen, sondern stets zu den tapfersten und opferbereitesten Patrioten gehört hatte. Den Stalinisten lag jedoch daran, seine Haltung zu zerstören, ihn zu zerbrechen.
Doch der teuflische Plan misslang. Moczarski überstand auch diese Tortur. Am 18. November 1952 aber wurde er vom Wojewodschaftsgericht zum Tode verurteilt. »Zweieinhalb Jahre wartete ich stündlich auf den Henker«, schreibt Moczarski. In Briefen an das Oberste Gericht schildert er unerschrocken die Vernehmungsmethoden, die 49 Folterarten. Vierzehn Monate bringt er in Einzel- und Dunkelhaft zu.
Im März 1953 starb Stalin, der Stalinismus geriet in eine Krise. Im Oktober wurde Moczarski zu lebenslänglichem Zuchthaus »begnadigt«. Erst zweieinhalb Jahre später wurde ihm das Urteil ausgehändigt, an das er vorher nicht mehr hatte glauben wollen. Stroop wurde hingerichtet.
Im März 1956 enthüllte Chruschtschow auf dem berühmten XX. Parteitag der KPdSU die Verbrechen Stalins. Das »Tauwetter« begann. Moczarskis Anwälte betrieben die Wiederaufnahme des Verfahrens. Moczarski wurde auf freien Fuß gesetzt.
Doch er war überzeugt: Dies durfte nicht das Ende sein. Er verlangte, endlich freigesprochen zu werden und forderte selbstverständliche menschliche Gerechtigkeit. Im Dezember 1956 fand in Warschau ein neuer Prozess statt, der eine öffentliche und offizielle Rehabilitierung zum Ziel hatte. »In diesem Saal bin nicht ich der Angeklagte – ich selbst klage an ...« Das Gericht entschied am 11. Dezember 1956, dass alle voraufgegangenen Urteile im Fall Moczarskis nicht rechtens waren, dass ihre Verhängung auf Grund von falschen Beschuldigungen erfolgte, dass Moczarski während der jahrelangen Haft unmenschlichen Folterungen ausgesetzt worden war, und dass er als ein Opfer stalinistischer Tyrannei zu gelten habe.
Kazimierz Moczarski wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen; in der Urteilsbegründung unterstrich das Gericht, dass seine Flaltung höchsten Respekt und volle Anerkennung verdiene.