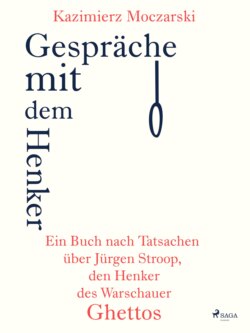Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Kapitel Unter der Fahne des Kaisers
ОглавлениеDas Fürstentum Lippe-Detmold verfügte in der kaiserlichen Armee über keine eigenen taktischen Einheiten und hatte jahrelang nur das 3. Bataillon im 55. preußischen Infanterieregiment gestellt. Wie Stroop berichtete, beschloss die Oberste Heeresleitung kurz nach der Jahrhundertwende, das ganze 55. Regiment aus den Bewohnern von Lippe zu rekrutieren, im Kriegsfall zusätzlich das 256. Reserve-Infanterieregiment. Beide nahmen am Ersten Weltkrieg teil.
»Den Krieg 1914–18 haben die Feinde Deutschlands, die alle unter einer Decke steckten, provoziert«, betonte Stroop häufig.
»Das Reich hatte niemals Kriege gewollt oder angefangen, es hat sich immer nur verteidigt. Als Frankreich und England ihn zu erpressen suchten, fand sich Wilhelm II. in einer ausweglosen Situation. Er musste sein eigenes Volk beschützen, deshalb begann er einen vorbeugenden Angriffskrieg.«
Nach Ausbruch des »aufgezwungenen Krieges« meldete sich Joseph Stroop, angehender Katasteramtsangestellter aus Detmold, freiwillig beim 55. Infanterieregiment. Es war am 18. August 1914. Er war damals knapp 19 Jahre alt. Sein Vater war etwas bekümmert, aber letzten Endes stolz wie ein Pfau über den Kampfesmut seines Sohnes. Das Fürstentum lebte in einem nationalistischen Taumel und irrationalen Hass gegenüber dem »Todfeind«.
Mitte September 1914 war Stroop bereits an der Westfront. Auf dem Wege dorthin sah er zum ersten Mal den Rhein. »Es war ein sonniger Tag, als wir diesen großgermanischen Fluss überquerten«, erzählte Stroop. »Der Himmel und die Augen der dortigen Mädchen waren kornblumenblau, genau wie es in dem Lied heißt.«
Ich meine, dass nicht nur der Wein, wie es die Worte eines rheinisehen Walzers ausdrücken, sondern auch die Kriegsbegeisterung die Augen der deutschen Mädchen so tiefblau aufleuchten ließen.
Nun lernte Stroop Frankreich kennen. Aber »kennenlernen« ist nicht der richtige Ausdruck. Er hat Frankreich nur ein wenig gestreift. Seine Kenntnisse über dieses Land beschränkten sich, wie ich unseren Zellengesprächen entnehmen konnte, auf Informationen, die noch aus der Volksschule stammten und die mit einer Propaganda angereichert waren, welche ihm jahrelang zu Füßen des Cherusker-Denkmals eingeimpft worden war.
»Die Franzosen, das sind Faulpelze und Mischlinge. Das ist überhaupt keine Rasse. Alles Mischlinge, Anarchisten und Dreckskerle. Auch die Frauen sind dreckig, obwohl sie ein Bidet benutzen. Überhaupt sind nach meinen Erfahrungen alle Französinnen Dirnen.«
Und dann folgte eine vulgäre Geschichte über die angeblichen Erlebnisse eines Soldaten in dem von Deutschen besetzten Teil Frankreichs, die er offensichtlich in irgendeinem Propagandaheft gelesen hatte.
Und doch hatte ihm Frankreich imponiert. Vielleicht deshalb, weil er im Oktober 1914 durch ein französisches Geschoss in der Nähe von La Bassee an der Schulter verwundet wurde.
Wie musste er sich an der französischen Front gefürchtet haben! 35 Jahre waren vergangen, aber noch immer war Stroop nicht in der Lage, in der Zelle bestimmte Worte und Gesten zu unterdrücken, die bewiesen, dass er in Frankreich vor Angst geschwitzt hatte.
Es gelang ihm, sich in ein Lazarett weit hinter der Frontlinie verlegen zu lassen. Ein Heimaturlaub folgte, der wegen der geringfügigen Verwundung nur von kurzer Dauer sein konnte. Aber Mutti begann zu handeln. Der Fürst verfolgte aufmerksam die Verhältnisse in den Stäben jener Einheiten, in denen sein lippisches Regiment kämpfte, so dass der Gemeine Joseph Stroop dank der fürstlichen Protektion bis zum Sommer 1915 auf Genesungsurlaub bleiben konnte. In jener Zeit kam er häufig nach Detmold. Die Stadt war zwar klein, ihr Ruhm dafür umso größer. Und nicht nur die Mädchen aus der Mühlenstraße bewunderten Josephs Uniform und die ihm im Januar 1915 verliehene lippische Militärverdienstmedaille mit Schwertern sowie die nagelneuen Rangabzeichen eines Gefreiten. Die Mutter, und mit ihr alle Nachbarinnen, die Polizisten und ihre Spitzel, die pensionierten Militärs, die Beamten am Hof des Fürsten und das gesamte vaterländische Detmold bewunderten den Heldenmut des Oberwachtmeister-Sohnes. Die fürstliche Kanzlei, der allgemeinen Stimmung nachgebend, tat das ihre. Und so wurde Stroop nach acht Monaten der Pflege und Rekonvaleszenz vom Westen in den damals als bedeutend sicherer geltenden Osten verlegt. Vom 1. Juli 1915 an dient er im 256. Detmolder Reserve-Infanterieregiment.
Mit seiner Einheit kommt er nach Polen und Litauen, nach Weißrussland, Polesien und Galizien, er ist aber kaum an der vordersten Front zu finden, denn der Fürst zu Lippe sorgte schon dafür, dass das Regiment keine zu hohen Verluste zu erleiden hatte. Im Herbst befördert man ihn zum Unteroffizier, und am 2. Dezember 1915 wird ihm für Verdienste an der französischen Front das Eiserne Kreuz II. Klasse verliehen.
»Als mir diese Auszeichnung feierlich überreicht wurde, glaubte ich, im germanischen Himmel zu sein!«, schwärmte Stroop in der Zelle.
Stroop ist ein pflichtbewusster Unteroffizier. Das Kasernenleben, die Vorschriften des Stubendienstes, das Hocken über dem Papierkram der Kompanie und des Regiments sagen ihm zu. Er wird mit Schreibarbeiten beschäftigt und kann sich keine bessere »Schule des Lebens« vorstellen als den preußischen Drill. Neidisch schielt er auf jedes Offiziersmonokel. Die Befehle liest er seinen Vorgesetzten von den Lippen ab. Brutales Zusammenstauchen und Anschnauzer gibt er mit eigenem »Kommentar« an die Soldaten weiter. Unter seinen Untergebenen hat er besondere Lieblinge, solche, die sich über die strenge Behandlung nie beklagen und es verstehen, gutes Essen zu organisieren.
Mit seiner Kompanie wird er nach Brzezany verlegt und in einem kleinen polnischen Haus einquartiert. Es geht ihm nicht schlecht, denn er kann ein geregeltes Leben führen, und auch die Offiziere setzen ihm weniger zu. Die Soldaten, die vorher durch häufige Verlegungen und die Nähe der Front immer wieder aus ihrem gleichförmigen Tagesablauf aufgestört worden waren, kehren zum normalen Kommissalltag zurück. Und sie haben reichlich zu essen.
Stroop setzt etwas Fett an. Ab und zu spaziert er über die Promenierstraße von Brzezany, wo ihm die Ortsjugend begegnet. Genau wie in Detmold.
Ein Mädchen fällt ihm auf. Er folgt ihm wie ein Kundschafter. Die Kleine wohnt unweit seines Quartiers. »Ich wusste nicht«, vertraut er mir in der Zelle an, »dass sie eine Verwandte unserer Wirtsleute war und sie manchmal zu besuchen pflegte. Wir haben uns später kennengelernt. Sie war ein hübsches Mädchen, und so ...« »Lieb?«, forsche ich, als ich merke, dass seine Stimme überraschend weich klingt.
»Ja. Wir gingen spazieren. Die Sonne schien und ein silberner Mond, das Land war schön ...«
»Na und?«
»Na, wir gingen so miteinander. Unterhielten uns. Ich habe sie niemals auf den Mund geküsst. Nur einmal auf die Nase, glauben Sie mir«, schwärmte er verträumt. »Sie war ein gutes Mädchen, sie wusste so viel und war so gebildet und so fraulich, diese Lona C. Ich hatte vor, wenn sie gewollt hätte, sie zu heiraten und vielleicht für immer in Polen zu bleiben. Ich schrieb ihr aus Rumänien, aus Ungarn und sogar aus Detmold. Noch im Jahr 1922 habe ich mit ihr korrespondiert.«
»Warum haben Sie Lona nicht geheiratet?«
»Ich wollte es. Aber meine Eltern in Detmold und meine Freunde rieten mir ab, sie sprachen vom Unterschied der Kulturen. Und ich habe richtig gehandelt, als ich auf diese Ehe verzichtete.«
»Deshalb, weil Lona aus, wie ihr sagt, ›unteren Schichten‹ entstammte?«
»Ich muss zugeben – ja. Hätte ich eine Polin, eine Französin oder eine Amerikanerin geheiratet, wäre ich nie in die SS aufgenommen worden, und meine Kinder wären Mischlinge.«
Mehrmals noch erwähnte Stroop Lona C., wahrscheinlich die große Liebe seines Lebens. Im Mokotówer Gefängnis versuchte ich, mir diese Lona vorzustellen. Sicherlich war sie mädchenhaft – naiv, zart und sozusagen von innen leuchtend. Vielleicht idealisierte ich sie ein wenig, aber jeder hat das Recht zum Träumen, wenn er sich dabei wohlfühlt. Vor allem im Gefängnis.
Stroop kehrte häufig zu seinen Erlebnissen während des Ersten Weltkrieges zurück. Er war beeindruckt von den Wäldern und Sümpfen Polesiens, das er als einen Naturschutzpark Europas ansah. Besonders interessierten ihn die Wisente, Elche, Wildkatzen und die weißrussisch-polesischen Bauernpferde. Er gab ihnen eine hohe Wertnote.
»Solche Pferdchen sind sehr genügsam und dabei ungeheuer ausdauernd und kräftig«, pflegte er zu sagen. Er nannte sie »Panje-Pferde«. Häufig unterstrich er die Armut der Einwohner Polesiens bei allen sichtbaren wirtschaftlichen Vorzügen dieses Gebietes. Er konnte die Ursachen für den technisch-zivilisatorischen Rückstand der Bevölkerung nicht begreifen und meinte: »Diese Einheimischen, das sind Wilde.« Stroop glaubte, sie seien die geborenen Sklaven und könnten nur unter deutscher Verwaltung glücklich werden. Dagegen war er begeistert vom Reichtum der Ukraine mit ihren Rohstoffen, der fruchtbaren, schwarzen Erde und der körperlichen Kraft und Geschicklichkeit der ukrainischen Frauen.
Von Galizien wurde die Einheit Stroops in die rumänischen Karpaten verlegt. Er beschrieb uns in allen Einzelheiten den Frontverlauf auf den schneebedeckten Bergkuppen, die beschwerlichen Transport- und Versorgungsbedingungen, die Frontlinie, die Verschiebungen an den einzelnen Abschnitten und die weiter im Hinterland gelegene Etappe: die Kantinen, die Art der Verpflegung, das Meldewesen und das Heimweh nach Detmold. Er war oft »unrasiert und fern der Heimat«; das deutsche Heer sang schon damals diesen Satz nach der Melodie »Wolga, Wolga«. In der Zelle summte Gustav Schielke oft seine deutsche »Wolga«, besonders wenn er gut gelaunt war. Er machte sich dann über sich selbst und uns lustig, manchmal kicherte er gutmütig und spuckte durch seine Zahnlücken.
Dort, in den Karpaten, sehnte sich Stroop oft nach Lona C., seiner »kleinen Heiligen aus Brzezany«. Gleichzeitig beobachtete er interessiert die karpatisch-rumänischen Bergbäuerinnen, die »schmutzig und wild waren, aber die schönsten Brüste unter der Sonne hatten«, wie er sich ausdrückte.
Einmal, nach dem Mittagessen, begann er mit einer vertraulichmännlichen Beichte:
»Die rumänischen Bäuerinnen verkauften uns immer Milch. Es war Winter und sehr kalt. Aber die Milch war immer lauwarm, weil sie die Flaschen unmittelbar zwischen ihren Brüsten trugen, nur mit einer vorn geschlitzten Bluse bedeckt, darauf den Schafpelz. Man konnte die Brüste sehen. Sie machten sich nichts daraus. Uns brachte die Milch eine verheiratete junge Frau.«
»War sie älter als Sie?«
»Ja. So etwa acht Jahre, aber sie war nicht so mager wie die anderen Frauen. Und sie schaute mich herausfordernd an.«
»Wahrscheinlich spürte sie das Männchen in Ihnen?«
Stroop wurde verlegen: »Aber damals wusste ich doch noch gar nicht, was zwischen einem Mann und einer Frau passiert.«
Plötzlich sprudelte er heraus:
»Hören Sie, es war so um Weihnachten herum. Wir verließen gemeinsam unser Quartier. Es war bitterkalt, dazu der Mond, Sterne. Ich drückte sie an mich und wir gingen los. Zwei Stunden später verließ ich die Almhütte als vollwertiger Mann.«
»Haben Sie die Frau anschließend zu ihrem Haus begleitet und dabei von Zeit zu Zeit an den Zaun gelehnt?« fragte ich.
»Die Rumänin? Aber woher denn! Nein. Ich habe sie nicht nach Hause begleitet.«
An jenem Tag sprachen wir nicht mehr miteinander.
Einmal erwähnte Stroop flüchtig, dass er zum zweiten Mal verwundet wurde.
Wahrscheinlich ging es dabei um einen unbedeutenden Kratzer. Aber vielleicht irre ich mich. Er erzählte auch von Bukarest, wohin er 1918 zu einem viermonatigen topografischen Lehrgang an die Vermessungsschule abkommandiert wurde. Von da an zählte er sich zu der Sparte der »diplomierten Topografen«.
Stroop führte in Rumänien das Leben eines Etappenunteroffiziers zwischen Kompanie, Küche, Exerzieren, Requirierungen, dem Unteroffizierskasino und der Kneipe. Aber im September 1916 erhielt er eine Auszeichnung: das »Fürstlich lippische Verdienstkreuz«.
»Der Blechladen vergrößerte sich auf der Brust des Generals«, bemerkte Schielke, der während des Ersten Weltkrieges vorwiegend mit dem Schleppen von Balken in einer Pioniereinheit und dem Bauen von Brücken beschäftigt worden war, dabei oft bis zum Gürtel im Wasser stehend. Häufig erwähnte Stroop Ungarn im Jahre 1918 und den »großen Mackensen«1. Die Magyaren waren ihm sympathisch, auch wenn er sie kritisierte.
»Es ist unverzeihlich von diesen ungarischen Idioten, dass sie den Aufstand Béla Kun2 zugelassen haben, in diesem Land mit seinen herrlichen Landgütern, den schönen Jagden, hinreißenden Pferden und dem Draufgängertum der Kavallerie!«
Stroop verehrte Feldmarschall August von Mackensen dank dessen militärischen Talenten und vor allem deshalb, weil er die deutsche Armee 1918 in Ungarn mit eiserner Disziplin befehligte.
»Von Mackensen war Aristokrat und Kavallerist zugleich«, meinte er. »Er trug oft seine Husarenuniform und die Bärenmütze. Ein ausgezeichneter Stratege und ein nüchtern denkender Politiker aus der Schule Bismarcks. Der Feldmarschall verhinderte, dass fremde Geheimdienste in die Armee einsickerten, das heißt kommunistische Agitatoren, Juden, Freimaurer und Liberale. Die Einheiten Mackensens blieben ungeschlagen. Ende 1918 besaßen wir unsere volle militärische und psychische Kampfkraft, wir verfügten über alles nötige Material und waren voll operationsfähig. Unbesiegt mussten wir uns dann in die Heimat zurückziehen, nur wegen der Wühlarbeit an anderen Fronten und im Inneren Deutschlands, wie sie seit langem von Juden, Marxisten und den nationalen Minderheiten betrieben worden ist.« »Kurz vor seiner Rückkehr in die Heimat suchte von Mackensen unsere Einheit auf«, fuhr er fort.
»Wir empfingen ihn mit beinahe so vielen Ehren wie den Kaiser. Niemand störte diese erhebende Stunde durch Zwischenfälle, wie sie durch die Wühlarbeit der Frontsoldaten in unseren anderen Armeen üblich geworden waren oder auch unter den Mannschaften der zum Teil kommunistisch verseuchten Kriegsmarine vorkamen. Mackensen sprach kurz und verwies auf Ziele ...«
»Artillerieziele?«, unterbrach ihn Schielke.
»Nein. Auf militärpolitische Ziele. Er lehrte uns, wie wir die wahre Ordnung in unserem Vaterland beschützen müssten, das einst in voller Kraft Wiedererstehen wird. Wir verabschiedeten ihn wie einen Vater. Dann erfolgte die geordnete Verladung in die Eisenbahnwaggons, und wir setzten uns bewaffnet und in geschlossenen Einheiten nach Deutschland ab. Wir sind nicht wie andere in alle Richtungen auseinandergelaufen.
Ja, Herr Moczarski, mein Krieg endete nicht schon am 11. November, sondern erst am 21. Dezember 1918. Ich kehrte kurz vor dem Weihnachtsfest nach Hause zurück.«
»Ziemlich spät. Und wie begrüßte euch die Bevölkerung von Detmold?«
»Mit offenen Armen und keineswegs niedergedrückt, obgleich die Zeiten nicht leicht waren.«
»Sie erwähnten, dass Sie die Armee als Vizefeldwebel verlassen haben. Warum hatte man Sie nach so vielen Jahren nicht zum Offizier befördert?«
»Ich war noch zu jung.«
Meine Frage war Stroop sichtlich peinlich. Ich rührte da an etwas, was er für den Makel seines Lebens hielt. Denn er hatte doch nur die Volksschule besucht.
Als Stroop in den Krieg zog, als ginge es zu einer Hochzeit oder zu einem Spaziergang durch Nachbarländer, ihre Speicher, Küchen und Betten, mag er gedacht haben, man würde ins Lippeland mit dem Lorbeer Hermann des Cheruskers sowie mit irgendeiner ansehnlichen Beute heimkehren. Und nun hatte er seine erste Kriegschance verspielt. Die Tatsache, dass diese Rückkehr aus dem Feldzug gewissermaßen ein Glücksfall war, kam ihm nicht zum Bewusstsein. Denn im Ersten Weltkrieg betrugen die Verluste Deutschlands annähernd zwei Millionen Gefallene und Vermisste. Und wie viele waren zu Krüppeln geworden?
Aus diesen dürftigen Informationen und Erzählungen könnten die Leser den Schluss ziehen, dass die Erlebnisse Stroops in den Jahren 1914–1918 von sorgloser, ruhiger Art gewesen waren, dass die körperlichen Qualen der Schlachten, Lazarette, dass Hunger und Kälte, die Plage von Ungeziefer und der Anblick von Leichen ihm erspart geblieben waren.
Das stimmt nicht ... Ich verzichte zwar auf viele Einzelheiten über den Dienst Stroops unter den Fahnen Wilhelms II., denn ich will nicht zu allgemein bekannten Ereignissen zurückkehren. Ich glaube, dass Stroop, obwohl es ihm manchmal gelang, einen gegenteiligen Anschein zu erwecken, die Grausamkeiten und Leiden des Krieges zur Genüge erfahren hat.
Und doch hatte Stroop den Kult des Krieges als eines Instruments der Abrechnung und einer Methode für das Zusammenraffen von Gütern für sein eigenes Land und für sich selbst im Blut. Die Ansichten Stroops zu diesem Thema waren durch ein hohes Niveau der Formulierungen gekennzeichnet, die sich wesentlich von seiner Alltagssprache unterschieden. Es war deutlich zu sehen, wie dieser gehorsame Verstand sich mechanisch den Wortschatz der Propaganda und der Parteischulungen der NSDAP angeeignet hatte.
»Der Krieg stellt ein biologisches und psychologisches Ausleseverfahren dar, das jedes Volk benötigt«, meinte er. Nur Menschen mit einer Rittergesinnung können jenes Privileg erfahren, diese höhere Kategorie des Erlebens begreifen, das der Krieg darstellt.
Außerdem wiederholte er in der Zelle häufig, dass der Krieg die beste Tür zur Freiheit sei.
Diese Haltung beeinflusste in gewisser Weise seine sportliche Einstellung zu den eigenen Kriegserlebnissen zwischen 1914 und 1918. Daher auch die unbekümmerten Erinnerungen an das »große soldatische Abenteuer«, um mit den Worten Stroops zu sprechen.
Und noch etwas: Stroop beendete »seinen« Weltkrieg mit dem Gedanken an eine möglichst baldige Rache und Vergeltung. Rache an den Nachbarvölkern, an England und Russland und an den »Verrätern«, die im Jahre 1918 den Deutschen den »Dolchstoß« versetzten, das furchtbare Versailler Unrechtsdiktat unterschrieben und im Reich die Regierung der »November-Demagogen« und »ausländischen Agenten« geschaffen hatten.