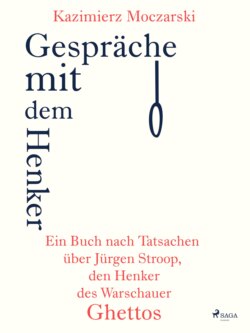Читать книгу Gespräche mit dem Henker. Ein Buch nach Tatsachen über den SS-General Jürgen Stroop, den Henker des Warschauer Ghettos - Kazimierz Moczarski - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Kapitel Zu Füssen von Bismarcks Cherusker
ОглавлениеDer SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Stroop, bekannt als Jürgen, trug bis zu seinem 46. Lebensjahr den Vornamen Joseph1, den er gemäß der Familientradition von seiner Mutter Katharina, geb. Welther, und dem Vater Konrad Stroop, einem Polizeichef im Fürstentum Lippe-Detmold, erhalten hatte. Josephs Eltern waren katholisch. Der Vater trug sein Glaubensbekenntnis kaum zur Schau, die Mutter dagegen war eine bigotte Frömmlerin, wie aus den Erzählungen Stroops in der Zelle hervorging.
Im Gefängnis von Mokotów trafen in den Jahren 1947–1953 in steiler gotischer Schrift geschriebene Briefe ein, in denen die Witwe Käthe Stroop ihrem Sohn Bibelsprüche schickte, obwohl er zum Abtrünnigen geworden war. (Zum Offizier der Waffen-SS befördert, brach er mit der römisch-katholischen Kirche und nannte sich »gottgläubig«.) Ich nehme an, dass seine Mutter die Sünden, für die der Sohn zuerst in Landsberg2 und später in Polen im Gefängnis saß, nicht für Verbrechen hielt. So viel zumindest ging aus den Briefen hervor, die Stroop mir zu lesen gab.
Man könnte meinen, dass ein Polizeichef im Fürstentum Lippe-Detmold zur Elite der Regierenden zählte und in seinem Beruf hoch angesehen war. In Wahrheit bekleidete Konrad Stroop den Rang eines Polizeioberwachtmeisters und befehligte kaum fünf Polizisten. Diese Tatsache bestimmte sein berufliches Niveau und seine gesellschaftliche Stellung.
Das Fürstentum zählte vor dem Ersten Weltkrieg etwa 150000 Einwohner, stellte aber bis 1918 ein kleines, selbstständiges Staatsgebilde innerhalb des Kaiserreiches dar. Trotz umfangreicher dynastischer Traditionen und Verschwägerungen war der Fürst von Lippe-Detmold kein bedeutender Herrscher. Und sein Polizeichef war in Wirklichkeit nur Leiter einer Polizeiwache. Allerdings brauchten da auch nicht allzu viele Ordnungshüter beschäftigt zu werden. Geruhsame Zeiten, Heimatverbundenheit, überkommene Sitten und das Fehlen einer modernen Wirtschaftsstruktur führten – strafrechtlich gesehen – zu einem gediegenen moralischen Lebenswandel. In den Städten und Dörfern kannte jeder jeden, so dass die Angst vor der öffentlichen Meinung die Bereitschaft zu einem Verbrechen von vornherein lähmen konnte. Die aktiveren Elemente und Abenteurer wanderten in der Regel in das nahe Rheinland und nach Westfalen aus, wo sich die Industrie unaufhaltsam entwickelte.
Oberwachtmeister Konrad Stroop, der einer westfälischen Bauernfamilie entstammte, wohnte in der Mühlenstraße, fast im Zentrum des damals 11000 Einwohner zählenden Städtchens Detmold. Als ehemaliger Soldat war er gedrillt im Gehorsam gegenüber Gott, dem fernen Kaiser und dem Fürsten, seinem nahen Arbeitgeber. Ein Leben lang ein treuer Untergebener.
In seiner Jugend hatte er sich wohl manchmal aufgelehnt – nicht als Proletarier, sondern als Bauer. Von Zeit zu Zeit regten ihn die hochfahrenden Aristokraten auf, aber er verstand ihren Herrschaftsanspruch über Grund und Boden, denn in seinen geheimsten Träumen sah sich Oberwachtmeister Konrad Stroop als Besitzer eines Bauernhofes, wie mir sein Sohn in der Zelle erzählte.
Ich nehme an, dass am 26. September 1895, als sein Sohn Joseph in jener Mühlenstraße geboren wurde, seine Frau Käthe unter dem Federbett hervor zu ihrem Mann sagte:
»Wir beide gehören zwar noch nicht zur guten Gesellschaft, auch wenn dir der Fürst manchmal auf die Schulter klopft und auch zu mir freundlich ist. Aber ich werde alles tun, und du auch, mein Alter, damit aus Joseph etwas wird. Hier in Detmold.«
Das kleine Detmold war seit Jahrhunderten Hauptstadt dieses winzigen Staates und Residenz der Fürsten zu Lippe; früher trugen sie einen Grafentitel.
Im Gegensatz zum nahen Lemgo, der einzigen Hansestadt des Fürstentums, in welcher die unansehnlichen Bürgerhäuser vom merkantilen Geiz der Städtebauer zeugen, besitzt Detmold eine Reihe repräsentativer, ehemals fürstlicher Bauten, die jetzt der Allgemeinheit dienen. Außer Parkanlagen, Plätzen und Alleen, Gewächshäusern, einer Reithalle u.a. verfügt Detmold über einen klassizistischen Theaterbau, in dem seit hundertfünfzig Jahren Opern aufgeführt werden. Außerdem gibt es eine Landesbibliothek, ein lippisches Museum und ein »Heimathaus« mit einer Kunstsammlung, ein fürstliches Verwaltungsgebäude aus dem 17. Jahrhundert und ein ehemals barockes Palais, das im 19. Jahrhundert umgebaut wurde und heute die Nordwestdeutsche Musikakademie beherbergt. Es besitzt noch andere alte Gebäude, eine Gemäldegalerie, eine Gobelin- und Porzellansammlung, eine Altstadt und eine Neustadt, ein Rathaus, mehrere Kirchen der verschiedenen Glaubensbekenntnisse, einen Marktplatz sowie viele kommunale Einrichtungen – darunter einen Brunnen, den Stroop häufig erwähnte, mit den Skulpturen einer Göttin und eines Rehs (den sogenannten Donop-Brunnen).
Vor allem aber ist das Schloss dieser »kleinen, sauberen Garnisonsstadt Detmold« angestammter Sitz derer von Lippe. Diese Burg umfasste im 13. Jahrhundert ein Viertel der gesamten Stadt, die am Zusammenfluss von Werre und Berlebecke liegt. Eine so wehrhafte und zugleich verteidigungsgünstige Herrschaftsresidenz bildete ein wichtiges Instrument für politischen, gesellschaftlichen und moralischen Druck. Beim Anblick der mächtigen Mauern machte der brave Bürger jeden Tag im Geiste seinen Diener; er verbeugte sich vor der Machtfülle des Feudalherrn und der eigenen Bedeutungslosigkeit. Jahrhundertelang gab es für den Bürger von Detmold nur die Wahl zwischen Auflehnung (aber so etwas passierte in Lippe überaus selten) und der Koexistenz. Man wählte in der Regel die Koexistenz. Sie wandelte sich im Laufe von Generationen zu bedingungslosem Gehorsam.
Übereinstimmend mit den Traditionen Westfalens war die Detmolder Burg einst ein von schützenden Wassergräben umgebenes Wasserschloss. Als Stroop geboren wurde, gab es diese Festungsgräben nur noch an zwei Seiten des Schlosses, dessen Grundriss aus vier
Flügeln besteht – was, wie Stroop sich ausdrückte, »den Eindruck von maßvoller Macht« vermittelt. Stroop verstand nichts von Architektur und Kunstgeschichte. Aber seinen recht genauen Schilderungen konnte ich entnehmen, dass das Schloss in norddeutschem Renaissance-Stil erbaut war, mit einigen gotischen Resten.
Nachdem ich das Gefängnis verlassen hatte, fiel mir die Arbeit eines Dr. Gerhard Peters aus Lippe in die Hände. Ich fand darin einen Kommentar über die architektonisch-bildhauerische Ausschmückung des Schlosses: »Die Giebel, Erker, Ornamente sowie alle naturalistischen und abstrakten Verzierungen vermitteln in ihrer Gesamtheit eine romantische Lebensfreude, die die Zuverlässigkeit und das Selbstbewusstsein der herrschenden Familie widerspiegeln.«
Was soll man nur von diesen Detmoldern halten?! Wenn im Jahre 1960 ein Wissenschaftler aus Lippe solch schmeichelhafte Ansichten über die ehemaligen Herrscher dieses Ländchens verbreitet, dann darf man sich nicht wundern, wenn ein anderer Detmolder, der in seiner Jugend mit Aussagen ähnlicher Doktoren gefüttert wurde, nun ebenfalls das Lob dieser Fürstenfamilie sang und von der Notwendigkeit überzeugt war, man müsse Rittergüter in der Ukraine besitzen. Und dass er, genau wie Dr. Peters, hartnäckig an seiner Meinung festhielt. Es war die unerschütterliche Überzeugung von der Rechtmäßigkeit jeglicher Macht, solange sie über die Einhaltung einer »Ordnung« wacht, das heißt, solange sie den Bürger fest im Griff hat.
In Detmold lebten auch gebildete Leute, Gelehrte und Halbgelehrte, Künstler, Schriftsteller, Musiker, Geistliche, Lehrer und sogar Journalisten. Es erschienen zwei, zeitweise auch drei Zeitungen.
Auch regionale wissenschaftliche Gesellschaften, Musikvereine und soziale Verbände hatten hier ihren Sitz. Fürstin Pauline zu Lippe aus dem Hause Anhalt-Bernburg, eine Nichte Katharinas der Großen, gründete in Detmold im Jahre 1802 den ersten deutschen Kindergarten. Stroop erzählte von ihrer sozialen Tat: »Die in ganz Lippe hochverehrte Fürstin Pauline verzichtete damals auf den Kauf von einigen Kleidern und bestimmte das Geld, das sie dadurch gespart hatte, für die Gründung eines Kindergartens. Sie war mit Kaiserin Josephine, der Gemahlin Napoleons, befreundet.« »Mit Josephine, so so! Freundinnen ahmen sich gern nach. Hat eure Pauline ihrem Mann ebenfalls Hörner aufgesetzt?« scherzte ich.
»Warum unterstellen Sie Fürstin Pauline solche Schweinereien?«, empörte sich Stroop.
»Erstens ist es keine Schweinerei, einen ergebenen Geliebten zu haben«, entgegnete ich. »Und zweitens, ganz ohne Spaß, halte ich sehr viel von der Hilfsaktion der Fürstin für Mutter und Kind. Diese Fürstin war für die damaligen Zeiten durchaus fortschrittlich. Und das ist schon sehr viel.«
Hier setzte eine »grundsätzliche« Auseinandersetzung ein. Diskussionen in der Zelle sind eine sportliche Betätigung besonderer Art. Auch ich unterlag diesem Zwang oder auch Bedürfnis, bis ich mich an einen Satz von Puschkin erinnerte, in dem er rät, bei manchen Personen einem Disput aus dem Weg zu gehen.
Die Hügel des Teutoburger Waldes, der vor den Toren Detmolds liegt, sind wunderschön. Grün bewaldete Hänge erstrecken sich bis in die Täler, die von dürftigem Humus bedeckt sind. Eine zauberhafte Landschaft, aber ein felsiger Grund. Über diese Steine sagte mir Stroop einmal:
»Mit dem Boden kenne ich mich aus, Herr Moczarski, ich war Katasterinspektor im Fürstentum Lippe. Es gibt dort viele Steine, die man nicht beseitigen kann, weil sie in der Erde wachsen.«
»Wieso wachsen? Ein Stein lebt doch nicht, also kann er auch nicht wachsen.«
»Sie irren. Steine wachsen im Boden. Auch wenn man es mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Jahr für Jahr kommt eine Schicht dazu, und nach einigen Jahrzehnten wird aus einem Steinchen ein Felsbrocken.«
Stroop kehrte mehrmals zu diesem Thema zurück. Er wusste, dass ich seine Meinung nicht teilte und kannte auch meine Begründung. Es gelang mir aber nicht, ihn zu überzeugen. Schließlich, als er mit seinen Ansichten etwas mutiger geworden war, meinte er:
»Herr Moczarski, Ihre These von den Steinen beweist, dass Sie marxistischem Gedankengut huldigen.«
Im steinigen Lippeland gibt es schöne Wälder, herrliche Nadel- und Laubbäume, kleine Seen, Bäche, romantische Felsengruppen, weite Lichtungen, Wiesen und etwas Ackerland. Es verfügt über reiche Jagdgründe; und wo gejagt wird, gibt es Pferde, Schaftstiefel, Hunde. Und manchmal auch Amazonen.
Vom Jagen sprach Stroop selten. Offensichtlich wurden zu Kaiserzeiten und während der Weimarer Republik weder er noch sein Vater zu den Jagdvergnügungen der Potentaten zugelassen – es sei denn in der Rolle von Bewachern. Über Pferde hingegen – westfälische, schwäbische, fränkische, Detmolder, ostpreußische, friesische, ungarische, polnische, ukrainische, polesische und andere sowie über Pferderassen und -gewohnheiten, über Reitschulen und die Kunst des Lenkens wurde ich bis zum Überdruss aufgeklärt.
Joseph Stroop hatte eine heitere, bäuerlich-bürgerliche Kindheit. Sein Vater war soldatisch streng, chauvinistisch und roch immer nach Pfeife. Er liebte es, mit Freunden beim Bier zu sitzen; und immer, wenn ihm sein Fürst ein Glas Wein oder einen Schnaps spendiert hatte, kehrte er strahlend nach Hause zurück. Die Mutter führte ein strenges Hausregiment. Sie duldete die bäuerliche Herkunft ihres im Polizeidienst stehenden Ehemannes, lebte aber ausschließlich das Leben einer Städterin, mit Nachbarinnen, der Bequemlichkeit der Einkaufsläden, dem täglichen Schwatz auf dem Marktplatz und der Sonntagspredigt des Pfarrers. Ihre Weltanschauung war zwischen der Kirchenkanzel und dem Sofakissen auf dem Fensterbrett angesiedelt.
So ein Fensterkissen ist schon eine praktische Angelegenheit. Man kann sich darauf stützen, ohne den Bauch einzudrücken, dabei stundenlang die Straße im Auge behalten und ohne alle Heimlichkeit die Nachbarn beobachten. Dieses Sofakissen scheint mir eine Antwort der deutschen Frau auf ihre traditionelle Sklavinnenrolle in der ehelichen Gemeinschaft zu sein. Das Kissen macht es möglich, sich mit dem Unterleib innerhalb der Wohnung aufzuhalten, mit dem Auge, dem Ohr und manchmal auch mit dem Mundwerk dagegen außerhalb. »Dabei wurde in Detmold eine Regel genau befolgt«, erinnerte sich Stroop. »Während man auf dem Kissen aus dem Fenster lehnte, musste die Gardine völlig zurückgezogen sein, es sei denn, der Gardinenstoff war durchsichtig. Auf keinen Fall durfte die Frau einen undurchlässigen Vorhang hinter sich haben. Diesen Brauch hatten die Bürger eingeführt«, berichtete Stroop, »nachdem eine Ehefrau ihre eheliche Treue zwar nach außen kund tat, wobei sie einsam aus dem Fenster lehnte, während sich zu gleicher Zeit ihr junger Liebhaber hinter dem schweren, geschlossenen Vorhang wacker mit ihr vergnügte.«
Laut Stroop ging diese Sitte (der offenen Gardine, nicht der Lustbarkeiten der Ehefrauen) auf die Zeit der Hexenverbrennungen zurück. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hatte der Hexenwahn in Lippe einen Höhepunkt erreicht. In Detmold, das 1648 etwa 900 Einwohner zählte, wurden damals 19 Hexen und Zauberer hingerichtet. Die heißblütige Ehefrau eines angejahrten Bürgers, welcher enge Verbindungen zum Teufel nachgesagt wurden, soll diese scheinheilige Gardinenmethode erfunden haben. Es geht hier nicht um die Praktiken eines Fensterkissen-Ehebruchs oder um die Herkunft dieses Brauchs. Auch nicht um die Geschichte der Grausamkeiten unter den europäischen Völkern. Das Problem, das unsere Aufmerksamkeit verdient, liegt in der Hypothese, dass beständiges Unrecht, das im Namen des Dogmas vom widerspruchslosen Gehorsam gegenüber mächtigen Führern geduldet wird, bei gleichzeitigem Fehlen einer erzieherischen Gegenwirkung die Psyche der Menschen auf die Dauer deformiert. Als Beispiel eines in jener Zeit vielleicht ganz normalen Unrechts kann die Behandlung der Hexen in Lippe dienen. Ihre Zahl – sie betrifft zwei Prozent der Einwohner Detmolds – ist erstaunlich hoch. So als würde man heute 26000 bis 28000 Einwohner Warschaus auf dem Scheiterhaufen verbrennen.
Eines Tages klaute der kleine Joseph seiner Mutter das Sofakissen und rutschte damit auf dem Hof ein Brett hinunter. Er wollte seine Hose schonen. Die Mutter versohlte ihn nach diesem Experiment so gründlich, dass er es zeit seines Lebens nicht vergaß.
Von da an war Joseph auf eine mustergültige Weise gehorsam und folgte den Eltern aufs Wort. In der Gefängniszelle, während unserer Gespräche über die Vergangenheit und unsere Kindheitsabenteuer, unterstrich Stroop immer wieder, dass die soldatische Disziplin seines Vaters und die Strenge der Mutter seinen Charakter geformt und ihn vor übermäßigem Individualismus bewahrt hätten.
»Befehl ist Befehl, Herr Moczarski! Die Mächtigen haben immer Recht« (er dachte wohl an seinen Vater, an den Fürsten zu Lippe und an Himmler), »und Gott ist auch dafür« (hier erinnerte er sich wahrscheinlich an seine frömmelnde Mutter und an Wotan).
Die nächsten Prügel, diesmal nicht mehr auf den Hintern, bekam er um die Weihnachtszeit, lange vor dem Ersten Weltkrieg.
Nach altem westfälisch-detmoldschem Brauch versteckten die Eltern Weihnachtsgeschenke in den Schuhen ihrer Kinder. Der aufgeregte Joseph stellte fest, dass seine Pantoffeln leer waren, weil sich sein Bruder das für ihn bestimmte Geschenk »ausgeliehen« hatte. Also verdrosch er ihn. Die Mutter erwischte die beiden Kinder mitten in der hitzigen Prügelei. Sein Bruder hatte eine blutige Wange, und Josephs Augen funkelten vor Wut. Die Mutter versetzte Joseph ein paar schallende Ohrfeigen. Als jedoch der Vater erschien, lobte er seinen blauäugigen Erben dafür, dass er den »Dieb« verprügelt hatte, obwohl sein Bruder der Schwächere war. Auf diese Weise weihte der Oberwachtmeister seine Kinder schon damals in die Methoden deutschen Handelns ein: »Mein Sohn, prügele deine Feinde ohne Mitleid und so fest du kannst, so wie ich die Feinde des Vaterlandes verprügelt habe und auch Knopf, diesen Habenichts aus dem Walddorf, als er versuchte, Frau Direktor Müller ein Huhn zu stehlen!«
Die Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, gab ihrem Mann aber später Recht. Der Sohn hatte mit Hilfe des Vaters und Polizisten gesiegt. Und doch war die Mutter bedrückt. Vielleicht hatte sie bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal das stahlharte Aufblitzen in den Augen ihres Sohnes bemerkt.
Josephs Kindheit verlief vorwiegend fröhlich, obgleich nicht alle seine Wünsche in Erfüllung gingen. Der Vater hatte ein bescheidenes Einkommen, aber die Mutter wirtschaftete sparsam, so dass sie einigermaßen leben konnten. Dazu zeigten sich die Nachbarn in der Stadt und die Bittsteller vom Lande dem Polizeichef für Hilfe, Schutz und legale Begünstigung erkenntlich.
Schon frühzeitig erwachte in Joseph das Verlangen nach irdischen Gütern. Er sah die eleganten Damen und vornehmen Herren im Park des Fürsten. Frau S., die Gattin des Zigarren-Hoflieferanten, trug ständig Seidenkleider, Spitzen und Brillanten und besaß eine Kutsche. Sein Schulfreund Kurt W. hatte ein Pony, und Luise, die Tochter des Möbelfabrikanten, konnte so viel Schokolade essen, wie sie wollte.
Den größten Reichtum aber verkörperte für den kleinen Stroop ein stattlicher Landauer mit zwei weißen Pferden. Er vergaß nie den Anblick Seiner Hoheit, des Fürsten zu Lippe-Detmold, während einer Ausfahrt durch die Alleen des Schlossparks, wobei der Potentat huldvoll die Ergebenheitsbezeugungen seiner Untertanen entgegennahm. Ergriffen erzählte Stroop immer wieder, wie sich entlang des Weges die festlich gekleideten Beamten, Gutsbesitzer, Offiziere, Kaufleute und Pensionäre samt ihren Familien aufstellten. Die Herren verbeugten sich feierlich oder legten die Hand an die Mütze, wobei sie die Hacken zusammenschlugen. Die Damen, feierlichen Zeremonien ohnehin zugetan, knicksten tief, während sie ihre Röcke ausbreiteten. Und der Vater, Oberwachtmeister Stroop, hielt den Kleinen an der Hand und flüsterte:
»Sieh hin und vergiss nichts! Das ist unser Fürst, unser Herrscher. Bleibe ihm immer ergeben und gehorsam wie ich, mein Sohn!«
Und sie verbeugten sich tief und untertänig, die beiden Stroops.
Joseph schwor sich im tiefsten Herzen, »unserem« Herrn bis ans Lebensende treu zu dienen, und beschloss gleichzeitig, eines Tages näher in das Zentrum der Macht vorzudringen. Er hatte das bescheidene Haus an der Mühlenstraße satt und auch den mühsamen Fußdienst des Vaters. Er wollte ein Pferd besitzen, viel gutes Essen und in seinem künftigen Haus einen Salon. (Von einem Landgut träumte er damals noch nicht.)
Der Mutter tat es weh, dass sie, die Stroops, dem Schloss und dem Fürsten so nahe waren, und dennoch so weit von den »Spitzen der Gesellschaft« in der Stadt und im Umland entfernt. Denn dieses Umland machte sich oft in den Straßen Detmolds bemerkbar, mit einer Kette von Pferdekutschen, Einspännern, Fuhrwerken und Reitern. Die Stadt war dann voll von Gutsherren und schönen, eleganten Frauen. Die Kaufleute machten ihre tiefen Bücklinge, die Gehilfen und Lehrlinge trugen Pakete zu den Wagen und schnupperten die teuren Parfüms der adeligen Damen. In den Fenstern waren alle Sofakissen belegt. Und durch Detmold schwirrten Klatschgeschichten aus der feinen Welt.
Die allergrößte Verehrung aber genoss in Lippe die Uniform. In das gastliche Fürstentum kamen in Ruhestand lebende Bürger aus ganz Deutschland, darunter viele Militärs. Denn in Lippe-Detmold lebte man billig, das Klima war gut, und der nötige Respekt für einen Offiziersrang und Orden war auch vorhanden. Ich vermute, dass kein pensionierter General auf die Idee gekommen wäre, sich in Detmold niederzulassen. Für solche Persönlichkeiten war das Städtchen zu klein und zu langweilig. Auch Oberste waren sicher an den Fingern beider Hände abzuzählen. Aber angejahrte Majore, Hauptleute und Oberleutnants aus der Zeit von Sedan und etwas jüngere von der Kolonialarmee, den Husaren-, Ulanen-, Artillerie-, Jäger- und Infanterieregimentern gab es in Überzahl. Die ganze Stadt strömte zusammen, wenn sich diese Veteranen in ihren historischen Uniformen zu den Jubiläen, Jahrestagen und Zapfenstreichen bei Fackelschein und Musik versammelten. Väter, Frauen und Kinder erbauten sich an den militärischen Festreden und Auftritten, sie sangen das »Niederländische Dankgebet«, »Die Wacht am Rhein« und »Deutschland, Deutschland über alles«. So nahmen sie teil an der militärischen Vergangenheit des Landes und ihres Fürsten.
Die Wurzeln der Tradition reichten tief. Bei Detmold war es, wo Arminius-Hermann, Herzog des germanischen Stammes der Cherusker, im Jahre 9 n.Chr. die vieltausendköpfigen römischen Legionen unter Führung des Varus besiegt hatte.
»Die Cherusker, die tapfersten unter den Germanen, sind unsere Vorfahren«, verkündeten die Einwohner von Lippe, darunter auch Stroop. »Wir stammen von ihnen ab. Wir, das Kernland des Reiches im Teutoburger Wald!« Lippe war stolz auf diese teutonische Abstammung. Auch der Vater von Stroop (wobei er vergaß, dass er eigentlich aus Westfalen stammte), auch die Mutter, und stolz bis in die kurz geschorenen Haarspitzen war auch Joseph (Jürgen) Stroop. Schon in frühester Kindheit hatte er Hermann dem Cherusker und der germanischen Rasse die Treue geschworen, obwohl die rassistisch-germanischen Theorien damals noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hatten. Aber das Denkmal Hermann des Cheruskers erhob sich bereits über dem Fürstentum Lippe. Es formte die Seelen des »Herrenvolkes«, war ein Symbol Germaniens, Erinnerung und – wie Stroop sich ausdrückte – Mahnung für die Deutschen.
Mit dem Bau des Denkmals wurde im Jahre 1838 auf dem Hügel der Groteburg bei Detmold begonnen. Der Entwurf stammte von Ernst von Bandel, der wie Millionen Deutsche von der pangermanischen Idee durchdrungen war.
Bis zum Beginn des Krieges zwischen Preußen und Frankreich kam der Denkmalsbau nur schleppend voran. Bis dahin hatte man lediglich den 28 Meter hohen Sockel errichtet. Erst der Sieg Bismarcks über Frankreich und das Gold, das aus den Wiedergutmachungszahlungen der Franzosen floss, gestattete einen beschleunigten Weiterbau. Der Reichstag bewilligte 10000 Taler, Kaiser Wilhelm I. steuerte 9000 bei, auch der Eiserne Kanzler stellte einen Teil seiner Siegesprämien für die Niederschlagung Frankreichs zur Verfügung. Alle Fürsten, Grafen, Freiherren, Generale, alle Landjunker, Gutsbesitzer, Industrielle, Bankiers, Kaufleute und Bauern steuerten ihr Scherflein bei. Sie unterstützten mit Vorliebe Unternehmungen, die den deutschen Nationalismus stärkten. Besonders jetzt, da der Mythos Preußens, welches die Deutschen zum Sieg geführt und auch gezeigt hatte, wie dieser Sieg verwirklicht werden konnte, zum Symbol für eine treu preußische, alldeutsche und pangermanische Haltung geworden war.
Die Gestalt Hermann des Cheruskers (26 Meter hoch) wurde eilig aus Kupferblech gehämmert und auf den fertigen Sockel gehoben, und im Jahre 1875 wurde das 14-stöckige Denkmal höchst feierlich enthüllt. Kaiser Wilhelm I. war in Begleitung von Königen und deutschen Fürsten erschienen. Die Stadt lebte in einem nationalistischen Taumel, was ihr übrigens nicht schwerfiel.
Der riesige Hermann der Cherusker, mit einem sieben Meter langen, gen Himmel gereckten Schwert, fand seinen Standort auf der Teutoburger Anhöhe dank einer Initiative Detmolds, auf Wunsch der deutschen Führung und mit Hilfe des Goldes, das den Franzosen abgenommen worden war.
Der Cherusker fand sich auch in den Kontenbüchern des Fürsten zu Lippe wieder, der seine feudal-herrschaftliche Position mit den neuen Errungenschaften des Industrie- und Handelskapitalismus zu verbinden trachtete. Der Fürst war gewiss der Meinung, dass »die Macht des Geldes hundertfach größer ist als die des Schwertes ... von Hermann dem Cherusker«, um ein altes chinesisches Sprichwort leicht abzuwandeln – und er sorgte dafür, dass die Pfennigbeträge für die Denkmalsbesichtigung in seine Kassen flossen, wie Stroop mir in der Zelle berichtete. Das Denkmal selbst war schlau konstruiert. Um unmittelbar vor der Gestalt des Arminius zu stehen, musste der patriotische Pilger über Treppen, die durch das Innere des Baus führen, eine Terrasse betreten, von der sich ein weiter Ausblick auf urdeutsches Land bot. Für den Zutritt zu den Knien des Cherusker-Herzogs musste ein Beitrag an den amtierenden Fürsten zu Lippe entrichtet werden. Diese mühelos erworbenen Einnahmen konnte Stroop seinem Herrn nicht verzeihen.
»Sagen Sie doch selbst, Herr Moczarski, ist es patriotisch, Geld von jenen zu verlangen, die zum Denkmal des großen Germanen gepilgert waren, um ihr Nationalgefühl zu stärken?«
»Eine solche architektonische Konstruktion des Denkmals«, bemerkte ich, »erfordert Aufsicht und Pflege. Der Fürst war für das Denkmal verantwortlich, also musste er Abgaben für die Instandhaltung einziehen.« »Er bezahlte nicht nur die Renovierungskosten, sondern verdiente jahrelang an dem Denkmal. Ich weiß das von meinem Vater.«
Kehren wir noch einmal zum Geld der Franzosen zurück, mit dem das Cherusker-Denkmal erbaut wurde. Denn bereits zum zweiten Mal machten sich die Bürger von Lippe Gold aus Frankreich zunutze, das ihnen die Kriegskonjunktur beschert hatte.
Schon 1759 machten sie im Detmolder Schloss klingende Kriegsbeute, die auf eine Million Gulden geschätzt wurde. Es war das Vermögen größerer französischer Militäreinheiten, deren Generäle nach der Schlacht von Minden im Schloss von Detmold Schutz gesucht hatten, bevor man sie dort wieder hinauswarf.
Ich bin Journalist und kein Historiker. Daher kann ich mir die sehr wahrscheinliche Annahme gestatten, dass diese Million den Herrscher von Lippe und seine Armee (ein Bataillon!) so faszinierte, dass das im Siebenjährigen Krieg bis dahin neutrale Heer alle seine Neutralität vergaß und, als der Feind geschwächt war, das Schloss mitsamt den Gulden in seine Gewalt brachte.
In dieser Überzeugung bestärkt mich der Direktor des Archivs von Detmold, Dr. Erich Kittel, der in einem historischen Abriss der Stadt schreibt, dass nicht das Vermögen des französischen Heeres, sondern ein umfangreicher Generalstross im Wert von einer Million Gulden von »den mit den Preußen vereinten Einheiten« erobert wurde. Um welche »Einheiten« mag es dem Archivar aus Detmold wohl gehen, wenn er vergisst, ihre Nationalität zu erwähnen? Doch wohl um die an Ort und Stelle ansässigen, geldhungrigen Krieger von Lippe und ihren obersten Chef und Fürsten? Sie waren kampflos zu Geld gekommen! Man kann die Geschicklichkeit derer von Lippe-Detmold sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten nur bewundern.
Ihre Schlauheit und ihre Wirklichkeitsnähe imponierten Stroop ungemein.
Joseph Stroop gehörte nicht zu den begabten Schülern, obwohl die Mutter, die in ihm gern die Verwirklichung ihrer Träume gesehen hätte, die Ansicht verbreitete, er sei ein gescheiter und begabter Junge. Er war gründlich, fleißig, pedantisch sauber, immer glatt gekämmt und hatte eine schöne Handschrift, obwohl man ihm das Alphabet erst spät beigebracht hatte. Mit Vorliebe zeichnete und malte er Parolen, Eichenlaubgirlanden und Waffen. Ich merkte schnell, dass er die deutsche Literatur überhaupt nicht kannte, nicht einmal das, was man in der Schule mitbekommt. Für banale Schrifterzeugnisse empfänglich, verachtete er seine Altersgenossen, die intellektuelle Begabung oder Interesse für humanistisches Gedankengut verrieten. (»Bücherwürmer und Talmudisten« nannte er sie in unseren Zellengesprächen.) Er schwärmte für körperliche Kraft, Pferde- und Sattelgeruch. Uniformen und militärische Rüstungen zogen ihn unwiderstehlich an, dazu Auszeichnungen, Orden, Rangabzeichen und äußerer Drill.
Moralischer und körperlicher Mut dagegen gehörten nicht unbedingt zu seinen Vorzügen. Wir unterhielten uns einmal in der Zelle über Angst, Furcht und Grauen. Schielke hatte man gerade zur Gefängnisverwaltung gerufen. Stroop schien gelockerter und irgendwie ehrlicher als sonst. Er sprach von seinen Flegeljahren und erzählte, wie er vor Angst geschwitzt hatte, als er mit einigen Jungen über die aus dem Wasser ragenden Steine eines Gebirgsflusses springen sollte. Und als er von seinen Schulerlebnissen sprach, erwähnte er, dass es ihm unmöglich gewesen sei, dem Befehl eines Lehrers (eines ehemaligen Offiziers) zu widersprechen, der von ihm den Namen eines Schulfreundes verlangte, welcher dem Lehrer einen Streich gespielt hatte. Stroop verriet den Kameraden. Der Übeltäter wurde daraufhin ziemlich streng bestraft. Den Äußerungen Stroops konnte man entnehmen, dass er es grundsätzlich für falsch hielt, sich gegen einen Vorgesetzten aufzulehnen. Vor allem, so schien mir, fürchtete er sich vor dem Lehrer-Feldwebel. Seinen Schullehrern war er übermäßig ergeben. Das führte zu Schwierigkeiten mit einem kleinen Teil seiner Schulkameraden.
Die Mutter kannte ganz Detmold. Noch bevor sie den Oberwachtmeister Konrad heiratete, war sie häufig dem Fürsten begegnet, der mit vielen Bewohnern seines Fürstentums, den Beamten und deren Familien, unmittelbaren Kontakt pflegte. Der Fürst mochte Käthe Stroop, die loyal, ansehnlich und hübsch war. Ihr Aussehen hatte sie offensichtlich auf ihren Sohn vererbt. Obgleich er feingliedrig war, wirkte der Junge sehr männlich. Schon als Kind und später als junger Mann überragte er seine Altersgenossen um Haupteslänge. Er war 1,82 cm groß.
Die Volksschule besuchte er in Detmold, anschließend begann er am 1. April 1910 in der Steuerabteilung des Katasteramtes zu arbeiten.
In seinem Lebenslauf als SS-Mann schreibt Stroop, er sei zu jener Zeit »Katasteramtsanwärter« bei der lippischen Regierung gewesen. Das klingt vergleichsweise wie »junger Beamter beim Präsidium des Ministerrates«. Stroop hatte eine Vorliebe für leitende Stellen, und in Detmold war die Mehrzahl der Ämter »leitend«, natürlich im Maßstab dieses Mini-Staates.
Da Stroop in seinen Personalakten, in polnischen und amerikanischen Untersuchungsprotokollen sowie in den Gerichtsunterlagen und verschiedenen Publikationen als Mann mit höherer Schulbildung geführt wird, wollen wir hier auf Grund der Gespräche mit Stroop und der vorhandenen schriftlichen Beweise festhalten, dass Joseph (Jürgen) Stroop keine höhere Bildung besaß. Er begann nämlich unmittelbar nach seiner Schulentlassung im Katasteramt zu arbeiten, und zwar im Alter von genau 14 1/2 Jahren. Alle anderen Arten von »Studium« bestanden in kurzen Fortbildungslehrgängen, sowohl im Vermessungsbereich als auch im Rahmen des Polizei- und Parteiunterrichts bei der SS.
Da er ziemlich schmal war, bewunderte er athletische Schultern und Ringergestalten. Der Sport spielte eine große Rolle in seinem Leben. Er übte oft mit Hanteln. Schulappelle mochte er besonders. Seine Sportlehrer lobten ihn wegen seiner vorbildlichen Haltung beim Strammstehen. Während vieler Wanderungen lernte er die Umgebung von Detmold und das übrige Fürstentum kennen. Er war empfänglich für die Schönheit der Natur, vor allem aber für die soldatischen und nationalistischen Traditionen seines Volkes. Oft erzählte er voller Stolz vom sogenannten »Weg Hermann des Cheruskers« im Teutoburger Wald und von der Kampfstätte, auf der die »schwarzgelockten Römer entweder vernichtend geschlagen wurden oder feige geflohen waren«. Er erwähnte die lippischen Schlachtfelder (zum Beispiel die Stelle, wo Karl der Große gegen die »abtrünnigen« Sachsen gekämpft hatte) und die ihm, wie ich meine, wie eine sanft verklärte Landschaft erschienen.
In seinem Heimatstädtchen, wo Schwäne über den Schlosskanal glitten, spürte er niemals Langeweile. Hatte er einmal nichts zu tun, dann spazierte er mit seinen Kameraden über die städtische Promenade. In Detmold gab es zwei oder drei größere Straßen bzw. Alleen. An Nachmittagen flanierte dort die örtliche Jugend, und zwar Jungen und Mädchen getrennt. Hier war ihr »Salon«, der Schauplatz ihrer Flirts und ihrer ersten aufkeimenden Wünsche, der Ort, an dem man seine neuen Kleider und sein Erwachsensein zur Schau stellte. Wenn das Wetter es zuließ, waren alle Fenster von Sofakissen-Damen besetzt.
Stroop war ein schlanker, dunkelblonder Mann; er hatte blaue Augen mit einem grünbraunen Schimmer und bewegte sich – er ging nicht, sondern schritt – mit typisch provinzieller Eleganz, die er bis an sein Lebensende beibehielt: Er schlenkerte leicht mit den Armen. »Wie sieht er doch männlich aus« (er hatte eine fleischige Adlernase), »und dabei so vornehm!«, seufzten wahrscheinlich die Detmolder Mädchen, in Küchen und Kirchen erzogen, unter dem wachsamen Auge ihrer mit Sofakissen bewehrten Mütter. Sogar die Töchter der örtlichen Honoratioren und der Gutsbesitzer aus der Umgebung blickten ihm schmachtend nach, obwohl ihr Stolz und die elterlichen Verbote ihnen niemals eine Unterhaltung oder gar einen Spaziergang mit Joseph Stroop, dem Sohn des Oberwachtmeisters, gestattet hätten.
Stroop besaß von klein auf eine Vorliebe für Pferde und träumte lange von einem Paar Reitstiefel. Der Vater war mit dieser Anschaffung einverstanden, da sie die soldatischen Neigungen des Sohnes verriet. Die Mutter jedoch konnte das Geld nicht entbehren. So musste der kleine Joseph lange sparen. Er nahm leichte Aushilfsarbeiten an und auch Trinkgelder und kaufte sich schließlich die Stiefel. Täglich putzte er sie mit Schuhwichse und spuckte dazu auf die Schuhbürste. Wenn er über die Bismarckstraße, den Markt und die Lange Straße spazierte, stellte er immer wieder zufrieden fest, dass sich die »wunderschöne Stadt« in den blanken Schäften spiegelte.
Nur wenn er vor dem Denkmal Hermann des Cheruskers stand oder in den Auen des Teutoburger Waldes die »blonde Marta mit den Rosenlippen« küsste, vergaß er seine Stiefel. Stroop war in Marta verliebt und verehrte die Rose, die das Wappen des Fürstentums Lippe schmückte. Diese Rose befand sich auch im Stadtwappen von Detmold (eine stilisierte Blüte vor dem Hintergrund des Stadttores).
Der Teutoburger Wald, Hermann der Cherusker und die Rose sind die Symbole des Landes Lippe. Aber eine Rose ist viel zu poetisch und zart, um für immer im Herzen eines Nachkommen der tapferen Cheruskerkrieger zu verweilen. Wem steht schon der Sinn nach Rosenblüten, wenn Hermanns Schwert so entschieden den Weg weist. Soll sie doch im Wappen Lippes blühen, mögen Dichter, Schöngeister und Individualisten sie besingen! »Für die Menschen von Lippe war das Schwert immer wichtiger«, meinte Stroop einmal. »Das Schwert und die Sklavenkette«, fiel ich ihm ins Wort.