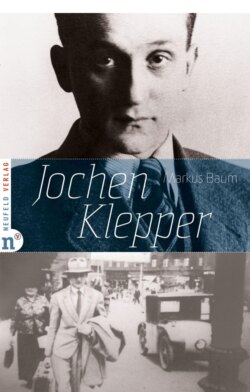Читать книгу Jochen Klepper - Markus Baum - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Revolution
ОглавлениеDer Schulunterricht ist vermutlich noch das Stetigste an den Jahren in Glogau. Die Revolution und die Abdankung des Kaisers im November 1918 erschüttern das Weltbild Georg Kleppers und Erich Fromms und des gesamten Bürgertums, mit Preußens Glanz und Gloria ist es vorbei. Das Kriegsende bringt die Demobilisierung von Millionen Soldaten, und das krempelt eine Garnisonsstadt wie Glogau natürlich kräftig um. Das Preußische Kultusministerium hebt am 27. November die geistliche Schulaufsicht auf, damit wird auch das katholische und das evangelische Gymnasium der staatlichen Aufsicht unterstellt. Die am 11. November gegründete Republik Polen erhebt Anspruch auf Teile Ober- und Niederschlesiens, es formieren sich polnische Milizen ebenso wie deutsche »Bürgerwehren«. Anfang 1919 organisieren die Kommunisten im oberschlesischen Kohlerevier flächendeckende Streiks. Anfang Februar, noch bevor die eben gewählte Weimarer Nationalversammlung zusammentritt, kommt es zu ersten bewaffneten Zusammenstößen zwischen polnischen Aufständischen und Einheiten des »Freiwilligenkorps Schlesien«. Streiks und Demonstrationen mal für, mal gegen den Anschluss an Polen beherrschen die Schlagzeilen bis zur Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28. Juni. Der Vertrag erklärt 80 Prozent Oberschlesiens zum Abstimmungsgebiet. Bis der Oberste Rat der Siegermächte die Modalitäten der Volksabstimmung festlegt, werden weitere eineinhalb Jahre vergehen – eine Zeit voller politischer Agitation. Schlesien erlebt in dieser Zeit drei blutige Aufstände und massive Gegengewalt. Am Mittellauf der Oder, also auch auf der Höhe von Glogau und Beuthen, rückt die Grenze zur Republik Polen bis auf 20 Kilometer heran. Ein Großteil der preußischen Provinz Posen ist verloren; Fraustadt, östliche Nachbarstadt von Glogau, verbleibt nur aufgrund seiner deutschen Bevölkerungsmehrheit beim Deutschen Reich. Die Bahnstrecke von Glogau über Lissa nach Posen ist nach knapp 70 Jahren Betrieb gekappt.
Die Welt des Jochen Klepper bekommt also auf einmal einen östlichen Rand, markiert durch Grenzzäune und Schlagbäume. Stabilität in der neu gegründeten Republik garantieren neuerdings die Sozialdemokraten, die der »eiserne Kanzler« Bismarck eine Generation zuvor noch massiv bekämpft hat und die bis zum Krieg von den rechtsnationalen Parteien und Vereinen als »vaterlandslose Gesellen« geschmäht worden sind.
Wie geht der Heranwachsende mit diesen Veränderungen um? Nun, auf der einen Seite nimmt er durchaus Notiz, beobachtet sorgfältig, sammelt Zeitungsausschnitte, ohne großartig zu reflektieren, was er da liest. Die Auswirkungen des Krieges auf die Versorgungslage, der Umgang mit den Kriegsheimkehrern, das beschäftigt ihn schon. Andererseits erschließt er sich just zu dieser Zeit eine andere Welt, die Welt der Dichtung. Er schwärmt für die Romantiker; unter den Dichtern der Gegenwart ist Rilke sein Leitstern. Seine ersten poetischen Versuche mit 16 sind noch sehr idyllisch, da kommt die in Scherben gefallene wirkliche Welt nicht vor. Da verbluten nur die Sonnenstrahlen, die »schweren schwarzen Wolken« ziehen nur dahin, entladen sich nicht. Und deshalb lächelt der Dichter am Ende. Einzelne, spontan verfasste Gedichte gibt er im Kreis der Familie zum Besten, manchmal kommt auch ein Gast in den Genuss. So berichtet der zwei Jahre jüngere Kurt Müller-Osten später von einem Ferienaufenthalt in Beuthen und einer nachmittäglichen Kaffeestunde, bei der Hedwig Klepper sichtlich stolz ein Naturgedicht Jochens vorträgt – »anscheinend gerade bei einer Zigarette entstanden, der Rauch lag noch in der Luft, das hat mir mächtig imponiert.«9 Die ernsthafteren Versuche zeigt er nicht jedem. Aber der 20-jährigen Arztfrau Brigitte Hacker. Die einzigen erhaltenen Gedichte aus dieser Anfangsphase seines literarischen Schaffens (»Lieder der Nacht«) finden sich später bei ihr.
Seinem Quartiergeber und vereinnahmenden väterlichen Freund, dem Oberlehrer Erich Fromm, ist indessen nicht nach Lyrik zumute. Er kann sich mit den neuen Verhältnissen nicht anfreunden, vermutet eine jüdisch-linke Verschwörung und sympathisiert offen mit den rechtsnationalen Putschisten, die im März 1920 die Reichsregierung stürzen wollen. Fromm überspannt den Bogen, als er seine Schüler eine Würdigung der Militärdiktatur schreiben lässt. Die Dienstaufsicht ermittelt, am Ende wird Erich Fromm strafversetzt, aber er weigert sich, die Stadt zu verlassen. Und so bleibt Jochen Klepper unter Fromms Obhut, bis er sein Abitur gemacht hat. Das Reifezeugnis vom 9. März 1922 attestiert ihm ein »Gut« in Religion und Deutsch, »Völlig genügend« in Französisch und Geschichte, »Genügend« in Latein und Griechisch. In Mathe und Physik war er eine Niete. »Vom Turnen war er befreit.«
Jochen Kleppers Verhältnis zu seinem Vater ist am Ende der Schulzeit garantiert nicht mehr ohne Schrammen, nicht mehr so innig und selbstverständlich wie in der Kindheit. Aber auch nicht gebrochen. Zum Bruch wird es erst Jahre später kommen. Sein erster ernsthafter Berufswunsch: Er will Pfarrer werden wie der Vater. Und das Theologiestudium nimmt er vielleicht nicht dem Vater zuliebe auf, jedenfalls nicht nur. Aber auch nicht dem Vater zum Trotz. Georg Klepper und seine Frau fördern ihre Kinder durchaus nach ihren Neigungen, drängen sie nicht mit Gewalt in eine bestimmte Richtung. Auch Jochen nicht. Es ist ihm Ernst mit dem Theologiestudium. Noch viele Jahre später wird er bedauern, »dass ich nicht Pastor geworden bin; denn das wird ja doch meine heimliche Sehnsucht bleiben«. Predigen können wie der Vater – auch das motiviert ihn. »Das Pfarramt und das Pfarrhaus«10 wird er später regelrecht verklären und idealisieren: »Der Höhepunkt meiner Familiengeschichte war das Pfarrhaus gewesen.«11 Und wer hat das Pfarrhaus zu einem solchen gemacht? Natürlich Georg Klepper, sein Vater. An dem er vieles bewundert, von dem er bei aller Andersartigkeit auch manches geerbt hat, nur die Statur nicht.