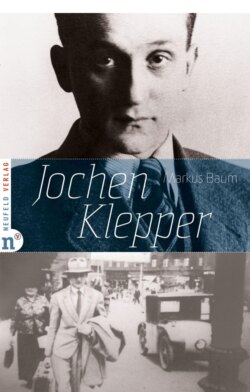Читать книгу Jochen Klepper - Markus Baum - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Erzähler
ОглавлениеWenn die Rundfunkkritiken Pflicht sind, gehören die Gedichte gewissermaßen zum Kurzprogramm. Die Kür, das sind Novellen und ausgewachsene Romane, und die konzipiert Jochen Klepper 1929 gleich reihenweise. Rudolf Hermann berichtet er von diesen ungeborenen Kindern: »Ich habe einen Verleger für meinen Voltaire-Roman gefunden (Speidel/Wien) [...] Für meine weiteren Romanexposés interessiert sich bereits ebenfalls Speidel. Es handelt sich um eine Schaubuden-Attraktions-Biographie ›Frick-Frack und Elvira‹, die Geschichte einer klugen, hässlichen Frau, Madame Dr. D. Valeska Cohen«, »Die große Directrice«, wieder die Lebensgeschichte einer hässlichen, liebenden Frau, und einen Revolutionsroman ›Marquise Schornsteinfeger‹ ... Vergessen habe ich noch ›Die goldene Stimme‹, einen Rundfunkroman.«54 Und ein Artistenroman gesellt sich auch noch dazu.
Die meisten dieser Stoffe arbeitet Jochen Klepper nicht wirklich aus, gibt ihnen allenfalls eine kleine Form. »Die goldene Stimme« wird er als Erzählung im Fränkischen Merkur, in der Wochenbeilage der Frankfurter Nachrichten und in Reclams Universum unterbringen. Eindrücke, die er für den Schaustellerroman »Frick-Frack und Elvira« gesammelt hat, fließen in Artikel für die Breslauer Zeitung und für Landsbergers Schlesische Monatshefte ein, finden sich in der Sonntagsbeilage »Frau und Welt« der Deutschen Allgemeinen Zeitung. »Die Geburt des Voltaire« (über dieses erste Kapitel ist er nicht weit hinausgekommen) erscheint als in sich abgeschlossener Beitrag in der Leipziger Volkszeitung. Mit einem Roman über Voltaire wird er bis an sein Lebensende liebäugeln; der knorrige Philosoph und Spötter ist für ihn geradezu prototypisch. Es reizt ihn, sich »entstellte, liebende, erfolgreiche Menschen« vorzustellen. Die tragische Spannung zwischen Lebenserfüllung einerseits, Versagung, Verlust oder Scheitern andererseits, daran will er etwas deutlich machen. Es geht ihm in seiner künstlerischen Arbeit »immer nur um Menschen, die sich erkennen, die erfahren, dass diese Selbsterkenntnis ein von Gott-erkannt-Werden ist, dass in diesem Vorgang Gott sich ihnen offenbart«, erklärt er Rudolf Hermann.55
Bis zur Druckreife gedeiht im Lauf der Zeit immerhin eines der vielen Projekte: »Die große Directrice«. Ein im Modemilieu angesiedelter Roman. »Das Buch behandelt in dem Aufstieg einer großen Modeschöpferin und ihres Hauses die modische Entwicklung um die Jahrhundertwende. Die Mode ist aufgefasst als Zeichen für die Bereitschaft des Menschen, die Vergänglichkeit alles Lebendigen einzusehen und dennoch die Schönheit des Irdischen in unser Leben aufzunehmen, als gälte sie für immer ... Durchgehend sind in meinem Buch das Endlichste und das Unendliche, das Flüchtigste und das Bleibende ineinander gespiegelt«56, so skizziert Jochen Klepper das Thema. Es beschäftigt ihn Ende 1929 sehr. Wie sehr, das wird aus den Erinnerungen von Kurt Meschkes Verlobter Eva-Juliane Anker deutlich. Sie forscht zu der Zeit an der Breslauer Universität über den schlesischen Barockdichter Johann Christian Günther. Die Tochter des renommierten Architekten und Bausachverständigen Alfons Anker ist jüdischer Abstammung, der Vater ist 1920 zum christlichen Glauben evangelischen Bekenntnisses konvertiert. Sie kennt Jochen Klepper bis dahin nur aus den Berichten ihres Verlobten vom Arbeitsplatz.
Die erste persönliche Begegnung findet »mitten im Getriebe des Verkehrs auf einer Straßeninsel stehend« statt. Fräulein Anker und Kurt Meschke warten auf die Straßenbahn. Da taucht Jochen Klepper auf, Meschke weist sie auf ihn hin: »einen schmächtigen, unscheinbaren jungen Mann in etwas fadenscheinigem, in meiner Erinnerung nicht ganz reinem dunkelblauen Anzug. Er blieb stehen, begrüßte uns. Ich sah in zerfließende, doch von innerer Erregtheit bebende Züge. Der Mund schien immerfort erzählen zu wollen. Die Augen waren voller Gesichte. – Trotz der Flüchtigkeit dieser ersten Begegnung erwähnte er sofort einige Änderungen, die er an seinem Roman ›Die große Directrice‹ vornehmen wollte. Der schien alle seine Sinne auszufüllen, und stillschweigend setzte er offenbar voraus, dass ein Stoff wie dieser auch alle Umwelt – bekannte wie unbekannte – in seinen Bann ziehen müsste. Es handelte sich um einen groß angelegten, hintergründigen Moderoman, der das ›Glück der Vergänglichkeit‹ aufzeigen sollte. An zwei von Grund auf entgegengesetzten Gestalten wollte er es entfalten: eine schwere, ungefüge Frau, vitale, fantasievolle Schöpferin erlesener, kulturgeprägter Modewerke für andere, sollte dazu verurteilt sein, selbst nie anders als unförmig, unelegant und ohne Anteil an ihren eigenen Kreationen auftreten zu müssen. Die Gegenspielerin zu dieser spannungsreichen Gestalt, eine kleine, zierliche, hochintellektuelle Jüdin, befand sich zu der Zeit gerade auf einer Studienreise in Ägypten und pflegte von dort ›herzliche Grüße aus der Wüste‹ zu senden. – Trotz der Fülle von Begebenheiten, die Jochen Klepper sonst noch aus Afrika und von den übrigen Schauplätzen des Romans zu berichten gehabt hätte, mussten wir die Straßeninsel in verschiedene Richtungen verlassen.«57
Wie bei allen seinen Erzählungen hat Jochen Klepper das Metier, in dem der Roman spielt, erst einmal gründlich erkundet, hat jedes noch so nebensächlich erscheinende Detail recherchiert. In Sachen Mode kann er sich auf das Urteil einer Frau vom Fach stützen. Diese Gewährsfrau heißt Johanna Stein und ist im Frühjahr 1929 in sein Gesichtsfeld getreten.