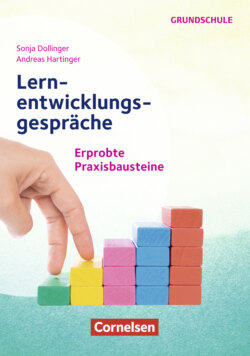Читать книгу Lernentwicklungsgespräche in der Grundschule - Erprobte Praxisbausteine - Markus Reiter - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorstellungen von der eigenen Leistung – adäquates Selbstkonzept
ОглавлениеDeutlich ersichtlich sind die Zusammenhänge mit verschiedenen motivationalen Aspekten des Lernens. Hierzu zählt unter anderem die (Weiter-)Entwicklung des akademischen Selbstkonzepts, verstanden als Vorstellung über eigene Fähigkeiten und Begabungen (vgl. z. B. Möller & Trautwein, 2015; Moschner & Dickhäuser, 2018). Das akademische Selbstkonzept entwickelt sich im Durchschnitt vom „Optimisten hin zum Realisten“ (Helmke, 1998) und scheint sich ab der Grundschulzeit zunehmend zu stabilisieren (vgl. ebd.; Praetorius, Kastens, Hartig & Lipowsky, 2016). Für die Entwicklung des akademischen Selbstkonzepts sind Rückmeldungen und Vergleichsprozesse von entscheidender Bedeutung (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2018). Kinder berücksichtigen hierbei sowohl die Vergleiche mit anderen Kindern (vgl. Dickhäuser & Galfe, 2004) als auch die Einschätzungen und Rückmeldungen ihrer Eltern und Lehrer*innen (vgl. Poloczek et al., 2011; Spinath 2004, siehe Kap. 1.1).
Zudem gibt es enge Zusammenhänge mit den Erfolgserwartungen der Schüler*innen und dem damit verbundenen Lernverhalten (vgl. z. B. Grassinger, Dickhäuser & Dresel 2019, S. 212 f.). Ein grundsätzlich positives Selbstkonzept unterstützt die Lernbereitschaft und Lernfreude im jeweiligen Gebiet. Des Weiteren gilt in Zusammenhang mit Leistung und Motivation, dass eine optimistische Selbsteinschätzung, also eine relative Überschätzung eigener Kompetenzen, geeignet ist, um positive Auswirkungen zu erzielen (vgl. z. B. Heckhausen & Heckhausen, 2010; Helmke, 1998), während vor allem Unterschätzungen negative Auswirkungen haben (vgl. Praetorius et al., 2016). Vor allem leistungsschwächere Schüler*innen zeigen bereits früh ein negatives Selbstkonzept, das durch den ständigen Vergleich mit leistungsstärkeren Mitschüler*innen noch weiter absinkt (vgl. Ahrbeck et al. 1997; zit. n. Moschner & Dickhäuser, 2018). Daher ist es von Bedeutung, ein positives Selbstkonzept bei den Lernenden zu unterstützen. Ein (nahezu) realistisches Selbstkonzept kann jedoch dazu beitragen, dass vor allem ständige Enttäuschungen vermieden werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ein optimistisches, also leicht überhöhtes, Selbstkonzept dazu geeignet ist, Anstrengungsbereitschaft und Lernfreude zu erhalten und gleichzeitig ständige Frustrationen zu vermeiden.
Da in LEG nicht die zusammenfassende Bewertung mit einer Ziffernnote dominiert – und diese wird nach unserer Einschätzung (auch im Vergleich zu sämtlichen verbalen Kommentaren) von den Schüler*innen und Eltern letztlich als entscheidende Größe wahrgenommen – gibt es hier deutlich mehr Möglichkeiten, den Fokus auch auf die Erfolge und die Fähigkeiten der Schüler*innen zu legen. Dies gilt auch, wenn diese im Vergleich zu den Misserfolgen quantitativ in der Unterzahl sind. So können den Kindern im Gespräch zum einen die individuellen Stärken und zum anderen aber vor allem auch die individuellen Lernentwicklungen explizit deutlich gemacht werden und so bei der Entwicklung zu einem positiveren Selbstkonzept unterstützt werden. Gleichzeitig kann auch durch den Vergleich von Selbst- und Fremdeinschätzung ein stark überhöhtes Selbstkonzept in Richtung realistische Selbstwahrnehmung bzw. optimistische Selbsteinschätzung verändert werden.