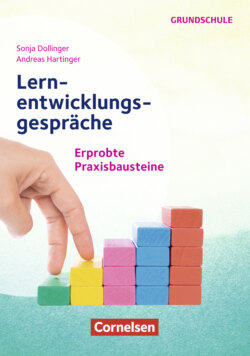Читать книгу Lernentwicklungsgespräche in der Grundschule - Erprobte Praxisbausteine - Markus Reiter - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVorwort
Die Unterschiedlichkeit der Schüler*innen ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung für Lehrer*innen. Das gilt für die Gestaltung von Unterricht – das gilt aber auch für die Gestaltung der Leistungsbeurteilung und -rückmeldung. Wichtig sind Formen, die das jeweilige Kind mit seinen individuellen Lernentwicklungen und Lernprozessen in den Blick nehmen; Lernentwicklungsgespräche (LEG) – Gespräche zwischen Kind und Lehrperson im Beisein der Erziehungsberechtigten1 – sind eine Möglichkeit, dies zu tun.
Sie erfreuen sich im Schulalltag immer größer werdender Beliebtheit. In Bayern beispielsweise wurden sie zum Schuljahr 2014/2015 den Grundschulen, als Möglichkeit das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 damit zu ersetzen, freigegeben. Im Schuljahr 2018/2019 nutzten ca. 90 % der bayrischen Grundschulen diese Möglichkeit.
Bezüglich der Umsetzung der Lernentwicklungsgespräche gibt es bundesweit in der Regel nur Vorgaben, die sich auf organisatorische und terminliche Aspekte beziehen. Die inhaltliche Gestaltung der LEG ist den Schulen bzw. Lehrer*innen im Wesentlichen freigestellt. Deshalb ist davon auszugehen, dass viele verschiedene Formate zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Lernentwicklungsgesprächen (in unterschiedlicher Qualität) existieren. Dies ist auch nicht überraschend, ist doch die Gesprächssituation mit dem Kind im Beisein der Erziehungsberechtigten eine neue, ungewohnte Form. Bisher waren es Lehrkräfte gewohnt, entweder mit dem Kind oder den Eltern ein Gespräch zu führen. Diese Dreier-Konstellation im LEG, die zusätzlich noch die (indirekte) Kommunikation zwischen Eltern und Kind mit sich bringt, ist jedoch ungewohnt und mag zunächst auch herausfordernd sein.
Im Zusammenhang mit einer Studie (gefördert von der DFG) zur Umsetzung und zu Effekten von Lernentwicklungsgesprächen wurde an der Universität Augsburg eine Professionelle Lerngemeinschaft zu Lernentwicklungsgesprächen mit Vertreter*innen aus Wissenschaft (Grundschulpädagogik und -didaktik, Psychologie, Deutsch als Zweitsprache) und Schulpraxis (Lehrer*innen, Schulleiter*innen, Seminarrektorin) ins Leben gerufen. In dieser Zusammenarbeit fand zunächst ein Austausch über die bereits existierende Umsetzung der LEG sowie die damit damit verbundenen offenen Fragen, Anliegen etc. statt. Ausgehend davon wurden die Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung der LEG unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien (weiter-)entwickelt und in der Praxis erprobt. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei darauf, das motivationsförderliche Potenzial von Lernentwicklungsgesprächen zu unterstützen. In der Professionellen Lerngemeinschaft entstand schließlich die Idee zu diesem Praxisbuch.
Ziel dieses Praxisbuches ist es in erster Linie, die in der Professionellen Lerngemeinschaft (weiter-)entwickelten und in der Praxis erprobten Materialien darzustellen. Daneben werden in knapper Form die theoretischen Grundlagen und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung für die Erarbeitung des Praxisbuches beschrieben.
Wir hoffen, Sie mit diesem Praxisbuch bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung Ihrer Lernentwicklungsgespräche unterstützen zu können und wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen mit ihren Erziehungsberechtigten erfolgreiche und gewinnbringende Lernentwicklungsgespräche.
Zum Umgang mit diesem Buch
Dieses Praxisbuch ist in zwei große Bereiche gegliedert: Zunächst werden die theoretischen Grundlagen von Lernentwicklungsgesprächen knapp dargestellt. Im zweiten Teil finden sich Anregungen für die praktische Umsetzung der Lernentwicklungsgespräche. Die Praxismaterialien sind in sich selbsterklärend, werden jedoch durch die entsprechenden theoretischen Grundlagen begründet bzw. ergeben sich daraus.
Damit Sie von diesem Praxisbuch profitieren können, müssen Sie nicht zwangsläufig alle Kapitel von vorne nach hinten durcharbeiten. Die Kapitel zur Umsetzung in der Praxis sind so aufgebaut, dass entlang des natürlichen Ablaufs Anregungen zuerst zur Vorbereitung, dann zur Durchführung und schließlich zur Formulierung der Ziele und zur Nachbereitung der LEG enthalten sind. Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander umgesetzt werden. Innere Bezüge (wie z. B. zur Formulierung von Zielen und zur Überprüfung dieser im Anschluss an das LEG oder zu den theoretischen Grundlagen) werden deutlich gemacht.
Unser Anliegen ist es, Ihnen Ideen, Anregungen und Materialien bzw. Methoden zur Verfügung zu stellen, die zwar grundsätzlich sofort und ohne Änderungen eingesetzt werden können, aber auch nach Bedarf verändert werden können. Schließlich ist jedes Kind und damit auch jedes LEG unterschiedlich und bedarf unter Umständen spezifischer Anpassungen. Zugleich möchten wir Sie ermutigen, auch für einzelne Kinder separate Formen der Selbsteinschätzung, spezifische Inhalte oder Methoden für das LEG auszuwählen. Im Praxisteil finden Sie daher nicht den einen „goldenen Weg“, um erfolgreiche und gewinnbringende LEG zu führen. Vielmehr bieten wir dort verschiedene Möglichkeiten, einzelne Elemente der LEG umzusetzen, die Sie nach den Bedürfnissen Ihrer Schüler*innen – und nicht zu vergessen, auch nach Ihren eigenen – auswählen und/oder anpassen können.
Um eine echte Auswahl für die Bögen zur Selbst- und Fremdeinschätzung zu ermöglichen, haben wir einen Pool mit Formulierungsvorschlägen für die Einschätzungsbögen erstellt, den Sie im Anhang des Praxisbuches finden. Dieser Pool enthält eine Vielzahl möglicher Aussagen – deutlich mehr als sinnvollerweise verwendet werden können. Ziel dieser Fülle ist es, dass die große Anzahl an möglichen Aspekten deutlich wird – auch mit der Option, einzelne Formulierungen nur für spezielle Kinder der Klasse zu verwenden.
Lernentwicklungsgespräche sind Gespräche – der Aspekt der Sprache und damit der sprachlichen Heterogenität ist daher von Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir bei der Gestaltung dieses Praxisbuches den Aspekt der sprachlichen Vielfalt berücksichtigt. In den entsprechenden Kapiteln haben Martina Hohbauer und Christine Stahl spezielle Hinweise für die Durchführung von LEG mit Kindern (und Erziehungsberechtigten) mit geringen Kenntnissen der deutschen Sprache (und evtl. einer anderen kulturellen Prägung) gegeben, die helfen sollen, dass die LEG auch für diese Schüler*innen erfolgreich sein können. Diese Hinweise sind hervorgehoben.
1 Erziehungsberechtigte und Eltern werden aus Gründen der Lesbarkeit synonym verwendet, auch wenn im LEG teils nur ein*e Erziehungsberechtigte*r anwesend ist.