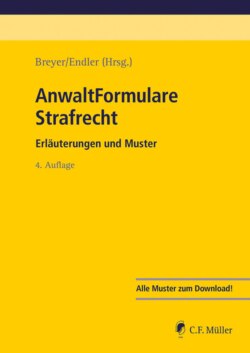Читать книгу AnwaltFormulare Strafrecht - Matthias Klein - Страница 153
На сайте Литреса книга снята с продажи.
b) Schutz der Anonymität des Betroffenen und seine Grenzen
Оглавление365
Gemäß § 169 GVG findet gegen den Angeklagten eine öffentliche Hauptverhandlung statt. Vom Schutzzweck her soll auf diese Weise eine Kontrolle der Justiz ermöglicht und der Betroffene vor justizieller Willkür geschützt werden. Unter den Begriff der „Öffentlichkeit“ i.S.d. § 169 GVG fällt eigentlich nur die sog. Saalöffentlichkeit. Das Herstellen von „Medienöffentlichkeit“ während der Hauptverhandlung durch Ton- und Filmaufnahmen wird in § 169 S. 2 GVG nämlich gerade ausdrücklich untersagt. Strafverfahren finden also in der Öffentlichkeit, nicht aber für die Öffentlichkeit statt. Es ist der Ausfluss des grundgesetzlich geschützten Allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen, dass dieser grundsätzlich ein Anrecht darauf hat, in der medialen Berichterstattung nicht mit seiner Identität genannt zu werden. Andererseits haben die Medien einen ebenfalls verfassungsrechtlich statuierten Auftrag, gesellschaftliche oder politische Missstände zu erkennen, durch ihre Berichterstattung zur umfassenden Information über das Zeitgeschehen beizutragen und auf diese Weise die Meinungs- und Wertebildung der Gesellschaft zu fördern bzw. diese überhaupt erst zu ermöglichen. Daraus ergibt sich, dass je schwerwiegender der strafrechtliche Vorwurf und je größer das öffentliche Informationsinteresse deshalb ist, desto weniger kann sich der Beschuldigte bzw. der Angeklagte auf Anonymitätsschutz berufen. Gleiches gilt nach der Rechtsprechung bei Straftaten, die die Öffentlichkeit besonders tangieren, wie dies etwa bei einer herausgehobenen beruflichen oder sozialen Stellung des Betroffenen oder Delikten aus dem Wirtschafts- und Umweltbereich der Fall ist. In derartigen Konstellationen sind auch schon Straftaten unterhalb der Grenze zur Schwer(st)kriminalität relevant. Andererseits ist es zu weitgehend, wenn dabei ausschließlich auf die herausgehobene Stellung des Betroffenen abgestellt wird. Daneben ist gleichermaßen ein funktionaler Zusammenhang seiner Stellung mit der ihm vorgeworfenen Straftat zu fordern.
366
Mit größeren Einschränkungen seiner Rechte muss ein Verurteilter jedenfalls dann rechnen, wenn der Verurteilung eine gewichtige Straftat zugrunde liegt, denn solche Straftaten gehören zum Zeitgeschehen und dessen Vermittlung ist ureigenste Aufgabe der Medien. Mit der Begehung von erheblichen Straftaten, deren Aufklärung sowie der späteren Verurteilung des Täters wird dieser – durch sein eigenes Handeln – zu einer Person der Zeitgeschichte, über die eine identifizierende Berichterstattung unter erleichterten Voraussetzungen zulässig erscheint.
367
Verwirken können den Schutz ihrer Privatsphäre auch diejenigen Personen, die selbst gezielt an die Medien herantreten und die Öffentlichkeit zur Verfolgung eigener Zwecke nutzen, etwa weil sie öffentlich zu den gegen sie geführten strafrechtlichen Ermittlungen und die dort erhobenen Vorwürfe Stellung nehmen wollen. Der Schutz der Privatsphäre kann nicht weitergehen, als der Betroffene selbst sie zu schützen versucht!
368
Eine andere Frage ist, inwieweit sich der zwischenzeitlich eingetretene Zeitablauf auf den Anonymitätsschutz auswirkt. Je länger das fragliche Geschehen, auf das sich die identifizierende Berichterstattung beziehen soll, zurückliegt, desto stärker wird das öffentliche Interesse an einer Berichterstattung hinter dem Schutz der Persönlichkeit zurückzustehen haben, da insbesondere das Resozialisierungsinteresse des Verurteilten hier zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei sind jedoch keine absoluten zeitlichen Grenzen zu ziehen, sondern es kommt auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an.[407]