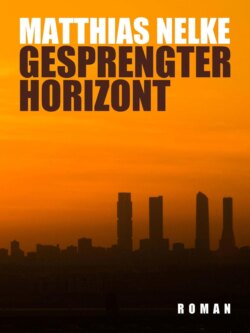Читать книгу Gesprengter Horizont - Matthias Nelke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der Baske
Оглавление[Plaza Mayor, 11:15]. Ramón Ybarra war kein starker Mann, nicht besonders zumindest. Er war auch nicht besonders schnell oder anderweitig physisch begabt. Es gab Menschen, die ihn überragten, und andere, auf die er hinabblicken konnte. Ramón war weder überdurchschnittlich intelligent, noch überdurchschnittlich gerissen, noch jemand, zu dem man schaute, wenn spontaner Einfallsreichtum oder ausgereifte Planung verlangt war. Niemand hätte ihn je als eloquent oder charismatisch bezeichnet. Führen konnte Ramón genauso wenig, wie er folgen konnte. Er ging auch nicht als schön durch und niemand hatte ihm je gesagt, dass er über besondere Talente im Schlafzimmer verfügte. Die einzige Fähigkeit, von der Ramón Ybarra je profitiert hatte, war, wie sehr seine Umwelt ihn in all diesen Belangen tatsächlich unterschätzte. So wenig er auch konnte, war es doch immer mehr, als Menschen im zutrauten. Und das machte ihn unberechenbar.
Von dem Mann, der el Viento sein musste, konnte Ramón das nicht behaupten.
Aus dem Schatten des Säulengangs, der den quadratischen Kopfsteinpflasterplatz zu allen Seiten einfasste, hatte Ramón ihn beobachtet, seit er angekommen war. In seiner Unauffälligkeit, seinen khakifarbenen Halbschuhen, der luftigen Tweet-Hose und dem weißen Hemd stach er aus dem Schwarm der Pilger heraus wie ein bunter Hund. Zum wiederholten Mal ließ der Mann jetzt seinen Blick schweifen, als hielte er nach jemandem Ausschau. Als er sich wieder in Ramóns Richtung drehte, ließ dieser sich in den Schatten der Säule fallen, an der er gelehnt hatte, und trat zur anderen Seite wieder hervor. Zwischen ihm und der Tweet-Hose lag jetzt der Außenbereich eines Cafés, das zur Feier der Fegefeuertemperaturen Milchshakes und Kaffees unter roten Sonnenschirmen servierte.
Es verlieh Ramón das Gefühl der Überlegenheit, von dem er noch lange würde zehren müssen, dessen war er sich sicher. Menschen, die sich Ramón überlegen fühlten, hatten einen Hang dazu, ihn das spüren zu lassen, und Ramón hatte das Gefühl, dieses Mal würde es nicht anders sein.
Doch letztlich warf Ramón eine Pistazie nach, federte mit einer Eleganz, die ihm keiner zugetraut hätte, von der Säule ab und arbeitete sich durch die Menge.
»Soll ich dir ein Schild basteln?« Niemand hätte von Ramón je gesagt, dass er lustig war.
»Perdona me?«
»Oder du fotografierst den Zirkus hier zum vierten Mal. Erregt ungefähr die selbe Aufmerksamkeit.«
»Entschuldigung, was meinten Sie?«
Für einen Spanier war er hellhäutig, dachte Ramón. Auch die Glatze passte nicht so recht ins Bild. Aber sein Akzent ließ keinen anderen Schluss zu, obwohl er sich kein bisschen so anhörte wie am Telefon. Dafür entsprach der Rest dem, was Ramón sich vorgestellt hatte. Harte Wangenknochen, hoch, markant, blaue Augen. Darunter eine winzige, blasse Narbe wie ein notwendiges Accessoire, das ihn von anderen unterschied. Kein Zweifel, das war der Mann.
»Ramón Ybarra.«
Ramón fuhr herum. Er musste blinzeln. Hinter ihm lag der Außenbereich des Cafés. Ein Quadrat aus Chromzäunen, verschönert mit welken Blumenkästen. Darin: Acht Chromtische mit Chromstühlen, deren Oberflächen ihn anblitzten, und rote Sonnenschirme in dicken Steinsockeln, angeordnet zu zwei parallelen Reihen. Alle besetzt. Vier Pilgergruppen, siebzehn Hüte. Links, ein einsamer Hut hinter einer Zeitung. Rechts, zwei Pärchen, sechzehn und sechzig. Eine fettleibige Frau auf zwei Chromstühlen, die das Café allein deshalb ausgesucht hatte, weil die Stühle keine Armlehnen hatten. Ein Mann am Telefon. Einer von ihnen wusste, wer Ramón war.
Für eine quälende Sekunde geschah gar nichts, als sei die Zeit einfach stehen geblieben. Dann schnappte alles zurück. Am zweiten Tisch links von ihm wurde die Zeitung gesenkt. Eine junge Frau mit Sonnenbrille und Pilgerhut kam zum Vorschein. Das ältere Ehepaar faltete einen Stadtplan aus. Ein Hut am hintersten rechten Tisch schnippte den Kellner herbei. Ramón hatte auf den einsamen Mann am Telefon getippt, doch der stand jetzt von seiner leeren Kaffeetasse auf und verließ das Gehege. Ramón spürte, wie er aus sicherer Entfernung gemustert wurde, so wie er selbst vor nicht einer Minute aus scheinbar sicherer Distanz beobachtet hatte. Wie Details seiner Erscheinung mit einer virtuellen Akte abgeglichen wurden. Wie Korrekturen vorgenommen wurden.
Die Frau mit der Zeitung stand auf. Auf ihrer linken Brust prangte der Ghostbusters-Geist, daneben der Schriftzug. Sie nahm den gelben Pilgerhut ab und legte ihn zu der Zeitung auf den Tisch; kastanienbraune Fransen fielen ihr ins Gesicht, ein Zopf schwappte in ihren Nacken. Als sie vor Ramón stehen blieb und die Sonnenbrille abnahm, fiel der Tourist von ihr ab wie ein falscher Schatten.
Normalerweise hätte Ramón unter keinen Umständen geglaubt, dass jemand wie sie die Person sein könnte, die er suchte. Sie war zu jung, jünger noch als er selbst. Und kleiner. Und eine Frau. Scheiße, sie trug einen Pferdeschwanz. Doch da war etwas in ihren blauen Augen, das keinen Zweifel zuließ, weil es nur zwischen zwei Dingen unterschied: Feinden und Beute. Und so wie Ramón den Mund öffnete, so wie sich alle seine Gedanken verabschiedeten, und nichts herauskam, wurde er letzteres.
Als el Viento sich in Bewegung setzte, dackelte Ramón hinterher.
Mittlerweile sprengten Pilger den Plaza Mayor; es war zwecklos zu zählen, wie viele es waren. Ramón zählte einen Schwarm. Gelbe, orange, blaue Hüte und Basthüte mit Scherpen in den Farben unterschiedlichster Flaggen. Wie wild pirouettierten sie beim Versuch, Panoramabilder des Säulenganges aneinander zu reihen, verteilten »Free Hugs« wie Geschlechtskrankheiten, flashmobten auf den Befehl einer unsichtbaren Königin, sprengten Gruppenfotos und versuchten in den fünf auswendig gelernten Worten Spanisch, ihre Nutzlosigkeiten gegen die anderer einzutauschen. In der rückwärtigen Ecke des Platzes war ein Stand aufgebaut worden, den eine dreizackige Krone brandmarkte. Der Schwarm pulsierte darum. Mit Postkarten, Ansteckern, neuen Hüten, Flyern, Plastikfächern, Plastiktröten, Plastikrasseln und Schälchen mit dampfendem Chilli con Carne kehrten die Hüte zurück und flohen in den Schatten. Ramón und die Frau entkamen dem endlosem Schieben, Rempeln und sich Entschuldigen durchs Westtor. Im Laufen warf sich Ramón eine neue Pistazie ein.
Die Frau sprach erst wieder mit ihm, als sich die Massen auf dem Plaza de Sankt Miguel zu lichten begannen.
»Du hast was für mich?«
Am Telefon hatte er gedacht, seine Stimme war hell für einen Mann. Jetzt dachte er, sie war verflucht tief für eine Frau. Doch vor allem, dachte er: Ihr Baskisch ist makellos. Es traf Ramón so unerwartet, dass er stehen blieb.
»Eine Baskin.«
Ihre Füße kamen widerwillig zum Stehen. »Baskisch. Es sei denn, du bevorzugst Castellano? Wir haben schließlich... sensible Dinge zu besprechen.«
»Sensibel.« Ramón prustete. »Hast Baskisch einfach aus Laune gelernt, ja? Hattest einen Stecher in Bilbao, war's so?« Er schüttelte den Kopf. »Nein, baskisch lernt man nicht, um sich auf dem Weltmarkt einen Vorteil zu verschaffen.«
Er zückte die Pistazienpackung, nahm eine Handvoll und steckte sich die erste zwischen die Zähne. Langsam fand er seine Sprache wieder. Er reichte die Packung weiter. Die Frau wollte sie nicht. Sie versuchte auch kein zweites Mal, Ramón einzubläuen, dass sie nur baskisch sprach. Sie drehte sich um und ging. Doch Ramón hatte keine Eile mehr aufzuschließen. Als der zum Pilgerweg gewachsene Bürgersteig es ihm erlaubte, schlüpfte er zurück an ihre Seite.
»El Viento ist also Baskin.« Ramón besah sich die Frau von der Seite. Sie sah aus, wie eine der Referendarinnen, die man der Krise zum Fraß vorgeworfen hatte. Hübsch. Über den Pferdeschwanz konnten sie sicher reden. »Scheiße, wie alt bist du, dreißig?«
El Viento verstand die Frage, auch die zwischen den Zeilen. »Auch Frauen dürfen töten«, antwortete sie.
»Mir wurde gesagt, el Viento sei schon fünfundzwanzig Jahre im Geschäft.«
»Noch nie León - der Profi gesehen?«
»Alles klar, Mathilda.«
»Du hast was für mich«, sagte Mathilda zum zweiten Mal. Diesmal war es keine Frage.
Ramón zückte das Etui aus Krokodilleder aus seiner Hosentasche und reichte es rüber. Zuerst dachte er, sie würde es bloß in der Hand wiegen, um zu sehen, ob es den USB-Stick enthielt. Letztlich überprüfte sie es doch.
»Letzte warme Worte?«
»Würde ich nicht wissen.«
»Was soll die Box?«
»Ein Geschenk? Was weiß ich. Verkaufs, wenn du willst.«
Sie stellte keine weiteren Fragen. Ramón entspannte sich etwas.
Sie hüllten sich in konspiratives Schweigen, während sie die Calle de Alcalá hinunterschlenderten, scheinbar ziellos. Doch Ramón wusste, dass es noch nicht alles war.
»Alles ist vorbereitet?«
Sie hatte ein Talent dafür, Fragen auf eine Art und Weise zu stellen, die nur eine Antwort zuließen. Etwas, das vom Delegieren kam, wusste Ramón. Er zuckte mit den Schultern und setzte die Sonnenbrille auf, als sie aus dem Schatten der Gebäude traten.
»Mir wurde gesagt, du wärst jemand, auf den man sich verlassen kann«, sagte Mathilda. »Loyal.«
»Loyal, kein Köter.« In der in Mathildas Kragen baumelnden Sonnenbrille konnte Ramón sein eigenes Gesicht gespiegelt sehen. Augen, die in der Sonne schwefelgelb leuchteten, dazwischen eine Habichtsnase unter einer schmalen Stirn. Kleine Ohren, fransige, farblose Haare. Ramón wusste, was Leute in ihm sahen. Einen Hund. »Du sagst mir nicht, was ich tun soll.«
Mathilda lächelte. »Meinetwegen. Beiß die Hand, die dich füttert. Du kannst die rechte Hand sein, oder die Hand, die abgeschlagen wird. Deine Entscheidung.«
»Du würdest keinen Ersatz finden.«
»Ein Anruf.«
»Und wer geht ran? Lebensmüde Kameltreiber? Fanatische Studenten?«
»Ein Anruf.«
Irgendwo in seinem Kopf, verkümmert hinter einem immer schon zu dominanten Naturell, bemerkte Ramón, dass er provoziert wurde. Vielleicht bemerkte es sogar der Rest von Ramón Ybarra. Nur reagierte er nicht entsprechend.
Ramón hatte sich geschworen, nicht derjenige zu sein, der die Kontrolle verlieren würde. Nicht schon wieder. Menschen nutzten zu oft Ramóns Unbeherrschtheit aus, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Ramón wusste das. Es half nicht. Mit einem blitzschnellen Schritt schnitt er ihr den Weg ab, sodass sie fast mit ihm zusammenprallte. Ramóns Nasenspitze touchierte ihre Wange.
»Hör zu, conjo!«, spukte Ramón. »Schlimm genug, dass ich jetzt anscheinend einer Schlampe unterstehen muss, wenn es darum geht, mein eigenes Leben zu opfern, während du dich mit der Asche aus dem Staub machst. Aber stell nicht meine Loyalität infrage. Sonst haben wir ein Problem.«
Mathilda verlor nicht die Fassung. Kein bisschen. Sie ließ sich geduldig vom Wutspeichel beregnen und antworte dann, ohne auch nur einen Zentimeter zurückzuweichen: »Bist du fertig?«
»Meine Loyalität gilt der Sache. Meinem Land. Der ETA. Nicht deinem Spitznamen.«
»Ich kann das respektieren«, antwortete Mathilda. »Aber es interessiert mich nicht. Du wusstest, welche Rolle hier für dich vorgesehen war.«
Ramón schwieg, Mathilda hatte getroffen.
»Und da ich vermutlich tatsächlich niemanden finden werde, der das von sich behaupten kann, müssen wir wohl miteinander auskommen.«
Bevor Ramón antworten konnte, stand jemand neben ihnen. Einer der Hutträger. Diesmal in rot und so klein, dass selbst die kleingewachsene Frau auf ihn herabblicken konnte. Doch das schien den Hut nicht einzuschüchtern, denn er blieb, auch als die eiskalten Blicke der beiden, die noch bis gerade in einer fremden und sich aggressiv anhörenden Sprache gestritten haben, wie aus einer anderen Zeitzone auf ihn fielen.
»Gibt es ein Problem? Belästigt Sie dieser Mann, Señora?«
Sein Spanisch war gut — für einen Hut.
Ramón musste lachen. Diese Schlampe! Die würden sie nie drankriegen. Wenn Europol kommen würde, um die Tür zu ihrem Hotelzimmer einzutreten, würde der erste im Raum sie noch fragen, wo ihr Mann sei. Oder ihr Freund. Oder ihr Kunde. Was auch immer sie wollte. Der Gedanke ließ sein Blut kochen. Doch dies war weder der Ort noch die Zeit, um herauszufinden, ob Hüte wirklich die andere Backe hinhielten, wenn man ihnen eine reinschlug. Die Straße war voller Menschen, die meisten Hüte. Einige hatten die Situation bereits bemerkt und würden ihrem Artgenossen wahrscheinlich sofort zur Hilfe eilen. Mit der Zunge schob sich Ramón die Pistazienschalen zwischen die Lippen und blies sie dem Hut ins Gesicht, dann packte er das Leibchen, das er trug, wischte sich den Mund daran ab und drehte sich um.
»Verpiss dich lieber aus Madrid«, fauchte er auf spanisch.
Wenige Minuten später liefen Passanten wieder an ihnen vorbei, ohne sich um sie zu scheren.
Irgendwann tauchte der Königspalast vor ihnen auf. Voller Inbrunst würgte Ramón Speichel hoch und spuckte ihn in Richtung Palast auf die Straße. Da ne Bombe rein, dachte er. Sieben Jahre war das jetzt her. Sieben Jahre seit dem 11. März 2004, 11-M, als eine linksradikale Zelle der ETA sich mit einem Al-Qaida-Ausläufer namens Islamische Kampfgruppe Marokko verbündet hatte, um zehn Sprengsätze in spanischen Zügen zu zünden. Einer der größten Terrorakte auf europäischen Boden. 191 Tote. Es hätten mehr sein können, sie hätten den ganzen Bahnhof Atocha zum Himmel geblasen, wenn sie nur alles richtiggemacht hätten. Doch das war schon immer das Problem der familia gewesen; auf den letzten Metern lief irgendwas schief. Wer was erreichen wollte, sollte nicht zu geizig sein, vernünftige Zünder zu kaufen, oder so dumm, einen LKW mit einer halben Tonne Sprengstoff nach Madrid fahren und sich von der Polizei auf der Autobahn wegen defekter Bremsleuchten festnageln zu lassen. Daran war es 2004 gescheitert. Zum Glück war er nur beim Beladen dabei gewesen. Diesmal würde es anders sein. In jeder Hinsicht.
»Dieses Land hat nichts anderes verdient«, sagte er. »Es ist schon lange im Kommen. Die Studenten auf der Straße wissen es. Die Rentner an den Tafeln wissen es. Sie alle schreien danach. Schreien nach ihrem Geld. Jeder will, was ihm zusteht. Und wer Macht hat, verpisst sich hinter meterhohe Mauern und hält das Maul. Die haben es doch selbst heraufbeschworen. Dieses Mal werden wir es ihnen richtig zeigen.«
Ramón sah zu der Frau hinüber, als keine Antwort kam. Die stand nur da, die Sonne im Rücken, und sah auf die andere Straßenseite. Am Zaun, der den Königspalast umkreiste, lehnten zwei Halbstarke. Während sie sich unterhielten, durchsiebten ihre Blicke die vorbeiströmenden Pilger. Gelegentlich folgten sie ihnen einige Meter die Straße hinunter und pöbelten ihnen hinterher.
»Glaubst du daran?« fragte Mathilda mit noch immer abwesendem Blick. »An die Sache mit dem Geld?« Ihre Stimme klang dabei so aufmerksam, dass Ramón das unheimliche Gefühl bekam, plötzlich mit einer anderen Person zu sprechen. Oder mit zweien.
Der Dickere der beiden stellte einem kleinen Mädchen das Bein; das Kind taumelte, wurde aufgefangen, machte sich aus dem Staub. Die Halbstarken lachten. Erste wechselten die Straßenseite.
»Welches Geld?«
»Die fünfzig Millionen. Die Steuergelder, mit denen die Regierung den Weltjugendtag angeblich gesponsert hat.«
»Macht das einen Unterschied?«
Keine Antwort. Sie stand nur weiter da und starrte.
»Ist der Plan noch immer, dass wir später zusammen nach Chamartín fahren?«, fragte Ramón.
In einem Industriegebiet im Vorort Chamartín lag eine Garage, in der bereits an der Verkabelung der Sprengsätze gearbeitet wurde. Sie würden von einer wahllosen Metrostation in der Innenstadt dorthin aufbrechen, damit sie im Ernstfall niemand zu ihren Aufenthaltsorten würde zurückverfolgen können. Ramón hatte noch keine Ahnung, in welchem Hotel el Viento abgestiegen war.
Die Frau, die el Viento sein musste, nickte.
»Plaza de Lavapiés?“, fragte er. »Hab da noch was zu erledigen.«
Als sie wieder nicht antwortete, musste Ramón aufpassen, sein diebisches Grinsen für sich zu behalten. Die Schlampe würde auch noch dran glauben müssen, dafür hatte er gesorgt. Würde er sorgen.
Vorerst machte er sich aus dem Staub.