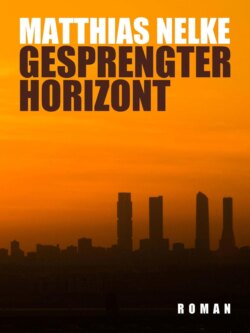Читать книгу Gesprengter Horizont - Matthias Nelke - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Davor
Оглавление[irgendwo vor der Küste Gibraltars, 03. Juni 2011]
Schon lange gab es keinen Horizont mehr. So wie das Meer brüllte und die Männer beteten, fragte Amadou sich, ob das Ende gekommen sei.
Unter dem Donner der Wellen war der Fischerkahn voll fremder Stimmen. Einige der Männer falteten die Hände und sahen gen Himmel. Die meisten warfen sich auf den Boden. Wieder sprach die nasse Naturgewalt und krachte über ihnen ein. Kongolesische Minenarbeiter, kamerunische Hirsebauern, Fischer aus Guinea purzelten übereinander wie Spielzeug. Dann flehten sie wieder. Einige zu Gott. Die meisten zu Allah.
Amadou hatte den Unterschied nie verstanden. Selbst sein Großvater, der alles wusste, hatte ihm das mit den Göttern nie erklären können. Sollte der Sturm sie verschonen, würde niemand sagen können, wem sie ihr Leben zu verdanken hätten. Dort, wo Amadou herkam, war der Himmel der Himmel, die Berge waren die Berge und das Meer war das Meer. Während die anderen Männer ihre Götter anflehten, die Amadou nirgends sehen konnte, tat er, was ihm das einzig Sinnvolle schien. Er bat das Meer, sich zu beruhigen.
Um zehn Minuten vor Mitternacht ging der erste Mann über Bord. Sein Gott hatte ihn wohl nicht gehört. Das Meer übertönte und übertürmte alles. Es rülpste und verschluckte den Überbordgegangenen so leicht, wie das Platschen, mit dem er aufs Wasser schlug, und das Gurgeln in seiner durchgeschnittenen Kehle.
Um Mitternacht waren ihm acht Männer und zwei Frauen gefolgt. Als Amadou an der Reihe war, färbte Blut das Stahldeck, auf dem er kniete, bereits violett. Welle um Welle schlug aufs Deck und leckte über den Kahn, doch das Blut wusch immer wieder zurück.
Du, fragte der Dolch in der Hand des Somali, als er ihn in Amadous Gesicht steckte.
»Amadou«, antwortete Amadou.
»Amadou«, kostete der Somali die Silben aus.
Ein Blitz spaltete den schwarzen Himmel. Für den Bruchteil einer Sekunde ließ das Gleißen die einschüchternde Gestalt weiß hervortreten. Die Narbe auf seiner linken Wange leuchtete im Einklang mit seinen großen Zähnen. Ein Lächeln, das verriet, dass er Amadous Reaktion bereits kannte, und jede, die darauf folgen würde. Es blitzte wie der Dolch in seiner Hand. Wie alle durchgeschnittenen Kehlen vor ihm sagte Amadou, dass er nur Allah diene. Das Lächeln des Somali wurde breiter. Er raunte etwas auf Arabisch.
Amadou verstand kein Arabisch. Das Wort des Hünen hörte sich so feindselig an, wie jedes andere Wort, das er hätte sagen können. Vielleicht war es auch der Dolch. Amadou zögerte keine Sekunde länger, den Satz hinauszuschreien, den er in seinem Kopf aufsagte, seit ihn der Mali in der weißen Dscheballah fünf durchgeschnittene Kehlen vorher gegen sein Leben eingetauscht hatte. Vom arabischen »Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und das Mohammed der Gesandte Gottes ist«, von dem Amadou kein Wort verstand, blieb nicht viel übrig, um es als das islamische Glaubensbekenntnis zu identifizieren, das es war.
Der Somali war in die Knie gegangen. Die Hand, die das Messer hielt, baumelte jetzt lässig von seinem massiven Oberschenkel. Trotzdem sah er noch immer auf Amadou herab. Jetzt bohrend. Sagte etwas auf arabisch. Jetzt lächelnd. Amadou hörte seine Stimme am Satzende hochgehen — eine Frage! Nur er verstand sie nicht.
Zum ersten Mal seit Beginn seiner Flucht schlich sich der Gedanke in Amadous Kopf, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit sterben würde. Um sein Leben hatte er schon oft gefürchtet — davor noch mehr als danach. Dazwischen lag die Wand aus schwarzem Qualm. Benzin und Vergessen. Nur deshalb war er geflohen, weil sein Leben sich im Ungleichgewicht von Davor und Danach erschöpfte und er ins Davor eben nicht zurück konnte. Das war die Natur des Krieges, sagte sein Großvater, der alles gewusst hatte. In den Stamm der Geschichte schlägt er eine Kerbe, doch das Holz, aus dem wir geschnitzt sind, schlägt er entzwei.
In Agadez hatte Amadou in den Minen geschuftet, um Geld für die Reise ans Meer zu verdienen. In fahlem Kunstlicht und verstrahltem Staub hatte er sich die Hände blutig geschürft für die Steine, mit denen die Weißen ihre Raketen bestückten: Uran. Ein halbes Jahr lang, für einen Schlafplatz am Stadtrand und einen Stehplatz auf einem Laster nach Norden. In einem dreißig Jahre alten Mercedes-Transporter waren er und dreißig andere schließlich nach Algerien aufgebrochen. Die erste Straßensperre forderte ein Zehntel von Amadous Erspartem. Die Männer wedelten mit Messern, und er bezahlte. Dann kamen die Polizisten, die Zollbeamten und schließlich die Schleuser. Amadou bezahlte sie alle. Kurz vor Tamanrasset war nur noch die Hälfte seines Geldes übrig. Kurz nach Tamanrasset kamen die Banditen, wedelten mit Bajonetten an russischen Kalaschnikows und nahmen den Rest. Ein Leben später saßen er und ein Nigerianer namens Lawrence an einem marokkanischen Strand und beobachteten, wie das Meer tote Männer anspülte, mit denen sie tags zuvor noch ein Boot nach Melilla bestiegen hatten, ehe sie beide nach einer Viertelstunde vom tosenden Meer über die Reling geworfen und an Strand gespült worden waren. Die gebrochene Hülle des Bootes folgte zwei Tage später. Amadou hatte jedes Mal gefürchtet zu sterben. Doch bis zu diesem Moment, da der breitschultrige Somali jetzt mit dem Dolch unter seiner Kehle wedelte, hatte es ihn nie mit solcher Gewalt getroffen: Hier würde es zu Ende gehen.
Der Somali wiederholte die Frage. Er hielt das Messer jetzt waagerecht zwischen beiden Händen, ließ es mit der Spitze in seiner Handfläche kreisen, und sah Amadou über die tanzende Klinge hinweg an. Amadous Kehle schnürte sich zu. Es gab keine Antwort, die sein Leben retten konnte.
Ein Wimmern drang an Amadous Ohr. Der felsige Schädel des Somali wandte sich nach rechts.
Amadous Nachbar saß auf dem Hosenboden. Die Beine des stotternden Häufchen Elends schlotterten so stark, dass seine Knie aneinanderschlugen. Dabei presste es die Augen so fest zusammen, dass Fältchen in den Winkeln hervortraten, und bemerkte deshalb nicht, dass er mit seinen Daumen eine hölzerne Perle nach der anderen zwischen seinen krampfhaft verzahnten Fingern ins Freie schob, wie die verräterische Blutspur eines pochenden Herzens, das er in seinen Händen zu verbergen versuchte.
Die Blutlust des Somali sprang von Amadou auf seinen Nachbarn über wie die eines Löwen, der bei der Verfolgung einer verletzten Antilope ein Neugeborenes erblickt. Der Dolch sauste durch die Luft, spaltete die gefalteten Hände wie eine Steinfrucht. Heraus fiel der Kern — ein hölzernes Kreuz. Das Häufchen Elend schrie, sein Oberkörper schien jegliches Gleichgewicht zu verlieren und fiel nach vorne. Panische Augen wühlten zwischen den Perlen des Rosenkranzes, suchten nach dem Kreuz, Hände griffen danach. Doch ohne Daumen und Zeigefinger konnten sie es nicht packen. Die violette Lache wuchs.
An diesem Punkt brach die Oberfläche weg. Gerade noch war sie da, dann nicht mehr. Amadou spürte wie seine Organe schon der Schwerkraft folgten, während sein Körper noch im Boot saß. Dann kippte es nach vorne. Der Bug pflügte tausend Tonnen Gischt auf, als er auf die Oberfläche schlug. Mit weit aufgerissenem, Salzwasser sabberndem Maul gähnte das Meer ihnen entgegen. Amadou wurde durch die Luft geschleudert, wusste nicht, ob er Wasser oder Stahl treffen würde, bis er im Tauwerk hängen blieb, das irgendwo zu einem Knäuel zusammenlag. Unter ihm bockte das Boot, warf ihn hoch wie ein Ross seinen Reiter und ließ wieder Wassermassen von Bug nach Heck donnern. Oben wurde unten, Backbord zu Steuerbord, und Amadou krallte seine Finger tief in die Seile, zog seinen Kopf zwischen die Schultern und ließ das Wasser über seinen Rücken rauschen. Er hörte Schreie. Das Meer nahm sich seinen Teil.
Als das Meer sich beruhigte, das Boot lediglich von links nach rechts gestoßen wurde, und er die Schreie wieder klar hören konnte, hob Amadou den Kopf. Auf dem ganzen Deck erhoben sich Männer auf die Knie, klammerten sich wie kleine Kinder an die Reling und würgten Magensäure ins Meer. Doch nirgends der Somali. Nur Amadous Nachbar. Das Meer hatte sie beide in den Tauhaufen gespült. Er gurgelte.
»Amadou…«
Amadou musste ihn auf den Rücken drehen, um zu merken, dass es kein Wasser war. Die Stelle in Lawrence Brust, wo der Dolch des Somali ihn getroffen haben musste, atmete Blut. Mit glasigen Augen träumte er Träume von einem Europa, das nie ferner schien als jetzt.
Amadou konnte nichts sagen. Sein Mund war voller Salz, der allen Speichel zersetzte. Er nahm Lawrence' Hand, die nur noch drei Finger hatte, und drückte sie. Die Stümpfe spuckten Blut.
»Ein Topf voll Gold, was, Amadou?« Lawrence versuchte zu lächeln. Seine Lippen zitterten. Amadou drückte die Hand fester.
»Ein Topf voll Gold«, wiederholte Amadou und weinte. »Zwei.«
Als Lawrence’ Körper sich nicht mehr anstrengte, das Blut aus seinen Lungen zu würgen, wusste Amadou, dass er tot war. Er wollte schreien, wollte wehklagen, wie es in seinem Volk Brauch war, aber er konnte nicht. Zu gerne hätte er gewusst, was Christen tun, wenn ihre Angehörigen sterben. Aber auch das hatte ihm sein Großvater, der alles wusste, nie erzählt. Was, wenn Amadou irgendetwas tun musste, etwas ganz Bestimmtes, um Lawrence in den Himmel zu bringen, etwas, das ein Christ gewusst hätte? Der Gedanke, einen folgenschweren Fehler zu machen, lähmte ihn lange, doch irgendwann war der Drang, etwas tun zu müssen, größer. Amadou schloss Lawrence die Augen.
»Möge die Straße offen für dich sein«, begann er die Weisen seines eigenen Volkes zu murmeln. »Möge unterwegs kein Übel dir begegnen. Und mögest du die Straße gut finden, wenn du in Frieden gehst.«
Er fragte sich, ob sie sich wiedersehen konnten, wenn der eine im Himmel war und der andere in den Immergrünen Landen?
Ein unbehagliches, bauchiges Lachen antwortete und ließ Amadou herumfahren. Es war der Somali — in seiner Hand den Dolch. Er brüllte etwas, einen arabischen Satz, der kein Ende zu haben schien und kam mit balancierenden Schritten vom Bug heran. Auf halbem Weg zu Amadou taumelte ihm der Mali im Dscheballah in den Weg, stolperte, kotzte Salzwasser, dann sein eigenes Blut, als das Messer ihm den Bauch aufgerissen hatte, und wurde letztlich von einem astigen Arm ins Meer gestoßen. Längst machte der Somali keinen Unterschied mehr zwischen Freund und Feind. Er sah nur noch Beute.
Er füttert es, dachte Amadou. Und die Vermutung, die bis jetzt nur eine Wahrscheinlichkeit gewesen war, wuchs in Amadous Kopf zu einer unumstößlichen Absolutheit: Hier wird meine Reise enden. Jetzt werde ich sterben.