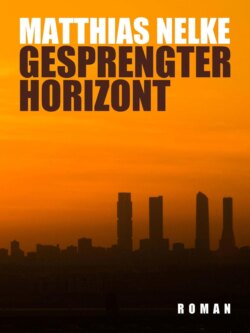Читать книгу Gesprengter Horizont - Matthias Nelke - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14. Die Barkeeperin
Оглавление[Bar »Moloch« in Moncloa, 23:50]. Die Nachtluft war schwanger mit Schweiß und schlechten Gewissen. Der Hinterhof stank danach, Verlierer hatten sich hier erleichtert. Urin hatte die Wand zwischen den Müllcontainern dunkel gefärbt und von der Ecke wehte die unverkennbare Mischung von Alkohol und Magensäure heran.
Großstadtatem, dachte Lucia Torres und hievte das leere Stahlfass nach draußen, um es auf die anderen zu stellen, die bereits an der rückwärtigen Wand der Bar aufgereiht waren. Sie zupfte sich das klebrige Shirt vom Rücken und setzte sich auf die Erde. Obwohl die Sonne bereits lange untergegangen war, war es in den Straßen der Stadt noch so stickig wie in einem Brennofen. Als sei die Luft zu schwer, um sich von allein nach oben zu verziehen, sondern müsste erst auf die Schwüle des Folgetags warten, um aus den engen Straßen und Gassen gepresst zu werden. Der Dunst ihrer Zigarette gesellte sich dazu.
Die festangestellten Barkeeper bevorzugten ihre Zigarettenpausen im ersten Stock des Gebäudes zu verbringen, wo das Moloch eine Dachterasse besaß und sie über die Sex Pistols, Dubstep und diese amerikanische Serie redeten, in der ein Lehrer anfing, blaue Drogen zu kochen. Nein, das waren Dinge, von denen Lucia Torres nichts verstand, die sie nicht kannte, weil sie zu alt war. Dinge, die Miguel gekannt hätte...
An was sie auch dachte, Lucias Kopf fand immer den kürzesten Weg zu ihrem Sohn. Seit sieben Jahren war das nun schon so. Auf der verzweifelten Suche nach etwas, dass sie ablenken konnte, ließ sie ihren Blick durch den Hinterhof schweifen.
Wenigstens für eine Zigarette, bitte, lieber Gott...
Die rückwärtige Wand des Delgado, eines hippen Restaurants, das mit seinen All-You-Can-Eat-Montagen punktete, war mit neuen Graffitis vollgesprayt worden. Schriftzüge, die sie nicht lesen konnte. Ein Mittelfinger. Fuck the Government. ACAB, was immer das hieß. Ein ejakulierender Penis. Darunter in leuchtend frischer Farbe No esta la juventud del papa. Das verstand sie: Die Jugend des Papstes ist nicht hier war Madrids Antwort auf die unliebsamen Pilger.
Lucia sog ein und blies aus. Folgte der Regenrinne neben den Schmierereien in den Nachthimmel, an dem keine Sterne zu sehen waren, bis ihr Kopf im Nacken lag und sie im Neunzig-Grad-Winkel in den schwarzen Himmel schaute. Sie fragte sich, ob es irgendwo dort draußen auch jemanden gab, der gerade in den Himmel guckte. Vielleicht ihr genau gegenüber. Von der Dachterrasse über ihr hörte sie Gelächter.
Aus der Gasse kam eine schwarze Katze angetrippelt. Sie sah Lucia an, als überlegte sie wirklich, die Menschenfrau aus ihrem Territorium zu vertreiben, und stolzierte dann weiter zur Straße. Lucias Blick folgte ihr, während sie die Zigarette im Rinnstein ausdrückte. An der Ecke zur Hauptstraße standen zwei Gestalten. Die Straßenlaterne zeichnete ihre Konturen nach. Der Größere lehnte lässig an der Wand, einen Schuhabsatz gegen die Fassade gestemmt, bedacht darauf, gleichgültig auszusehen, das wusste sie. Das markante Kinn und das Zöpfchen an Fernandos Hinterkopf stand schwarz ab gegen das Gelb des Lichts. Die Ost-Ecke des Moloch war sein Territorium. Soweit sie wusste, hatte er auch davor hier oft abgehangen, bevor er kleine Mengen Kokain gedealt hatte. Als er, Oscar und Miguel noch unzertrennlich gewesen waren. Unzertrennlich. Miguel...
Passierte es zum zweiten Mal innerhalb so kurzer Zeit, waren die Gedanken für gewöhnlich nicht mehr aufzuschieben. Das grüne Licht des Notausgangs fiel auf Lucias Unterarm mit dem Tattoo. Ein Kreuz mit einem M im Zentrum. Eine 11 unter dem Ellenbogen, »iguel« hin zum Handgelenk, »Amen« von links nach rechts. Lucia zündete sich eine zweite Zigarette an und schloss die Augen.
Miguel, Oscar und Fernando. Unzertrennlich. Hatte man einen von ihnen allein auf der Straße gesehen, hatte die erste Frage immer den anderen beiden gegolten. Menschen kannten sie nur als Trio. Als Miguel am 11. März 2004 starb, zerfetzt im Zug 21431 im Bahnhof Atocha, als einer von insgesamt 191 Toten bei den Anschlägen von Madrid, hatten Oscar und Fernando sich um Lucia gekümmert, wie sie wussten, dass Miguel sich um ihre Mütter gekümmert hätte, wäre ihnen etwas zugestoßen. Oscar hatte ihr Aufläufe gebacken. Bohnen und Reis. Fernando hatte ihr Kokain gezeigt. Als sie einmal mehr gebraucht als sie Bargeld dabeihatte, hatte Fernando ihr ein unmoralisches Angebot gemacht. Vielleicht hasste sie ihn, weil er Miguels Andenken mit Füßen trat. Vielleicht, weil sie eingewilligt hatte. Vielleicht, dachte sie, musste sie Fernando auch dankbar sein. Unmittelbar danach hatte sie ihren Resturlaub zusammengekratzt und sich einweisen lassen.
Als Lucia sechs Wochen später die Reha verließ, ging es ihr beschissener als zuvor. Sie war clean, und was jetzt? Sie wusste nicht wohin. Der Zufall wollte es, dass gegenüber der Klinik eine Kirche stand und die Straße zu überqueren eine genauso gute Richtung schien wie jede andere. Seitdem ging sie jeden Sonntag hin. Oft hatte Lucia sich gefragt, was passiert wäre, wenn gegenüber der Klinik eine Autowerkstatt gestanden hätte. Oder ein Bordell. Oder ein zwanzig Meter tiefer, leerer Brunnen.
In der Kirche hatte man Lucia gesagt, sie müsse lernen zu vergeben. Doch wie vergab man den Mord an seinem Kind? Und wem? In den Tagen nach den Anschlägen war die ETA von der spanischen Regierung und den Vereinten Nationen als Urheber des Terrors verurteilt worden und Lucia hatte die ETA gehasst. Dann war es plötzlich nicht mehr die ETA, sondern Al-Qaida gewesen, und sie hatte Al-Qaida gehasst. Als Anfang April eine Razzia in Leganes den vermeintlichen Drahtzieher des Anschlags aufgestöbert hatte, hatte Lucia einen Namen erhalten. Serhane Ben Abdemajid. Und sie hatte Serhane Ben Abdemajid und seine Komplizen gehasst. Doch die hatten sich nicht nur ihrer Verhaftung entzogen, in dem sie sich selbst in die Luft gesprengt hatten, sondern damit seltsamerweise auch Lucias Hass. Lange hatte es Torres aufgerieben, nicht zu wissen, auf wen sie ihren Hass abladen konnte. Kurzerhand hatte sie angefangen, alle dafür verantwortlich zu machen. Al-Qaida, Serhane Ben Abdelmajid, den Staat Marokko, den Islam. Drei Jahre nachdem sie zum ersten Mal einen ernsthaften Gedanken daran verschwendet hatte, den Mördern ihres Sohnes zu vergeben, beschäftigte sie dasselbe Problem wie kurz nach Miguels Tod. Wem sollte sie vergeben? Inzwischen hatte ihr Pfarrer sie begreifen lassen können, dass der Islam nur eine Religion und als solche Auslegungssache war, und dass sie nicht eine Milliarde Muslime über einen Kamm scheren könne; doch Frauen in Burkas jagten ihr noch immer Schauer über den Rücken, und wenn die Nachrichten von einem Bürgerkrieg zwischen Schiiten und Sunniten berichteten, wünschte sie sich insgeheim, beide Seiten würden sich endlich ausrotten. Blieb Serhane Ben Abdelmajid, dem im Jenseits so schwer zu vergeben war, wie sie ihn dort hatte hassen können. Und Al-Qaida? Wie konnte man denen vergeben? Sie lebte von Tag zu Tag, mit niemandem, den sie hassen und niemandem, dem sie vergeben konnte. Sieben Jahre blieben zum Hassen zu lang und zum Vergeben zu kurz.
Lucia hatte daran gedacht, es einfach hinter sich zu lassen. Den Job, der sie an ihren Sohn erinnerte, weil sie ihn hier immer hatte abholen müssen, wenn er zu betrunken gewesen war. Den anderen, der sie noch mehr an ihn denken ließ. Madrid. Doch Lucia fürchtete sich davor, den Schmerz zurückzulassen. Vielleicht würde sie Miguel vergessen. Als sie noch eine siebenundreißig-jährige, lebensfrohe, alleinerziehende Mutter gewesen war, hätte sie sich vielleicht einen neuen Mann gesucht. Doch jetzt war sie eine vierundvierzig-jährige, aufgebrauchte Barkeeperin, die ihren einzigen Sohn in Einzelteilen zu Grabe hatte tragen müssen.
Eine der beiden Gestalten hatte sich aus der Straßenbeleuchtung gelöst und kam jetzt den Hinterhof hinaufgeschlendert. Zuerst dachte sie, es sei Fernando, obwohl der ihr seit damals kein Kokain mehr verkaufte. Lucia blieb sitzen. Mit raschelnden Schritten kam die Gestalt vor ihr zum Stehen.
»Heiß, was?«
»Mhm.« Lucia sog ein.
»Feuer?«
Lucia streckte es dem Schatten hin. Im Licht der Flamme konnte sie sich ein Bild von ihm machen. Unter einer kleinen Stirn mit ungehemmten Haaren fiel eine krumme Nase auf. Wie ein Geier. Doch die Augen entschädigten. Gelbe Augen, die wussten, was sie wollten. Aus den Augenwinkeln beobachtete Lucia, wie der Mann sie musterte.
»Wie viel macht man als Barkeeperin in diesen Tagen?«
»Nicht genug.«
»Ihr Zweitjob?«
Sie nickte und blies aus.
»Einen für das Dach über dem Kopf uns einer für das Brot auf dem Tisch.« Er nahm die Zigarette aus seinem Mund, um etwas in die Ecke zu spucken. Eine Pistazienschale. »Scheiß Europa. Scheiß Spanien.«
Das zweite kam ihm seltsam über den Lippen; Lucia Torres kannte nur stolze Spanier. Sie gab keine Antwort. Europa fiel seit Jahren auseinander. Spanien steckte tief drin, sie hatte es mitbekommen. Sie dachte nicht viel daran. Sie ging zu dem Job, der ihr das Brot auf den Tisch brachte, und in ihrer Freizeit stellte sie sich hinter die Theke im »Moloch«, was ihre Miete bezahlte. Sie schlief wenig, was gut war. Weniger Schlaf bedeutete weniger Träume.
Der Mann schnipste die Zigarette weg. Er hatte keinmal daran gezogen.
»Lust, etwas dazuzuverdienen?« Nur eine Frage der Zeit. Vielleicht sollte sie Fernando endlich der Polizei melden. Doch was würde Miguel denken? »Ich habe gehört, sie sind die, zu der man kommen muss, wenn man einen Gefallen braucht.«
»Kommt auf den Gefallen an«, hörte Lucia sich sagen.
»Nun, ich will ehrlich mit Ihnen sein.« Der Mann bleckte beim Grinsen gefräßige, schiefe Zähne. Lucia konnte seine Augen nicht mehr sehen. »Es ist mehr ein Angebot. Ein... unmoralisches Angebot.«