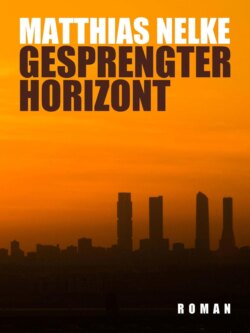Читать книгу Gesprengter Horizont - Matthias Nelke - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Die Göre
Оглавление[Kirche San Antonio de los Alemanes, 14:01]. Wie war sie nur hierhin gekommen? Kim wusste es genau, Hanna hatte sie an diesen Ort geschleift, hatte gebettelt und geklimpert und hier saß sie jetzt. Doch das war nur eine chronologische Abfolge. Es erklärte nicht, warum sie es zugelassen hatte. Sie konnte es zurückverfolgen, Wegpunkt für Wegpunkt, und doch kam sie immer an den Punkt zurück, sich zu fragen, wie sie nur an diesen Ort gelockt worden war, den sie sich geschworen hatte, nie wieder zu betreten.
Kim ließ sich so tief auf der Kirchenbank hinabrutschen, dass sie ihren Kopf auf der Gebetsbuchablage abstützen konnte, steckte die Converse zwischen den Spalt der Vorderbank, zog die Schultern hoch und spielte mit ihrem Zungenpiercing. Die kleine Kapelle wirkte wie eine Ausstellungshalle. Immer neue Leute strömten durch die Vorderpforten und liefen den Kreuzweg im Kreis, der in Messingtafeln an der Wand angebracht war. Hauptfigur leidet zwölf Kapitel und stirbt am Ende, wollte sie ihnen zurufen. Kim wünschte sich, ihr Messdienerwissen vergessen zu können, und drehte die Lautstärke ihres iPods weiter auf, in der Hoffnung es zu zerstören. Das Gerät meldete ihr, dass sie bereits am Maximum angekommen war. Sie drückte sich die Plug-Ins in die Ohrmuschel, bis es wehtat.
Während sie in den Reihen der Glotzenden nach einem blonden Lockenschopf und einem wasserstoffblonden Kurzhaarschnitt suchte, sprang die Playlist aufs nächste Lied. Ein Kirchenchor begann zu singen, dass man nicht immer das bekommen konnte, was man wollte. Und Menschen sagten, Ironie sei tot. Sie wusste nicht einmal mehr den Namen des Jungen; irgendwas Neudeutsches, das Drittklässler cool finden, mehr eine Diagnose moderner Elternschaft als ein Name. Im Musikunterricht hatte jeder Schüler sein Lieblingslied mitbringen sollen und der Junge, den alle Drittklässler cool fanden — Tim oder Tom oder so —, hatte das Mädchen mit dem Rocker-Vater um Rat gefragt. Seit der bei Kims letztem Kindergeburtstag die Tür in sein Schlagzeugzimmer geöffnet hatte, sprach man über ihn in der 3A nur noch im Flüsterton. Kim hatte eine CD gebrannt. Mit den Stones und einem Herzchen drauf. Als die Klasse nach fünfzig Sekunden Gospelchor am Anfang von »You can't always get what you want« mit dem Lachen nicht mehr aufgehört hatte, war Tim oder Tom, oder wie er auch geheißen hatte, unter Tränen hinausgestürmt. Auf dem Nachhauseweg passte der Junge Kim ab, um es sie büßen zu lassen. Von allen Jungen und Mädchen, die Kim in ihrem Leben danach noch verprügelt hatte, hatte Timtom es immer am meisten verdient gehabt.
Jemand stöpselte Mick Jagger aus ihrem linken Ohr und ließ Flipflopklatschen und Tuscheln in ihre Ohrmuscheln fluten. Kim spürte ihren Wutpuls schneller schlagen.
»Und, was hören wir?« Am anderen Ende der Kopfhörer wurde gezogen und auch der zweite Stöpsel ploppte aus Kims Ohr und pendelte zu Boden. »Ups.«
Kim blinzelte nach links. Wäre da nicht diese Zahnlücke, dachte sie. Und wüsste sie nicht so verdammt gut, sie einzusetzen.
Hannahs entwaffnendes Grinsen spannte sich von einem Ohr zum anderen. Unter dem Lockenpony blühten braune Augen auf. Sommer sprossen. Jungs drehten sich nach ihr um, und sie war sechzehn und wusste es nicht einmal. Doch Kim blieb sich sicher, es war die Zahnlücke.
»Was willst du?«, antwortete Kim. Ihr Grinsen verriet sie längst.
»Bin fertig.«
»Worauf warten wir dann noch?«
Hannahs Handy klingelte und sie warf einen leuchtenden Blick darauf. »Jacob sucht noch immer sein Portemonnaie.« Schon tippte sie eine Antwort.
»Du weißt noch, was er vorhin gesagt hat, oder?«, fragte Kim. »Er wollte zu diesem Bahnhof Atocha, wo wir mit dem Regionalzug angekommen sind. Da wo sich vorhin die Pilger und Einheimischen fast geprügelt haben. Auf wen denkst du, wird dein Märchenprinz die Steine werfen, huh?«
Vielleicht gibts da ja ne Schlägerei, hatte Jacob geflüstert, sodass nur sein Bruder, Kim und Hannah es hatten verstehen können.
»Blabla, das sagt er ja nur«, wiegelte Hannah ab. Doch sie schien Zweifel zu bekommen und hob den Kopf.
Kim zuckte nur mit den Schultern. Sie konnte Jacob nicht leiden, der Typ war ein Selbstdarsteller und ein Schaumschläger. Mädchen drehten sich nach ihm um und er war siebzehn und er wusste es nur zu gut. Doch er schien nicht wie die Art von Angebern, die Dinge nur sagen, um sich zu profilieren.
»Egal.« Hannah schüttelte den Gedanken ab. »Er will wissen, ob du auch wirklich nicht sein Portemonnaie hast.«
Als Kim nicht antwortete, sah Hannah von ihrem Handy auf.
Kim bemerkte es sofort. »Weißt du was, leck mich.«
»Ich frag ja nur.«
»Zum dritten Mal? Ich fass es immer noch nicht, dass du ihm davon überhaupt erzählt hast?«
»Beim letzten Portemonnaie musste ich fünf Mal fragen, bevor du es rausgerückt hast.« Mit gehobenen Brauen sah sie Kim an. Da war Strenge in ihrem Blick, doch nur eine Prise. Gerade so viel wie zwischen Freundinnen angemessen war. »Aber du hast recht. Dachte, er würde dich mögen, wenn er weiß, wie du drauf bist.«
Kim schürzte die Lippen und sah weg. Ihr ging am Arsch vorbei, ob Jacob sie mochte, oder irgendwer sonst, was das anging. Sie hasste Menschen. Dass das Hannah nie eingeschlossen hatte, war die Basis ihrer Freundschaft.
»Ich mach das nicht mehr, hab ich dir doch gesagt«, antwortete Kim. »Vielleicht hat’s diese Fernseh-Schnecke doch mitgehen lassen. Außerdem, Jacobs ist sicher eh leer, was soll ich dann damit?«
Hannah wusste, dass es Kim nie ums Geld ging. Und Kim wusste, dass Hannah wusste, dass es ihr nie ums Geld ging. Sie lauschte der Stille, während Hannah zu Ende tippte.
In Hannahs Rücken kam eine alte Dame heranstolziert. Ihr abfälliger Blick maß Kim von oben bis unten wie einen Obdachlosen in der Lobby eines Fünf-Sterne-Hotels. Kim blitzte zurück. Als Hannah die Frau bemerkte, fuhr sie herum.
»Hola.«
Hannah lächelte breit.
Der Blick der Dame zuckte zu dem anderen Mädchen, das sie mit offensiver Freundlichkeit in die Flucht schlug, künzelte ein Lächeln zurück und trollte sich.
Vermutlich waren sie deshalb beste Freunde, dachte Kim. Weil Hannah sich auch dann nicht drum scherte, mit Kim in einen Topf geworfen zu werden, wenn sie gelegentlich Geldbörse mitgehen ließ oder Kirchenbänke mit Converse entweihte. Weil Hannah die einzige Person auf der Welt war, die sich um die allgemeine Meinung nie scherte und der Kim deshalb nicht die Zähne ausschlagen wollte, sobald sie den Mund aufmachte. Obwohl, Korrektur: Weil sie die einzige noch lebende Person war.
Kims Gedanken begannen zu wandern, bergab...
»Können wir?«
Hannah kaute ihre Unterlippe. »Ich will dir etwas zeigen.«
»Hier?«
»Mh-hm.«
Widerstand war zwecklos, wusste Kim. Außerdem war es ja nicht so, dass sie Gefallen generell abgeneigt war.
»Also gut, Zahnlücke. Let’s go.«
Suza war gerade dabei, eine bemitleidenswerte Touristin, deren schwarz-rot-goldener Hutkrempe sie als vermeintliche Busenfreundin ausgeliefert hatte, tot- und damit buchstäblich an die Wand zu quatschen, als Hannah ihr den Dakine, den sie sich zu dritt teilten, zwischen die Füße stellte. Die kleine, kurzhaarige Polin in der lächerlichen Latzhose nahm davon nicht einmal Notiz. Ihre Stimme schüttelte die Kirche, Glas klammerte sich an Fensterrahmen. Die deutsche Touristin sehnte sich in die Passion.
Nur wenige Besucher hatten sich in den hinteren Teil der Kirche verirrt. Stahlträger stützten die gotische Decke. Die Orgel und die Empore, auf der sie stand, waren von einer überdimensionalen, milchigen Bauplane eingehüllt. Doch Hannah wusste, wohin sie wollte. Vor einem der bunten Fenster blieb sie stehen. Sonnenlicht fiel durch das getönte Glas und stanzte das Negativ einer in Blau gekleideten Frau an die gegenüberliegende Wand. Im Arm hielt sie einen Säugling. Auf einem Tischchen darunter brannten aufgereihte Teelichter.
»Ich will über Maria reden«, sagte Hannah.
Überraschung.
Kim fühlte ihren Körper kalt werden. Von innen nach außen, wie sonst auch. Sie hatte das Gefühl, mit der Wärme würde alles, was sie menschlich machte, unter ihrer Haut zerrieben, bis sie bloß noch eine Eissäule war, die nichts mehr fühlte. Wie war sie nur hier hingekommen, fragte sie sich wieder. Irgendwann dämmerte es ihr.
»Du wolltest den Scheiß Kreuzweg gar nicht sehen.« Bitterer Speichel sammelte sich unter Kims Zunge. »Dir ging's die ganze Zeit nur hier drum.«
»Ich mach mir Sorgen, OK—«
»Scheiße, ich hab dir gesagt, du sollst mich damit in Ruhe lassen.« Kim schrie bereits. Köpfe drehten sich in ihre Richtung.
Andere Menschen hätten sich davon einschüchtern lassen. Kim sah bedrohlich aus, wenn sie wütend war, das wusste sie. Das machte die Hasenscharte, die ihre Lippe einschnitt. Doch Hannah kannte die Narbe schon lange.
»So funktioniert das aber nicht.« Die kleine Blondine streckte die Stirn nach vorne und zog die Fersen zusammen. »Du kannst nicht einfach Menschen irgendwelche Versprechen abknüpfen und dann erwarten, dass sie mitansehen, wie du dich selbst monatelang kaputt machst. Es gibt Leute, die machen sich Sorgen. Ich mache mir Sorgen.«
»Such dir wen anders, um den du dich kümmern kannst.« Kim wandte sich ab. Doch es gab nur die Fensterikone.
»Jetzt sei nicht so egoistisch, ich will dir helfen.« Hannah holte tief Luft, beruhigte ihre Stimme. Dinge, die man lernte, wenn man mit Kim befreundet war. »Alle verstehen, dass es hart für dich war.«
»Ihr alle versteht einen Scheiß.«
»Okay.« Pause. »Es ist normal, dass du dich fragst, warum so etwas ausgerechnet Maria zustoßen musste...«
»Lass es einfach.«
»…dass du wütend bist... darauf, dass es passiert ist.«
Kim hatte versucht, durch das Glas hindurch den Himmel zu sehen, hatte versucht, die farbigen Scherben bloß als kaputtes Fenster wahrzunehmen. Sie hatte versucht nicht daran zu denken, sich nicht bergab ziehen zu lassen. Aber sie hatte immer nur durch den weißen Fleck des Säuglingskopfes sehen können. Dahinter war der Himmel farblos und still. Und wie jede Stille, wie jede Abwesenheit von irgendetwas, hatte Kim die Farblosigkeit mit ihren eigenen Gedanken und Bildern gefüllt. Bis der Kopf platzte.
»Boah, du raffst es nicht«, brüllte sie. »Ich frage mich nicht, warum Gott sowas zulässt. Weil, wenn es ich es täte, würde das bedeuten, dass ich noch an diesen Schwachsinn glauben würde, und das tue ich nicht. Der Scheiß juckt mich nicht mehr. Auch 16-jährige erkranken an Krebs, so ist das eben.« Ein Klos verstopfte ihre Kehle. Kim musste ihn samt ihrem Schreien hinunterschlucken. Danach bebte ihre Stimme. »Aber sie verweigern verdammt noch mal nicht ihre Therapie.«
Kims Worte hallten in der Kirche nach, verloren sich unter der von Stützbalken gestemmten Decke. Die Teelichter flackerten. Hannah wartete nicht, bis das Echo sich legte.
»Kim, es war Marias Entscheidung—«
»Und damit ist es OK, ja? Es war Marias Entscheidung. Scheiße, hörst du dich eigentlich reden? Du sagst das so, als wäre sie eine erwachsene Frau, aber Hannah, sie war ein Kind. Kannst du mir sagen, wie abgefuckt das ist? Ein Kind, das Chemotherapie verweigert, weil es akzeptiert hat zu sterben.«
Letztlich sah Hannah doch weg. Kim konnte ihr ansehen, dass sie bereits ähnliche Gedanken durchgegangen war. Sie zitterte. Doch Kim kümmerte es nicht. Nicht mehr.
»Und verschon mich damit, dass ihre Überlebenswahrscheinlichkeit gen Null ging. Das hab ich schon tausendmal gehört. Ist es das, was die Religion ausmacht, ja? Wenn die Chancen schlecht stehen, gibt man sich einfach mit dem Ergebnis zufrieden? Ich dachte immer, gläubige Menschen erholen sich schneller von Krebs, ich dachte, der Glaube gibt einem die Kraft, zu kämpfen, nicht die Gleichgültigkeit, zu sterben. Du kannst es drehen, wie du willst, hätte Maria nicht diesen Kirchenquatsch im Kopf gehabt, die hätte nicht im Traum daran gedacht, sich nicht behandeln zu lassen. Keinem normalen Kind in dem Alter ist das Leben so scheißegal. Das ist krank. Was sie geglaubt hat, ist krank.«
Hannah unternahm einen verzweifelten Versuch, trat so nah an Kim heran, dass sie sich ihr fast an den Hals warf, doch ihre Freundin wich aus. Hannahs Stimme klang heiser: »Sie hat einfach akzeptiert, dass Sterben nichts Schlimmes ist. Ist—«
»Aber das ist es!« Die Kirchenakkustik warf das Echo zurück. »Es ist schlimm! Aber du stehst hier und verteidigst sie weiter, so wie ich wusste, dass du es tun würdest. Redest über sie, als hättest du sie gekannt, nur weil ihr beide jeden Abend brav gebetet habt. Schleifst mich hier hin, in dieses Scheißkloster. Als würde es mir danach besser gehen.« Ein Teil von Kim, der Teil, der nicht die Kontrolle hatte, bemerkte, dass Hannah angefangen hatte zu weinen. »Warum, denkst du, hab ich dir gesagt, du sollst mich damit in Ruhe lassen? Weil ich nicht gerne mit meiner besten Freundin darüber geredet hätte? Natürlich hätte ich das. Aber das kann ich nicht. Du bist auf der falschen Seite, du wirst es immer sein.« Plötzlich wollte sie nichts mehr, als allein zu sein. »Du willst mich nicht trösten. Es interessiert dich einen Scheiß, was ich denke. Du willst nur, dass ich es endlich akzeptiere, damit ich wieder bin wie früher.«
Hannahs Ohrfeige ließ die Teelichter zappeln. Sie echote einmal durch die Kirche und kam wieder zurück. Es war nicht das erste Mal, Kim hatte sie fast erwartet.
»Natürlich geht es wie immer nur um dich«, brüllte Hannah. »Wie kannst du nur so ein emotionaler... Staubsauger sein? Warum bist du überhaupt mitgekommen?« Sie schien noch etwas anderes sagen zu wollen, doch ließ es sein. Mit dem Handrücken wischte sie sich Tränen von der Nase. »Mach doch, was du willst.«
Kaum waren Hannahs davonklatschende Flipflopschritte verhallt, wollte Kim ihr nachrufen, doch sie blieb. Das Gefühl, das sie so liebte, das wie ihre Droge geworden war, kündigte sich an: Sie fühlte sich beschissen. Schuldig. Emotionaler Staubsauger…
Drei Minuten später stand sie noch immer vor dem Kerzenpult unter dem bunten Fenster und stellte sich Hannahs Frage: Warum war sie hier? Das Gewicht des verfluchten Schlüsselbandes, an dem sie wie jeder Pilger ihre 5-Tage-Fahrkarte und die Essensmarken in einer DIN-A6-Plastikhülle spazieren trug, verankerte sie in einer unerträglichen Realität, in der die Messen sie anödeten, Nachtruhe tatsächlich kontrolliert wurde, und sie nach Feuer immer in einer anderen Sprache fragen musste, weil keiner aus ihrer Gruppe auch nur je an einer Zigarette gezogen hatte. Du dachtest, dass es Maria gefallen hätte. Vielleicht. Doch da war mehr. Zu behaupten, sie hatte gehofft ihren Glauben wiederzufinden, war wahrscheinlich zu viel. Das Schiff war längst davongesegelt. Gekentert und gesunken. Vielleicht hatte sie gehofft, einen Abschluss zu finden. Zu akzeptieren. Als Maria gestorben war, war Kim in der Trauerkette bei Wut eingestiegen und hatte sich seitdem nicht mehr voranbewegt. Nein, du willst dir vergeben können. Ja, wahrscheinlich das auch... Scheiße, sie brauchte dringend eine Kippe!
Kim wusste selbst nicht genau warum, als sie ein Teelicht aus dem Spender nahm, es an einem der anderen entzündete und auf dem Pult platzierte. Kim versuchte sich vorzustellen, dass es Maria war. Sie ließ das Zungenpiercing jenseits ihrer Zahnreihe von links nach rechts wandern und gegen ihre Zähne klacken, wie immer, wenn sie warten musste. Aber so sehr sie sich auch anstrengte, die Kerze blieb eine Kerze. Sie fühlte sich nicht anders. Sie fühlte keine Verbindung, die das Licht erzeugt haben könnte. Es war nur ein Licht, jetzt wieder unter einem Fenster, das nur ein Fenster war. In einem Gebäude, das nur eine Baustelle war. Hier hörte keiner zu. Was hatte sie sich nur dabei gedacht?
Draußen warteten Hannah und Suza bereits auf sie. Die Hitze betäubte sie fast, doch Kim fühlte sich besser, wieder sie selbst. Die Zigarette, die sie an dem Teelicht entzündet hatte, ehe es im Müll gelandet war, hatte den bitteren Geschmack unter ihrer Zunge vertrieben. Ihr nasser Daumen und Zeigefinger, mit denen sie ein Teelicht nach dem anderen ausgedrückt hatte, brannten noch nach in ihrer Hosentasche.