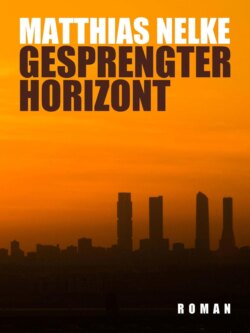Читать книгу Gesprengter Horizont - Matthias Nelke - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11. Der fliegende Händler
Оглавление[Puerta del Sol, 19:25]. Eine Frau mit feuerrotem Haar blieb in der Menge stehen und fütterte das Baby, das sie sich vor die Brust geschnallt hatte, mit einem Keks. Auf einem Skateboard schlängelte ein Halbstarker durch die Menge. Etwas abseits hatten sich Pilger zu einem Kreis gefunden und sangen an gegen das Fußstapfenorchester. Geschäftsleute telefonierten fieberhaft. Die drückende Hitze raubte allen die Geduld. Aktentaschenträger rempelten Einkaufstütenträger, Turnschuhe traten auf nackte Füße in Sandalen. Keiner entschuldigte sich. Etwas den Gang hinunter kam es zwischen einem Mann mit Hakennase im pechschwarzen Anzug und einer Frau im weißen Top zu einem Disput. Die Frau — klein, mit einem strengen Flechtzopf über den Mittelscheitel — riss dem Mann etwas aus der Hand, das wie eine Maske aussah, und warf sie in den Müll, dann stieß sie ihn gegen die Kachelwand. Als er sich wehrte, klemmte sie ihm den Arm auf den Rücken und nagelte ihn gegen die Wand. Der Mann versuchte sich vergeblich zu befreien. Er brüllte, sie zurück; keinen kümmerte es. Sie sprachen kein Spanisch.
Es war eine der geschäftigsten Kreuzungen in Madrid, gemessen an ihrer Größe. Vier Fußgängertunnel trafen sich hier, zwei zu jeder Seite. Aus den beiden linken Tunneln fluteten die Passanten vom Puerta del Sol an der Oberfläche herunter, um auf den Gegenstrom aus den gegenüberliegenden Tunneln zu stoßen, der gerade die Drehkreuze durchquert hatte und von den Gleisen der U-Bahn-Linien 1 und 3 heraufkam. Die meisten Menschen hielten hier nicht. Die, die es doch taten, kauften sich im Stehcafé einen Cappuccino oder überflogen kurz die Schlagzeilen der Tageszeitungen, die der Besitzer des kleinen Stehcafés daneben jeden Morgen in hohen Rondellständern aus seiner Verkaufsnische schob.
Für den hageren Afrikaner, der an der gegenüberliegenden Wand unter der Werbetafel eines Telefonanbieters auf einer Fleecedecke saß und Ramsch verkaufte, interessierte sich keiner. Keiner brauchte gefälschte Portemonnaies, keiner Sonnenbrillen mit getürkten UV-Zertifikaten, keiner verdünnte Parfüms oder farbenfrohe Uhren aus minderwertigem Plastik. Sie alle brauchten etwas, doch keiner das, was Amadou anzubieten hatte.
Vielleicht lag es an seinem Platz, dass er nichts verdiente. Salomon etwa machte gutes Geld, doch der saß direkt unter dem großen UNICEF-Plakat auf dem Weg zu Gleis 6. Wenn von der Wand ein überdimensionales Kindergesicht flehte, fühlten sich die Menschen eher genötigt, einem armen Afrikaner Schrott abzukaufen. Selena hatte Amadou das Plakat in seinem Rücken einmal erklärt: Connecting People, Menschen zusammenbringen. Die sich nähernden Hände im Firmenlogo des Anbieters Nokia gehörten wohl einem Mann und einem Kind, doch zum Anlass der großen Veranstaltung in der Stadt waren sie durch den Ausschnitt eines bedeutenden Kunstwerks ersetzt worden, das in irgendeiner südeuropäischen Kirche an der Decke hing. Es half ungefähr so viel wie das Pappschild mit seiner Geschichte. Gelegentlich, wenn die Müdigkeit Amadou so weit niederrang, dass sie ihn von seiner wahren Geschichte erlöste, dachte er: Zum Glück habe ich keine Familie zu ernähren. Doch immer erinnerte er sich wieder. Dann packte er die Bilder seiner Vergangenheit und den Abfall seiner Gegenwart zusammen und ging zur Tafel in Chamberi, bevor sie dort keine Suppe mehr austeilten.
Die anderen hatten gesagt, es würde besser werden, jetzt, da die ganzen Touristen hier waren. Die Christen, die hatten Mitleid. Doch während Amadou weiter auf seinem Platz unter dem Ausschnitt von Michelangelos Fresko aus der Sixtinischen Kapelle saß, metertief unter dem Puerta del Sol, liefen die Menschen weiter an ihm vorbei, ohne von ihm Notiz zu nehmen, wie sie es in den letzten sechs Wochen getan hatten, seit er hier saß. Es waren bloß mehr.
Amadou fröstelte; das passierte oft hier. Er zog die Knie an, legte das Kinn darauf und sah den anderen tausend Kniepaaren beim Vorbeigehen zu. Knochige, glatte, unrasierte, bedeckte, nackte, aufgeschlagene, verkrustete, blaue, spitze, platte, in Verband gewickelte — sogar ein Paar Knie, auf das sich ihre Besitzerin je einen lachenden und einen traurigen Smiley hatte tätowieren lassen. Er fragte sich, wie viele davon benutzt wurden, um Allah anzubeten. Vermutlich nicht viele, diese Veranstaltung in der Stadt war nur für Christen, so wie er das verstand. Danach beobachtete er die Hände. Große, mickrige, Kinderhände, adrige, leere, volle, schmutzige und solche mit gemachten Fingernägeln. Ob sie Moslems auswiesen, wenn sie versuchten, teilzunehmen und die Hände zu falten? Solche Dinge fragte Amadou sich, seit sein Großvater, der alles gewusst hatte, ihm nicht mehr antworten konnte. Dass unweit voneinander Menschen zur selben Sache beteten, sich jedoch gegenseitig verabscheuten, weil sie in unterschiedlichen Gebäuden nach unterschiedlichen Regeln aus unterschiedlichen Büchern lasen, verwirrte Amadou fast so sehr, wie die Arroganz jener Menschen, ihn zuhause einen »Gottlosen« zu schimpfen, obwohl er mehr Götter hatte als jeder von ihnen. Diese Religionen mit einem Gott erinnerten ihn fast an die Warlords in Afrika. Sie teilten die Welt, die Welt in den Köpfen, um ihre Herrschaft zu festigen. Teilten sie in Zebras und Löwen. Nein, in Löwen und Hyänen. Warum brauchte jede Religion die andere als Feind, wenn sie sich über die Anzahl der Götter doch schon einig waren? Die Menschen unterschieden sich ohnehin schon genug voneinander: Arme und Reiche, Frauen und Männer, Weiße und Schwarze. Selbst ohne Religion mit in die Gleichung einzubeziehen, misstrauten sie sich, hassten sich, bekämpfen sich. Dass die Menschen mehr wissen wollten, war doch eines der wenigen Dinge, die alle einte: Woher kamen sie? Warum waren sie hier? Wohin ging es, wenn sie einmal tot waren? Unterschiedliche Antworten änderten nicht, dass sie alle die selben Fragen stellten.
Amadou sah an dem Plakat hoch, an dem er lehnte, und fragte sich, ob jemals jemand darauf gekommen war, dass Menschen zusammenbringen kein logistisches Problem war. Sondern ein spirituelles. Wie um mit ihm darüber zu philosophieren, tauchte Selena auf.
»Du bist spät«, begrüßte Amadou sie auf Englisch. Selena lächelte, doch es war weit entfernt. Sie setzte sich zu ihm.
»Für dich«, sagte sie ohne ein weiteres Wort und schob zwei Portemonnaies über die Decke. Ein großes braunes, mit einem Raster aus hellbraunen Karos, und ein kleines weißes, mit einer goldenen Schnalle aus verschlungenen Sicheln.
»Sie gehören dir«, sagte Selena. »OK? Ich will nicht, dass du sie mit diesen Ausbeutern in Leganés teilst, klar? Deine Ware, dein Geld. Und nimm ordentlich was dafür, das sind Originale.«
Sie schob die Stirn vor, als sie ihm tief in die Augen sah. Wie eine große Schwester, obwohl sie mindestens zehn Jahre jünger war als er. Amadou musste lachen. Er mochte sie.
»Klar. Danke.«
Selena schob sich mit ihren langen Beinen wieder in die Höhe.
»Du gehst schon?«, fragte Amadou. Normalerweise blieb Selena immer einige Minuten, um ihn zu fragen, wie es lief.
»Ja, ich muss los.« Sie rieb sich die Oberarme, als wolle sie noch irgendetwas sagen. Ihr Blick huschte über die Passanten. »Kann sein, dass ich morgen nicht komme. Weiß nicht, ob ich Zeit finde.«
Vier Wochen kannten sie sich. Selena hatte jeden Tag Zeit gefunden.
»Fährst du weg?«, fragte Amadou.
»Nein, ich... hab vielleicht eine Möglichkeit.« Amadou wusste nicht, was das bedeutete. Selena schien es selbst nicht zu wissen. »Weiß ich noch nicht genau. Und keine Ahnung, wie lange ich dann weg wäre.«
»Was für eine Möglichkeit?«
»Weiß ich noch nicht.«
Sie ist nicht hier, dachte Amadou. So hatte er Selena noch nie gesehen. So rastlos, fast fiebrig. Irgendwie auf der Flucht. Doch bevor er der Sache auf den Grund gehen konnte, sah er ihren Körper steif werden. Ihr hoher Kopf erblickte etwas über den anderen.
»Was?«, fragte Amadou, der ahnte, was es war. Im nächsten Augenblick sah er Salomon an ihnen vorbeistürmen, über seiner Schulter das Deckenbündel.
»Los, beeil dich«, zischte Selena.
Sie musste es Amadou nicht zweimal sagen. Schon hatte er seine Decke bei den vier Zipfeln gepackt und zu einem Bündel gebunden, das er sich über die Schulter werfen konnte. Jeder wusste, was sie im Wohnheim mit denen machten, deren Ware die Polizei beschlagnahmte. Einmal war es bereits eng geworden. Die beiden Polizisten hatten bereits auf seiner Decke gestanden. Im letzten Augenblick hatte sich eine schwarzhaarige junge Frau zwischen sie gedrängt, mit einer Kamera gewedelt und gesagt, sie mache Fotos für ein Kunst Projekt. Amadou gehöre zu ihr, er brauche keinen Gewerbeschein. So hatte er Selena kennengelernt. Jetzt rannte Amadou, bis er sicher war, dass er die Streife abgeschüttelt hatte. Selena war spurlos verschwunden.