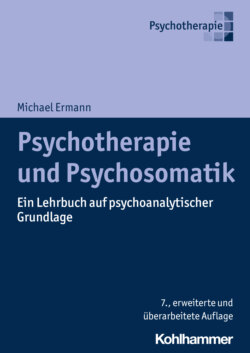Читать книгу Psychotherapie und Psychosomatik - Michael Ermann - Страница 161
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2.4 Symptomentstehung
ОглавлениеAus der geschilderten Pathologie ergibt sich, dass die Ichschwäche und Ichstrukturstörung, die Identitätsdiffusion und gering integrierten Selbst- und Objektvorstellungen, die Aggression und die Verwendung anderer als Hilfsich und Selbstobjekt eine labile psychosoziale Situation schaffen. Die Borderline-Persönlichkeitsorganisation stellt damit ein erhebliches Krankheitsrisiko dar.
Oft gehen stabilisierende und substitutive Beziehungen und Strukturen verloren. Es entstehen Desorientierung und Verzweiflung. In deren Folge wird die innere Welt von aggressiven und destruktiven Phantasien und von Vernichtungsangst überschwemmt. Eine Vielzahl von aktuellen Problemen, Konflikten und Belastungen erhält subjektiv die Bedeutung von Angriffen auf das Sicherheits- und Selbstgefühl. Die anstehenden Herausforderungen können nicht mehr bewältigt werden. Indessen entstehen Versuche, solche Angriffe durch Spaltung zu beherrschen. Wenn diese Versuche misslingen, kommt es zur Desintegration.
Die Desintegrationszustände selbst sind mit panischer Fragmentierungsangst (Selbstverlustangst), Vernichtungs- und Verfolgungsangst verbunden. Insgesamt entsteht das Bild einer chaotischen, krisenhaften Dekompensation. Die Folge sind vielfältige Symptome und Beeinträchtigungen ( Übersicht). Dabei hat die Symptombildung verschiedene Wurzeln bzw. sie erfüllt verschiedene Funktionen:
• Defizitäre Symptombildung: Impuls- und Affektdurchbrüche legen unmittelbar die Ichdefizite offen. Angst, Panik und somatoforme Störungen sind Begleitreaktionen der Desintegration. Psychotische Realitätsverkennungen, Beziehungsabbrüche und Verfolgungserlebnisse verweisen auf den regressiven Ichzerfall.
• Kompensatorische Symptombildung: Dissoziation und Entfremdung sind Notreaktionen gegen unerträgliche Wahrnehmungen der Desintegration. Selbstbeschädigung und Suchtverhalten, perverses und aggressives Agieren sind Versuche, Leerstellen im Selbsterleben aufzufüllen und den Kontakt zu sich zurückzugewinnen. Das Agieren hat außerdem die Funktion, den verlorenen Anderen zurückzugewinnen und wieder unter Kontrolle zu bringen.
Je stärker die Desintegration, umso vielfältiger werden die klinischen Bilder, d. h. umso umfassender ist die Komorbidität. Sie können von einem Syndrom, das mehr oder weniger auf ein Symptom begrenzt ist (z. B. einem Zwangssyndrom, der Selbstbeschädigung oder einer Depersonalisation) bis hin zu komplexen und vielgestaltigen Krankheitsbildern reichen. Letztere sind typisch für die Borderline-Persönlichkeitsorganisation und werden als Borderline-Syndrom ( Kap. 8.4) bezeichnet.
Als weitere Folge der Desintegration werden körperliche Prozesse in den Desintegrationsprozess einbezogen. Wie das im Einzelnen geschieht, ist noch nicht genau geklärt. Entscheidend sind wahrscheinlich körperliche Dispositionen, z. B. eine ererbte Bereitschaft zu maladaptiven psychoimmunologischen Reaktionen. Auf diese Weise wird die Desintegration des niederen Strukturniveaus zum bevorzugten psychischen Kofaktor bei der Entstehung von Psychosomatosen. Die Dekompensation wird zumeist durch Verlust- und Trennungserlebnisse ausgelöst, die Verlassenheitsgefühle, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit hervorrufen und das Sicherheitsgefühl und die Funktionsfähigkeit des Ich bedrohen ( Kap. 12.2.3).
Ähnlich kann man sich den Einfluss psychischer Krankheitsfaktoren auf die Entstehung von Psychosen vorstellen, die als vornehmlich körperlich begründet betrachtet werden ( Kap. 13).