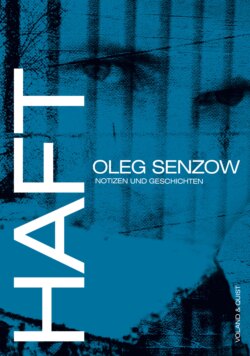Читать книгу Haft - Oleg Senzow - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tag 26
ОглавлениеDie Krise, die der Doktor angekündigt hat, ist eingetreten. Gestern hat sie sich schon angedeutet, heute schlägt sie mit voller Wucht zu. Der Abfall ist plötzlich gekommen und war heftig. Ich merke ganz deutlich, dass die Pumpe nicht mehr mitmacht. Meine Hände und Füße sind eiskalt, fast blau. Ich kriege keine Luft. Mir ist schwindelig, ich fühle mich benommen. Der Organismus hat seine Reserven aufgebraucht und greift auf die eigene Substanz zurück. Am Morgen lag der systolische Wert bei siebzig, der diastolische war gar nicht zu messen, der Puls auch nicht. Ich fühle mich beschissen. Dabei ging die Infusion gestern fast fünf Stunden, sogar mit neuen Präparaten mit Aminosäuren und anderen ergänzenden Substanzen, aber auch das hat die Lage nicht gerettet. Nach dem Tropf wollte ich schnell zur Toilette und wäre dort beinahe zusammengeklappt. Mit letzter Kraft habe ich mich zurück ins Bett geschleppt. Viel Wasser getrunken. Da war es schon fast ein Uhr. Geschlafen habe ich eigentlich gut, aber ich habe sehr gefroren, die Heizung ist nämlich abgestellt, seit es draußen wärmer ist. Dabei ist es bedeckt, es fällt Regen, der immer wieder in Schnee übergeht. Das passt zu meiner Stimmung. Alarmiert und kämpferisch. Auch die Werte sind auf breiter Front im Keller. Das Azeton im Urin hat zugenommen, seit zwei Tagen spüre ich es auch im Mund. Er fühlt sich extrem trocken an, obwohl ich sehr viel trinke. Obwohl mit den Infusionen Flüssigkeit zugeführt wird, zeigt die Wasserbilanz, dass ich mehr ausscheide als aufnehme. Die Entwässerung hat eingesetzt, der Körper kann das Wasser nicht mehr speichern. Das ist gefährlich für die Nieren. Den Ärzten bereitet allerdings das Herz die meisten Sorgen: Auf dem EKG sieht man, dass es unerfreuliche Entwicklungen gibt, der Herzschlag ist verlangsamt, und es gibt Herzrhythmusstörungen.
Die drei sind fast seit dem frühen Morgen da. Mein Doktor, sein Vorgesetzter aus der Verwaltung und die Kontrolltante aus Moskau. Drei Oberstleutnante mit Approbation sind mit einer einzigen Frage beschäftigt: wie sie meine Gesundheit retten können. Zum Glück versuchen sie nicht, mich zum Aufgeben zu bringen, sie wissen, dass das zwecklos ist. Der Vorgesetzte von meinem Doktor und die Kontrolltante haben sich offenbar von der Idee verabschiedet, an ihre Arbeitsplätze in der Verwaltung zurückzukehren, und bleiben hier, bis sich die Lage geklärt und stabilisiert hat. Der Doktor hat mehr Angst als ich. Ich muss ihn beruhigen und aufbauen. Seine Hände haben heute fast unmerklich gezittert. Es ist ihm anzusehen, dass ihm mein Zustand sehr nahegeht. Nicht etwa, weil er Angst hat, dass die Mortalitätsrate im Lager steigen könnte, sondern aus anderen, rein menschlichen Gründen. Es wurde ein weiteres Konzil im städtischen Krankenhaus einberufen, um die Meinungen und Ratschläge der dortigen Kollegen einzuholen. Laut Plan hätte das Konzil morgen stattfinden sollen, aber aufgrund der aktuellen Lage wurde es für heute Nachmittag anberaumt.
Jetzt stehen mir wieder Transport, Eskorte, Krankenhaus und Untersuchung bevor. Das wird natürlich anstrengend, vor allem in meinem derzeitigen Zustand, aber es muss sein, ich verstehe das, es ist keine bloße Formalität. Die freien Ärzte wollen mich vielleicht gleich dabehalten, aber ich werde mich weigern. Dazu besteht keine Veranlassung, ich vertraue ihnen weniger als den Ärzten im Gefängnis. Das klingt vielleicht komisch, ist aber so. Die da draußen wollen mich gleich zwangsernähren. Das ist sehr erniedrigend, erst kriegt man was gespritzt, damit man nicht verkrampft und keinen Widerstand leistet. Ich will auf keinen Fall wie ein willenloses Stück Gemüse mit einem Schlauch in der Nase daliegen, durch den Sondenkost fließt. Meine Ärzte vom FSVD versuchen das bislang zu verhindern, und das finde ich gut. Bislang läuft es doch, mit den Infusionen. Von jetzt an gibt’s die einfach täglich, viel und noch mit anderen Sachen.
Während die Miliz den Transport vorbereitet und die Ärzte die letzten Untersuchungsergebnisse in die Formulare eintragen, liege ich im Bett und schreibe diese Zeilen. Im Gefängnis fehlt vieles, was es draußen gibt, dafür gibt’s das, was draußen meistens fehlt – Zeit. Zeit im Überfluss. Der eine sitzt zehn Jahre, der andere zwanzig. Da ist viel Zeit zum Nachdenken. Was zum Beispiel den letzten Lebensabschnitt ausgemacht hat, was gewesen ist, was man erlebt hat, die Fehler, das Scheitern, die Verluste. Ich bin dem Schicksal dankbar für mein kompliziertes und interessantes Leben, aber ich würde das alles trotzdem nicht noch einmal durchmachen wollen. Ich bereue nichts und würde auch nichts ändern wollen. Und nicht nur, weil es nicht geht. Sondern weil es eben so kommen musste. Nichts passiert zufällig. Als ich an meinem zweiten Film – »Rhino« – gearbeitet habe, wollte ich die Gedanken des Protagonisten skizzieren, der über sein schweres Schicksal sinniert. Er dachte: »Wozu das Ganze?« Zum Ende hin findet er eine Antwort: »Nicht wozu, sondern wofür?« Jetzt bin ich selbst in dieser Situation. Und es geht auch schon aufs Ende zu. Nie war der Ausdruck »Sieg oder Tod!« für mich so konkret wie jetzt. Und nachdem Putin seinem Volk gegenüber wieder einmal offen erklärt hat, mich nicht austauschen zu wollen, ist der Sieg in weite Ferne gerückt, wohingegen sich der Tod bereits anschleicht.
Wir fuhren also in die Klinik zum zweiten medizinischen Symposium, das sich dem nunmehr kritischen Zustand des Patienten Senzow widmete. Wieder war ein buntes Gemisch, bestehend aus mehreren Natschalniki von der Miliz, allen drei leitenden Ärzten und einer ganzen Horde Fachärzten zugegen. Das Gespräch war kurz und heftig. Während sich die Ärzte meine letzten Werte und das EKG ansahen und sich austauschten, musste ich draußen in der Grünen Minna bleiben. Es waren so viele Milizionäre mitgefahren, dass für zwei kein Platz blieb und sie im Stakan sitzen mussten. Was nicht geschadet hat, dann haben sie wenigstens mal gemerkt, wie eng die Dinger sind. Nachdem wir hoch in die Aufnahme gegangen waren, konfrontierten mich die Ärzte mit den Fakten und meinen Wahlmöglichkeiten. Die Fakten waren: Mein Zustand hatte sich so rapide verschlechtert, dass reale Lebensgefahr bestand. Das Herz schlug nur noch halb so oft, wie es der Norm entsprach, und die winzige Reserve würde höchstens noch für zwei Tage reichen. Entweder würde ich also den Hungerstreik sofort beenden oder man würde mich wegen der kritischen Befunde auf die Intensivstation verlegen. Dort würde man mich ans Bett fesseln, mir einen Krampflöser spritzen und über die oberen und unteren Körperöffnungen Nährlösungen zuführen, alles andere wäre eine Frage von Stunden.
Ich weigerte mich, den Hungerstreik zu beenden. Es entspann sich ein kurzer, hitziger Dialog im Format »einer gegen alle« in Gegenwart etlicher Zuschauer. Ein Kompromissvorschlag wurde unterbreitet: Man würde mir die Substanz oral verabreichen, wenn ich mich einverstanden erklärte, was hieß, ich müsste sie schlucken und dürfte sie nicht wieder ausspucken. Die Entscheidung lag bei mir, es entstand eine Pause, alle schwiegen, die Stille sprang auf dem gekachelten Boden auf und ab wie ein Tennisball aus Plastik. Ich schaute den Ärzten ins Gesicht und begriff, dass sie es ernst meinten und ich binnen einer Stunde von zwei Schläuchen umwickelt sein würde – einen im Mund und einen im After. Ich sagte, ich würde mich der Ernährung über den Mund nicht verweigern. Alle atmeten erleichtert auf. Die Versammelten gingen auseinander. Ich unterschrieb den Verzicht auf die Einlieferung ins städtische Krankenhaus und die Einwilligung in die Aufnahme der Nährsubstanz. Als ich zur Unterschrift ansetzte, fiel ein Tropfen aus meinem Finger, der eben für die Blutentnahme angestochen wurde, aufs Papier. Damit hatte ich den Vertrag praktisch mit Blut besiegelt. Bloß gut, dass es kein Pakt mit dem Teufel war.
Im Revier gab es die erforderlichen Spezialpräparate nicht, aber der Intensivmediziner, der »nette« Doktor mit der Goldkette, mit dem ich mich das letzte Mal angelegt und mit dem ich so aneinandergeraten war, zeigte sich plötzlich von seiner generösen Seite, spendierte etwas aus seinen Vorräten und gab sogar noch ein paar Tropfpräparate dazu. Die Anspannung legte sich, schließlich unterhielten wir uns in einem normalen Ton und knurrten uns nicht mehr an. Angeblich sind alle Intensivmediziner so, sie wissen das meiste, weil sie am häufigsten mit dem Tod in Berührung kommen. Und deshalb ist das menschliche Leben für sie nichts Abstraktes, sondern etwas ganz Konkretes, mit dem sie jeden Tag zu tun haben. Deswegen hatte ich keine Wut auf ihn, außerdem war es in dem Gespräch um das Wesentliche gegangen. Er sagte schließlich, das Präparat sei keine endgültige Lösung, kein Allheilmittel, es könne die Nahrung nicht ersetzen, sei nur ein Aufschub, und wie lange ich damit durchhalten würde, sei ungewiss, denn der Organismus sei bereits sehr geschwächt. Das nächste Mal würde er mich in jedem Fall auf die Intensivstation einweisen – die er, wie sich herausstellte, leitete – und die Maßnahmen anordnen, die er für richtig hielt. Einige andere Ärzte stießen in dasselbe Horn: Wieso karrt ihr den Typen hierher zu uns, wenn er partout nicht leben will, und haltet uns von der Arbeit ab, lasst ihn hier, wir werden es ihm schon zeigen. Deswegen will ich auch nicht hierbleiben: Für die freien Ärzte bin ich ein Knacki, für die Ärzte im Knast ein Mensch. Also fahre ich lieber mit meinen Ärzten zurück nach Hause, ins Revier.
Hier rückt mir wieder die Psychologin auf die Pelle – mit ihren traurigen Augen und den üblichen Floskeln. Sie weiß, dass unsere Unterhaltungen nicht immer kurz sind, deswegen hat sie mir eine Infobroschüre über die Schädlichkeit des Hungerns dagelassen. Sie enthält Bilder über Hungernde, in der Phase 20+ ist eine Person dargestellt, die nur noch aus Schädel besteht. Heute jedenfalls tritt der Tod nicht ein, heute weicht er zurück. Jetzt geht’s erst mal zur Infusion, die sich wahrscheinlich bis in die Nacht hinziehen wird. Draußen hat der Regen aufgehört, aber die Wolken haben sich noch nicht verzogen.