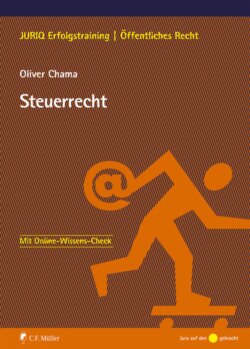Читать книгу Steuerrecht - Oliver Chama - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Grundlagen
Оглавление110
Beim einfachen Betriebsvermögensvergleich erfolgt die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 S. 1 EStG.
Demnach ist Gewinn der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen („Bestandsvergleich“).
Im Falle des qualifizierten Betriebsvermögensvergleichs nach § 5 Abs. 1 S. 1 EStG sind für die Frage, was als Betriebsvermögen anzusetzen ist und wie dieses bewertet wird, die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung („GoB“) maßgeblich (sog. Maßgeblichkeitsgrundsatz).
Hinweis
Da der einfache Betriebsvermögensvergleich kaum klausur- und praxisrelevant ist, wird im Folgenden nur noch der qualifizierte Betriebsvermögensvergleich betrachtet.
111
Aus § 4 Abs. 1 S. 1 EStG ergibt sich für den Bestandsvergleich folgende Formel:
| Gewinn = | |
| Betriebsvermögen zum Schluss des aktuellen Wirtschaftsjahrs | |
| ./. | Betriebsvermögen zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres |
| + | Entnahmen im aktuellen Wirtschaftsjahr |
| ./. | Einlagen im aktuellen Wirtschaftsjahr |
112
Achtung: einfaches Bilanzlesen!
Das Betriebsvermögen ist deckungsgleich mit dem Bilanzposten „Eigenkapital“ und lässt sich daher unmittelbar aus der Bilanz ablesen. Gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 EStG handelt es sich bei der Bilanz um eine Vermögensübersicht. Diese hat folgende Struktur:
| Aktiva | Passiva | ||
| I. | Anlagevermögen | I. | Verbindlichkeiten |
| II. | Umlaufvermögen | II. | Rückstellungen |
| III. | aktive Rechnungsabgrenzungsposten | III. | passive Rechnungsabgrenzungsposten |
| IV. | Eigenkapital | ||
| Bilanzsumme | Bilanzsumme |
113
Das Eigenkapital ist nach folgender Formel zu berechnen:
| Eigenkapital = | |
| Anlagevermögen | |
| + | Umlaufvermögen |
| + | aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
| ./. | Verbindlichkeiten |
| ./. | Rückstellungen |
| ./. | passive Rechnungsabgrenzungsposten |
114
Grundwissen Bilanzierung
Die Bilanzsumme muss auf der Aktiv- und Passivseite stets identisch sein. Für die Besteuerung kommt ihr allerdings keine eigenständige Bedeutung zu. Die Aktivseite der Bilanz drückt aus, woraus der Betrieb besteht, die Passivseite zeigt dagegen, wem der Betrieb kapitalmäßig gehört (dem Inhaber, den Banken, anderen Unternehmen, etc.)
Beispiel
Die Jahresbilanz des A sah im Jahr 2015 wie folgt aus:
| Aktiva | Passiva | ||
| I. | Anlagevermögen: 300 000 € | I. | Verbindlichkeiten: 150 000 € |
| II. | Umlaufvermögen: 100 000 € | II. | Eigenkapital: 250 000 € |
| Bilanzsumme: 400 000 € | Bilanzsumme: 400 000 € |
Im Jahr 2016 hat sein Anlagevermögen einen Wert von 250 000 €, sein Umlaufvermögen einen Wert von 60 000 € und seine Verbindlichkeiten belaufen sich auf 100 000 €.
Sein Eigenkapital beträgt demnach im Jahr 2016 noch 210 000 €. Sein Gewinn beträgt nach § 4 Abs. 1 S. 1 EStG folglich ‑ 40 000 € (= 210 000 € ./. 250 000 €).
115
Nicht jeder Vorgang wirkt sich auf das Eigenkapital aus!
Das Eigenkapital ändert sich immer nur dann, wenn es seit dem letzten Bilanzstichtag zu Aufwendungen oder Erträgen gekommen ist. Dies sind erfolgswirksame Geschäftsvorfälle, also solche, die sich nicht in einem bloßen Aktivtausch, Passivtausch oder Aktiv-Passiv-Mehrung bzw. Aktiv-Passiv-Minderung erschöpfen.
Beispiel
Wenn in obigem Beispiel A Maschinen im Wert von 50 000 € erwirbt und diese von seinem betrieblichen Bankkonto bezahlt, so ändert sich das Eigenkapital nicht. Denn auf der linken Seite der Bilanz erhöht sich zwar das Anlagevermögen um 50 000 €, das Umlaufvermögen reduziert sich aber entsprechend (bloßer Aktivtausch). Wenn A einen Kredit in Höhe von 100 000 € aufnimmt, und er damit einen anderen Kredit ablöst, liegt ein bloßer Passivtausch vor, da auf der Passivseite der Bilanz eine bloße Umschichtung stattfindet. Wenn A nun eine Maschine für 10 000 € anschafft und diese über einen Kredit finanziert, so liegt eine Aktiv-Passiv-Mehrung vor, da sich das Anlagevermögen um 10 000 € erhöht, zugleich aber auch die Verbindlichkeiten um denselben Betrag ansteigen.