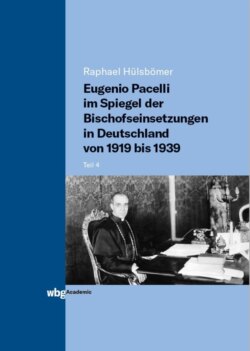Читать книгу Eugenio Pacelli im Spiegel der Bischofseinsetzungen in Deutschland von 1919 bis 1939 - Raphael Hülsbömer - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sondierungen der Nachfolge Löbmanns durch das Dresdener Konsistorium und König Friedrich August
ОглавлениеDer Nuntius folgte beiden Vorschlägen des Breslauer Kardinals. Bereits am folgenden Tag sandte er das dem Entwurf Bertrams genau entsprechende Telegramm an das Bautzener Domkapitel24 und schrieb nach Breslau, in der nächsten Woche Zeit für Pater Watzl zu haben.25 Aus Bautzen meldete sich am 11. Dezember Kapitelssenior Skala zurück und versicherte Pacelli, ebenfalls der Ansicht zu sein, dass noch „wichtige Fragen“26 geklärt werden müssten, bevor zur Wahl des Nachfolgers Löbmanns geschritten werden könne. Um den reibungslosen Ablauf der kirchlichen Verwaltung in der Interimszeit zu gewährleisten, wurde Skala vom Kapitel zum Administrator gewählt.27
Auch in Dresden machte man sich Gedanken, in welcher Form die kirchlichen Strukturen Sachsens weiterbestehen könnten. Auf einer Sitzung am 21. Dezember verabschiedeten die Mitglieder des geistlichen Konsistoriums ein Fünf-Punkte-Papier, das sie einen Tag später dem Nuntius unterbreiteten.28 Ihrer Ansicht nach sollten beide Jurisdiktionsbezirke in ihrer Selbständigkeit mit dem einen gemeinsamen Ordinarius erhalten bleiben. Sie fürchteten offenbar, dass eine neu errichtete Diözese Meißen ihren Sitz in Bautzen haben werde, was das Ende ihrer Stellung in Dresden bedeuten würde. Der Nachfolger Löbmanns sollte außerdem dem erbländischen Klerus entstammen und damit also von deutscher Nationalität sein. Die Unterzeichneten fragten Pacelli, ob es ihnen erlaubt sei, konkrete Besetzungsvorschläge zu machen. Bislang konnte das Dresdener Konsistorium in keiner Weise auf die Besetzung des Vikariats Einfluss nehmen, aus seiner Sicht ein Manko, das nun behoben werden sollte. Es glaubte nämlich, dass eine Neuregelung des Besetzungsmodus bevorstand, da das Propositionsrecht des früheren Königs seiner Meinung nach nicht der neuen Regierung zuzusprechen war. Für den Fall, dass die Ernennung des neuen Vikars in irgendeiner Form von der sogenannten Hofpartei beeinflusst würde, ergäbe sich für den electus ein sehr schwieriger Stand – dies hatte Bertram schon ähnlich diagnostiziert. Allerdings wiesen die Konsistorialräte auch daraufhin, dass die Regierung dem Apostolischen Vikar noch das Gehalt bezahlte und daher offenbar nicht gänzlich umgangen werden konnte. Im letzten Punkt ihres Schreibens versicherten sie dem Heiligen Stuhl unbedingten Gehorsam, welche Regelung dieser auch treffen werde.
Pacelli vertröstete das Konsistorium ein paar Tage später mit dem Hinweis, dass die Frage der Neubesetzung „in Anbetracht der gegenwärtigen Verhältnisse reifliche Erwägung und Überlegung“29 verlange. Unterdessen hatte er mit Pater Watzl zwei längere Besprechungen über die kirchliche Lage Sachsens geführt, wie er am Weihnachtsfest an den Breslauer Kardinal schrieb.30 Der Redemptorist werde eine ausführliche Denkschrift erarbeiten, für die auch das Dresdener Papier nützlich sein könnte. Deshalb sollte Bertram, den Pacelli damit als Vermittler einsetzte, das Dokument streng vertraulich an Watzl weiterreichen.31
Die Frage der Wiederbesetzung beschäftigte auch den ehemaligen König Friedrich August III., der in Sibyllenort im Exil lebte. Am Heiligabend 1920 legte er dem Nuntius brieflich seine Ansichten dar.32 Auf den Plan, die Diözese Meißen wiederherzustellen, war er bereits im September 1919 in einem Gespräch mit Bischof Löbmann aufmerksam gemacht worden. Schon damals befürwortete er dieses Vorhaben, verlangte „jedoch noch mehr Klarheit über die Ausübung seiner königlichen Rechte“33. Noch kurz vor seinem Brief an Pacelli hatte der König auch mit Pater Watzl gesprochen. Dieser war mit dem Ergebnis freilich in keiner Weise zufrieden gewesen, da Friedrich August seinen ehemaligen Einfluss, zumindest auf inoffiziellem Weg, unbedingt weiterhin geltend machen wollte.34 Dies versuchte er nun auch gegenüber dem Nuntius. Gerade nach der Revolution hielt er eine Neuerrichtung des Bistums Meißen für noch nötiger als vorher, weil mit dem Königtum die „Hauptstütze der Kirche“35 in Sachsen weggebrochen sei. Zudem sei es politisch und kirchlich am dienlichsten, wenn der neue Oberhirte durch das Kapitel gewählt und anschließend vom Papst zum Apostolischen Vikar ernannt werde. Dies entsprach der bisherigen Regelung. Dabei sollte die strukturelle Neuordnung der sächsischen Kirche erst nach der Bestellung des neuen Vikars betrieben werden, insofern dieser besser als die Übergangsverwaltung geeignet sei, die Lage mit der Kurie zu klären.
Das Kapitel wünsche dagegen eine umgekehrte Vorgehensweise: Ein Bistum Meißen mit dem Sitz in Bautzen, vom Kapitel gegründet, „würde diesem eine überwältigende Stellung im Lande verschaffen“36. Friedrich August hielt das für eine dramatische Entwicklung, da die Domkapitulare die politische Lage völlig verkennen würden: „Eine religionsfeindliche Regierung, die sich über die klaren Bestimmungen der Reichsverfassung wegsetzt, erstrebt die völlige Trennung von Staat und Kirche, die völlige Verdrängung von Kirche und Religion aus der Schule und ein Knebelgesetz der schlimmsten Sorte für die Diener aller Religionen.“37 Der König spielte hier auf ein Gesetz der Regierung an, das die Konfessionsschulen aufhob und den Religionsunterricht aus den Volksschulen verbannte, freilich nur von April bis November 1920 in Kraft war.38 Darüber hinaus plante sie für das kommende Jahr ein Gesetz der vollständigen Trennung beider Gewalten, wovon Pacelli bereits im Mai durch den damaligen Vikar Löbmann erfahren hatte.39 In einer Besprechung mit Skala habe er – so Friedrich August weiter – diese prekäre politische Situation im Denken des Kapitelsseniors nicht berücksichtigt gefunden.
Dazu kam für den König, dass der erstarkte Nationalismus der Wenden, der in seiner Orientierung auf die Tschechoslowakei zeige und „selbst vor hochverräterischen Gedanken nicht zurückschreckte“40, von manchen Kreisen der Geistlichen sympathisch beäugt werde. Nur weil der Bischof ein Deutscher gewesen sei, sei der Konflikt der Nationalitäten nicht innerhalb der Kirche entbrannt. Das Bautzener Kapitel sei hingegen wendisch geprägt und wenn Skala, der ein „Verfechter des wendischen Vorrechts“ genannt werden müsse, der Nachfolger Löbmanns werde, ändere sich die Situation grundlegend.41 Die im Prager Priesterseminar ohnehin schon prädisponierten Alumnen würden unter seiner Leitung für die sächsische Kirche gefährlich werden.42 Ganz abgesehen davon, dass es nicht angemessen sei, wenn 280.000 deutsche Katholiken und nur 20.000 Wenden43 von einem wendischen Oberhirten geführt würden, sei mit der Konsequenz zu rechnen, dass dieser alle wichtigen Ämter mit Landsleuten besetzen würde. Ein deutscher Bischof könne zugleich erheblich besser mit der Regierung verkehren. Räume man jedoch, wie Friedrich August in Anlehnung an einen von Kardinal Bertram vorgelegten Modus erklärte,44 dem Bautzener Kapitel das Recht ein, im Einvernehmen mit der Kurie eine Kandidatenliste – etwa eine Terna – anzufertigen, aus der es dann den neuen Oberhirten wähle, dann würde das sorbisch dominierte Bautzener Kapitel in diesem Fall zwei Wenden und einen gänzlich unwählbaren Deutschen vorschlagen und „damit mit dem Schein des Rechtes einem Wenden die bischöfliche Würde übertragen“45. Stattdessen präferierte er eine Wahl durch ein Gremium, das aus sechs Deutschen und vier Wenden bestehen sollte.
Genau wie gegenüber der Geistlichkeit aus Dresden bedankte sich Pacelli am 27. Dezember bei seiner Majestät für die gegebenen Informationen, an denen er die Spannungen zwischen Deutschen und Sorben in Sachsen augenfällig studieren konnte und verwies wiederum auf die „reifliche Erwägung und eingehende Überlegung“46, mit denen man der Angelegenheit begegnen müsse. Es gab für Friedrich August also keine Chance zu erfahren, welchen Eindruck seine Ausführungen auf den päpstlichen Gesandten gemacht hatten.