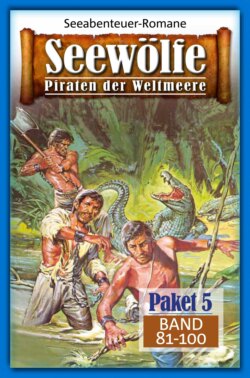Читать книгу Seewölfe Paket 5 - Roy Palmer - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеMontanellis Atem ging keuchend. In seinem Hirn arbeitete es unablässig, und hin und wieder durchlief ein Zucken seinen ausgemergelten Körper.
Er suchte nach einer Möglichkeit, etwas zu seiner Rettung zu tun. Aber er war zu schwach, um sich ganz aufzurichten, zu schwach, mit den Händen zu paddeln, allemal zu schwach, sich irgendein Stück Treibholz aus dem Strom zu fischen, das er als Ruder benutzen konnte.
Was blieb? Er konnte nur beten, daß sich das Reetboot in der Mitte des Flusses hielt und nicht zum südlichen Ufer trieb.
Er stöhnte. Es wirbelte vor seinen Augen und dröhnte in seinen Ohren, und er drohte wieder besinnungslos zu werden. Mit aller Macht seines Geistes zwang er sich dazu, das Bewußtsein zu behalten. Er verwandte das letzte bißchen Kraft, das ihm verblieben war, auf dieses Bestreben.
Und es gelang ihm. Er wurde nicht ohnmächtig. Für Montanelli war dies ein gewaltiges Erfolgserlebnis. Er verspürte etwas innerlichen Auftrieb, einen Schimmer in weiter Ferne, an den er sich klammerte.
Plötzlich lief ein Ruck durch sein Gefährt. Es drehte ab und schoß davon, als sei es von einem Katapult oder einer Bogensehne abgefeuert worden. Montanelli wußte genau, was das bedeutete. Er war in einen jener trügerischen, manchmal gefährlichen, manchmal harmlosen Strudel geraten, und dieser hatte seinem Boot einen neuen Kurs gegeben.
Ängstlich hielt er sich fest. Seine Finger umspannten noch immer die beiden Beutel aus Rohleder. Wenn er sie bewegte, erklang ein hartes, metallisches Schaben aus dem Inneren der Beutel.
Montanelli wußte nicht, wohin das kleine, wacklige Boot glitt. Unter unsäglichen Qualen hob er sich auf die Ellenbogen und warf einen Blick über die Kante des Flechtwerkes. Er wimmerte vor Entsetzen auf.
Der Strudel hatte ihm mit einem Schlag genau die Richtung gegeben, die er um jeden Preis meiden wollte. In schräger Linie lief das Reetboot auf das Südufer des Amazonas zu, und es würde – wenn nicht ein Wunder geschah – im spitzen Winkel darauftreffen.
Montanelli warf sich hin und her, aber das Boot schwankte nur ein wenig. Sonst geschah nichts. Er spielte mit dem wahnwitzigen Gedanken, sich in den Strom zu werfen und sein Leben dem Getier preiszugeben. Aber er verwarf den selbstmörderischen Plan genauso schnell, wie er ihn gefaßt hatte. Immer noch hing er an seinem erbärmlichen Dasein, ganz gleich, was geschah.
Die tausend Stimmen, die unvergleichliche Musik des Regenwaldes – sie erschienen ihm jetzt wie ein Hohngelächter.
Er betete und fluchte, jammerte und stöhnte, aber es nutzte ihm nichts, das Boot behielt seinen unglücklichen Kurs bei. Montanelli lag wieder auf dem Rücken. Er schloß die Augen, wollte nichts mehr sehen und an nichts mehr denken, doch es gelang ihm nicht.
Ein neuerlicher Blick über den Bootsrand ließ ihn zusammenfahren. Der Busch war jetzt nicht mehr weit entfernt. Höchstens noch zehn, fünfzehn Yards trennten ihn von dem grünen, verdammungswürdigen Vorhang. Und inmitten dieser Wand erschienen wieder die beiden braunen Leiber, die ernsten Gesichter, die ohne Gefühl auf ihn blickten.
„Nein“, stieß Montanelli aus. „Bitte – nein …“
O, er kannte sie und wußte, daß er von ihnen keine Gnade erwarten durfte. Von ihnen zu allerletzt! Sie waren stämmige, muskulöse Männer, nackt bis auf einen Lendenschurz, und sie trugen die Trophäe des Infernos auf dem Haupt: ein offenes Kaiman-Maul, dessen Oberkiefer auf dem Haar lastete und dessen Unterkiefer unter der Kinnpartie festgebunden war.
Boote hatten sie nicht, daß wußte Montanelli auch ganz genau. Sie durften sie nicht besitzen. Darum hatte er seine ganze Hoffnung in die Aussicht gelegt, von dem Strom davongetragen zu werden.
Die beiden Indianer waren Späher. Wer wußte, wie lange sie ihn schon beobachteten? Wahrscheinlich waren sie ihm über eine beachtliche Distanz am Ufer gefolgt. Das war in diesem Dickicht kein leichtes Unterfangen. Wenn Montanelli noch etwas Positives an ihnen fand, so war es das erstaunliche Geschick, mit dem sie sich im Urwald voranbewegten.
Er wußte, was kam.
Er hielt sich platt auf den Boden des Reetbootes gedrückt, regte sich nicht und schob die beiden Rohlederbeutel in einer fast instinktiven Handlung noch unter seinen mageren Leib.
Er gab sich keine Blöße und hütete sich, den Kopf auch nur anzuheben. Aber dann befand er sich dicht am Ufer und unter den überhängenden Ästen und Baumkronen, in denen Schlangen hausen oder noch größere Tiere auf ihre Opfer lauern konnten.
Die schlimmste Spezies von allen hatte es auf Montanelli abgesehen, die Spezies Mensch. Schon erblickte er die sehnige Gestalt, die sich geschmeidig über einen mächtigen Ast schob. Sie erreichte seinen vordersten Ausläufer, als das Boot sich fast direkt unter ihr befand.
Der Ast wippte bedrohlich. Montanelli glaubte, der Indianer würde sich in das Boot fallen lassen, aber in diesem Punkt hatte er sich getäuscht.
Der Indianer setzte nur ein langes Blasrohr an und zielte auf ihn. Montanelli öffnete den Mund. Aber seiner Kehle entrang sich kein richtiger Schrei, sondern nur ein entsetzliches Krächzen.
Es gab keinen Laut, als der Pfeil das Blasrohr verließ und seine schnurgerade Bahn auf den Mann im Reetboot zog. Montanelli fühlte den Einschlag, zuckte zusammen, bäumte sich auf – und dann konnte er doch schreien.
In seinem Kopf pulsierte es dröhnend, er verlor die Kontrolle über seine Gliedmaßen. Hilflos mußte er mitverfolgen, wie der Schütze den Baum wieder verließ, wie der zweite Indianer ein mit Widerhaken bewehrtes Seil warf. Die Haken krallten sich sofort in dem Reetboot fest.
Die Indianer gaben dumpfe, gutturale Laute von sich und zogen das Gefährt ganz ans Ufer heran. Montanelli konnte sich nicht mehr bewegen, aber er konnte noch sehen und denken.
Das Boot stach mit seinem Bug mitten in das feuchte Dickicht. Ein winziger Seitenarm des großen Stromes öffnete sich. Er lag sonst völlig versteckt unter dem wuchernden Pflanzenwuchs, kein Uneingeweihter konnte ihn jemals entdecken. Nur die Indianer, die Krokodilmänner, wußten, daß er sich an dieser Stelle befand.
Sie liefen am Ufer entlang und zerrten das Reetboot an der Schleppleine mit. Montanelli begriff, daß sie ihn nicht sofort töten, sondern erst zu ihrem Herrn bringen wollten.
Er war gelähmt und konnte nicht einmal mehr in das brackige, verseuchte Wasser rutschen.
Dort, wo das Ziel seiner Gegner lag, erwartete ihn noch weitaus Grausameres, das wußte er. Er hatte aufgehört, sich irgendwelchen Illusionen hinzugeben.
„Land!“
Natürlich war es wieder Dan O’Flynn, der den graugrünen Streifen über der südwestlichen Kimm als erster sichtete. Er hatte die besten Augen der „Isabella“-Crew, deswegen saß er auch meistens als Ausguck hoch oben im Großmars.
Hasard begab sich auf Dans Ruf hin auf die Back. Er zog das Spektiv auseinander, blickte hindurch und betrachtete mit gemischten Gefühlen, was sich da vor ihnen ausbreitete.
Land. Ein Gürtel, der sich dem Vernehmen nach so lang wie ganz Europa durch die Neue Welt erstreckte, der nur zu einem winzigen Teil erforscht war und voller Gefahren steckte.
Voll Skepsis blickte Hasard auch auf das braungelbe Wasser, in dem sie nun schon seit zwei Stunden dahinrauschten. Das war kein Seewasser mehr, das waren bereits die lehmigen Fluten des Amazonas.
Die meisten Männer befanden sich in seiner Nähe. Neugierig reckten sie die Hälse und schauten voraus.
Hasard drehte sich zu ihnen um. „Erstaunlich, wie weit der Amazonas sein Wasser ins Meer hinausdrückt, nicht wahr?“
„Wir haben ablaufendes Wasser“, stellte Smoky nüchtern fest. „Damit hängt es bestimmt zusammen.“
„Ja, Aber was geschieht, wenn die Flut kommt?“
„Keine Ahnung.“
„Dann befördert der Atlantik diese braune Brühe in die Mündung zurück oder?“ sagte der Seewolf.
Smoky schob seine Mütze ein Stück zurück und kratzte sich die Stirn. „Tja, eigentlich müßte es so sein.“
„Aber dann preßt Strömung gegen Strömung“, gab Hasard zu bedenken.
„Wie in allen Flußmündungen der Welt“, sagte Big Old Shane. „Ich weiß nicht, wieso wir uns damit groß befassen sollen. Wir suchen uns Proviant und Süßwasser, verstauen das Zeug und hauen wieder ab.“
„Wenn das so einfach wäre“, erwiderte Bill.
„Ho“, stieß Shane lachend hervor. „Was weißt du denn schon, du Naseweis?“
„Genausoviel wie du, du Bär“, sagte Bill forsch. „Ganz so dämlich, wie ihr alle denkt, bin ich nämlich nicht.“
„Aber noch feucht hinter den Löffeln“, meinte Carberry.
Während sie sich zankten, dachte Hasard über das Phänomen des braunen Wassers nach. Gewiß hatte Smoky mit seinen Bemerkungen recht, aber Shane unterbewertete das Ganze. Denn hier, am gewaltigen „Amacunu“, dem „Wasserwolkenlärm“, wie die Indianer ihn nannten, war alles gigantischer als anderswo. Hier konnte ein simples Naturschauspiel zur Katastrophe gedeihen.
Hasard sann nicht weiter darüber nach.
Er kehrte auf das Achterdeck zurück, befaßte sich mit seinen Karten und stellte fest, daß sie sich als erstes einer großen Insel im Delta nähern mußten, die die Portugiesen „Ilha Curua“ getauft hatten.
Der Tag näherte sich seinem Ende, aber die Luft kühlte nur allmählich ab. Im Osten war der Himmel indigoblau gefärbt. Im Westen hatte er noch die kräftige Tönung, die er am Morgen und am Mittag gezeigt hatte, und es schien fast, als wolle sich der Feuerball der Sonne mitten in die grüne Hölle betten.
Keine Stunde später war es soweit. Die „Isabella“ und der schwarze Segler stießen in das Mündungsgebiet des legendären, gemiedenen und gehaßten Stromes vor. Die lehmbraunen Fluten drückten jetzt mit aller Macht gegen die Schiffsrümpfe an, aber immer noch wehte der Nordostwind. Er half ihnen über den kritischsten Punkt zwischen der Ilha Curua und der Ilha Janaucu hinweg und beförderte sie in einen langgestreckten, von grünen Barrieren gesäumten Wasserarm.
„Das ist der Canal do Norte“, sagte Hasard. Er befand sich inzwischen wieder auf der Back, und zwar ganz vorn an der Schmuckbalustrade.
Smoky lag vorn unter ihm auf dem Bauch und lotete die Tiefe aus. „Ein erstaunlicher Kanal, Hasard. Ich messe immer noch zehn Faden.“
„Das ist mehr, als ich dachte“, entgegnete der Seewolf. „Wirklich beachtlich.“
„Solange wir nicht auf eine Sandbank laufen!“
„Mann, Smoky!“ rief Al Conroy. „Mal jetzt bloß nicht den Teufel an die Wand.“
An Steuerbord war eine Bewegung. Hasard und seine Freunde wandten den Blick dorthin, und auch von Bord des schwarzen Schiffes, das sich nun dicht hinter der Galeone befand, hielt man interessiert Ausschau.
Al Conroys Ruf schien die Landschaft wachgerüttelt zu haben. Aus dem grünen, menschenabweisenden Gürtel aus Bäumen und Schmarotzerpflanzen schienen sich mehrere flachliegende Stämme gelöst zu haben. Erst bei genauerem Hinsehen entpuppten sie sich als die scheußlichen, gefürchteten Riesenechsen, die schon so manchen abgebrühten Beachcomber in Angst und Schrekken versetzt hatten: Kaimane.
Sie glitten ein Stück auf die „Isabella“ und den Viermaster zu, blinzelten tückisch, wagten sich aber nicht weiter heran. Gelassen schwammen sie eine Strecke mit den Schiffen, ohne etwas Bedenkliches zu unternehmen. Dann verloren sie das Interesse und zogen sich wieder ans Ufer zurück.
Bill schauderte mit einem Mal unwillkürlich zusammen. Er griff in einer Instinkt-Reaktion nach dem Arm des Mannes, der ihm am nächsten stand. Es war Shane.
„He, was ist denn, Junge?“ sagte Shane.
„Sieh doch – da!“
Shane folgte der Richtung, die Bills Finger wies, mit den Augen. Dann konnte auch er sich dieses Gefühls nicht erwehren: Das war, als rieselten viele winzige Eisnägel über sein Rückgrat.
Ein dicker Leib wand sich vom Ufer aus ins Wasser, brachte die Fluten ein wenig in Wallung und war gleich darauf verschwunden. Es war ein gescheckter Leib, der keinerlei Ähnlichkeit mit dem der Krokodile hatte.
„Herrgott, was war denn das bloß?“ sagte Shane. Er war wütend über sich selbst.
Hasard stand neben ihm. Er sagte nur ein Wort: „Anakonda.“
„Die Wasserschlange?“
„Ja, Shane. Von Hutten, der die Biester zur Genüge kennt, hat sie mir mehrmals beschrieben. Sie sollen bis zu fünfzehn Yards lang werden.“
„Verdammt, ich wußte nicht, daß es einem bei der Hitze kalt werden kann“, erwiderte Shane finster.
„Smoky!“ rief Hasard.
„Neuneinhalb Faden, Sir.“
„Gut. Weiter also.“
Smoky lag weiterhin auf der Galionsplattform und versah seine Aufgabe mit Akribie. Achtern auf dem schwarzen Segler wäre ein Ausloten der Wassertiefe eigentlich nicht nötig gewesen, aber Siri-Tong hatte trotzdem den Befehl dazu gegeben. Eike, einer der Wikinger, ruhte in der gleichen Lage wie Smoky auf dem vordersten Bereich der Galion.
Hasard geriet immer mehr ins Staunen. Der Canal do Norte ließ sich tief ins Landesinnere hinein befahren – viel weiter, als er in seinen kühnsten Vorstellungen anzunehmen gewagt hätte.
„Wir müssen eine Art Fahrrinne gefunden haben“, sagte er zu Ben Brighton. „Eine natürliche Vertiefung, die uns problemloses Fahren und Manövrieren erlaubt.“
„Hoffentlich bleibt es auch so.“
Hasard sah ihn eindringlich an. „Nicht unken, Ben!“
„Tu ich doch auch nicht.“
„Mir ist noch etwas eingefallen, Ben.“
„Daß wir hier alle elendig verrekken können?“
Hasard mußte lachen. Er schüttelte den Kopf. „Lassen wir das mal weg. Hör zu, von Hutten kennt dieses Land besser als alle anderen Freibeuter. Er hat mir seinerzeit mal gesagt – dessen entsinne ich mich jetzt wieder –, daß im Februar hoch oben in den Bergen bereits die Regenzeit einsetzt. Dort entspringen die Flüsse den Felsen, die sich später zum Amazonas vereinen. Jedenfalls sagen das die Indianer, obwohl man die genauen Quellen des großen Stromes nicht kennt.“
„Wir wollen sie doch wohl nicht entdecken, oder?“ fragte Ben mit griesgrämiger Miene.
„Unsinn. Ich will auf etwas anderes hinaus. Der Fluß führt jetzt viel Wasser und ist wahrscheinlich noch auf viele Meilen hinaus befahrbar – selbst für Schiffe dieser Größe.“
„Meinst du denn, daß wir soweit vordringen müssen?“
„Hat dir schon mal jemand gesagt, daß du der geborene Schwarzseher bist, Mister Brighton?“
„Ich bin nur für Vorsicht. Und mir gefällt dieser vertrackte Fluß nicht.“
Hasard schnitt eine Grimasse. „Mir auch nicht. Das allererste, was wir tun müssen, ist, nach einer Trinkwasserquelle Ausschau zu halten. Daß wir dem Strom kein Wasser entnehmen können, ist dir ja wohl klar, oder?“
Ben schielte argwöhnisch in die trüben Fluten. „Sonnenklar.“
„Smoky!“ rief der Seewolf noch einmal.
„Immer noch neuneinhalb Faden, Sir.“
Hasard drehte sich zu den Männern auf der Back um. „Wir stoßen noch ein Stück weiter vor, bis wir die Inseln hinter uns haben. Auf dem Festland finden wir leichter eine Quelle, die für unsere Zwecke geeignet ist.“
„Und dann gehen wir auf die Jagd, oder?“ sagte Al Conroy. „Ich habe schon sämtliche Waffen bereit. Ich glaube, Batuti könnte uns die brauchbarsten Ratschläge geben, was wir erlegen können und was nicht.“
Der riesige Gambia-Neger verdrehte die Augen. „Batuti ist nicht sicher. Tiere hier anders als in Afrika.“
„Wir werden sehen“, sagte Hasard. „Hoffentlich können wir noch etwas ausrichten, bevor es dunkel wird.“
In diesem Augenblick peitschte drüben auf dem schwarzen Schiff ein Schuß auf. Die Köpfe der Seewölfe zuckten herum. Sie konnten die weiße Qualmwolke sehen, die vom Backbordschanzkleid hochpuffte, und sie bemerkten auch die kleine Fontäne, die dicht am Südufer aus dem Wasser hochstob. Gleichzeitig krümmte sich ein langer, grünlich-brauner Leib im Strom. Einer der Kaimane war getroffen worden. Seine Artgenossen schoben sich heran, nicht aus Mitgefühl, sondern, weil sie ihn zu vertilgen gedachten.
Der empörte Schrei der Roten Korsarin drang zu den Männern der „Isabella“ herüber. Sie entriß dem Schützen die Muskete und verpaßte ihm eine Maulschelle. Was sie dabei rief, war bis zur „Isabella“ hin zu verstehen.
„Du Vollidiot! Wer hat dir den Befehl zum Schießen gegeben?“
„Niemand“, erwiderte der Mann. Er war einer der Neuen von Tobago. „Ich wollte diesen widerlichen Biestern nur zeigen, mit wem sie’s zu tun haben.“
„Narr!“ fauchte Siri-Tong. „Noch so ein Vorfall, und ich lasse dich auspeitschen.“
Der Mann verstand sicherlich nicht, warum sie so aufgebracht war. Hasard schaute zu seinen Männern und wußte, daß sie das gleiche dachten wie er. Die Erfahrung lehrte: Es konnte immer nur falsch sein, unbedacht und aufs Geratewohl Lärm zu veranstalten.