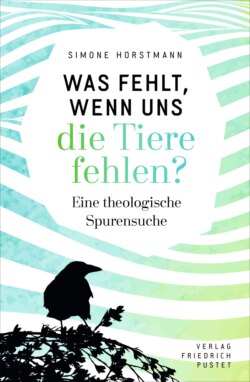Читать книгу Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? - Simone Horstmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zum Stellenwert von (Tier-)Erfahrungen
ОглавлениеDies kann aber nur gelingen, wenn unsere Erfahrungen mit anderen Tieren einen anderen Stellenwert einnehmen, als dies bislang zumeist der Fall ist. Eben darauf hatte ja bereits die so verbreitete Metapher der Windschutzscheibe hingewiesen: Der von ihr bildlich zum Ausdruck gebrachten Trennung zwischen den Menschen und den anderen Tieren entspricht auch eine grundlegende Erfahrungsskepsis, die unser Selbstverständnis als moderne Menschen prägt. Daher lässt sich einerseits auch bezweifeln, dass eine Untersuchung des Mensch-Tier-Verhältnisses gültige Ergebnisse produzieren kann, sofern sie mit der vordarwinschen Trennungslogik einer fundamentalen Differenz zwischen Tieren und Menschen eine Grundbedingung als unhinterfragbar voraussetzt, die historisch offenkundig kontingent ist. Andererseits ist die Einsicht in die uns prägende Erfahrungsskepsis auch deswegen wichtig, weil wir tagtäglich Erfahrungen mit anderen Tieren machen (könnten), denen wir nicht selten eine existentielle Bedeutung zuschreiben, dann aber schnell vor dem vermeintlichen Dilemma stehen, dass wir diesen Erfahrungen gleichzeitig zutiefst misstrauen. Und schon gar nicht gelten diese Erfahrungen als wissenschaftsfähig – wer heute über die Erfahrung etwa der Freundschaft mit Tieren sprechen will, dem empfiehlt die traditionelle Wissenschaft womöglich, dies doch besser an anderer Stelle zu tun. Einzig im privaten Rahmen gestehen wir uns diese Erfahrungen zu, und die etablierten Sprecherpositionen unserer Gesellschaft ermutigen ganz in diesem Sinne dazu, Erfahrungen wie diese besser auf anderen Kanälen zu verbreiten: Man solle dann besser ein Bild malen oder ein Gedicht verfassen, um einer Tier-Erfahrung Ausdruck zu verleihen; für wissenschaftliche Belange scheinen sich diese Erfahrungen hingegen immer schon disqualifiziert zu haben.
Für unser Verhältnis zu den anderen Tieren ist diese Strategie der Veruneigentlichung der Erfahrungen höchst bedenklich. Denn auch der wissenschaftliche Blick bedarf zur Erfassung von Subjekten einer dezidiert subjektiven Perspektive! Damit wird nicht zuletzt der Tatsache Rechnung getragen, dass Menschen kein „zuschauerhaftes Verhältnis zur Wirklichkeit“ (Th. W. Adorno) haben, sondern sich zumeist als Teilnehmende und Mitagierende einer gemeinsamen Lebenswelt verstehen, in der immer auch Tiere vorkommen. Damit Tiere auch zukünftig darin vorkommen können, ist es womöglich entscheidend, nicht allein quantifizierbare Daten in die aktuell so gern geführten Nachhaltigkeitsdebatten einzuspeisen, sondern das qualitative Bedeutungswissen von Menschen in ihren Beziehungen zu anderen Lebewesen auch wissenschaftlich zu rehabilitieren. Aus eben diesem Grund changiert dieses Buch beständig zwischen einer Verortung seiner Frage innerhalb der verschiedenen wissenschaftlichen Diskurse einerseits und einer erfahrungsbezogenen, mitunter erzählerischen und essayistischen Form. Diese ungewohnte Herangehensweise soll den fälschlichen Schluss vermeiden, dass wir die ökologischen Gefährdungen dieser Tage nicht nur als den Anlass, sondern als den Grund einer Neubestimmung des Mensch-Tier-Verhältnisses verstehen. Die bloße Feststellung, dass (andere) Tiere bedroht sind, genügt noch nicht, um zu begründen, warum eine solche Neubestimmung notwendig ist. Vielmehr brauchen wir ein Argument, das verdeutlichen kann, was genau mit dieser Bedrohung auf dem Spiel steht. Was also fehlt, wenn (uns) die Tiere fehlen?