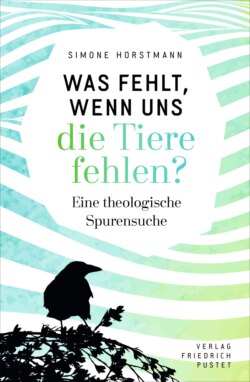Читать книгу Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? - Simone Horstmann - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Bedrohung durch den Anderen schlechthin
ОглавлениеEs gibt in dieser Diskussion eine interessante Parallele in der Theologie: Dies liegt schon deswegen nahe, weil ja gerade die zweite Schöpfungserzählung der Bibel und damit verbunden die Erzählung vom sog. Sündenfall gleichermaßen als Verhältnisbestimmung zwischen einem Ich und einem Du gelesen werden kann. Auch wenn der Begriff der Sünde im biblischen Text selbst gar nicht vorkommt, erwächst das dort geschilderte Böse aus einem grundlegenden Misstrauen vor dem jeweils anderen und führt in der Konsequenz zur Verfeindung von Mensch und Mitmensch, Mensch und Tier, Mensch und Gott.
Entscheidender dürfte aber noch ein weiterer Aspekt sein: Insbesondere die moderne Theologie hat darauf hingewiesen, dass auch Gott selbst zu häufig als der Andere gedacht und von Theologie und Kirche verkündet wurde. Selbst die eigentlich trinitarisch verfasste Theologie des Christentums hat sich häufig genug dualistisch geriert und die Gegensatzpaare von Schöpfer und Schöpfung, Gott und Mensch, Himmel und Erde, Natur und Gnade usf. zur Strukturierung ihrer Theoriegebäude aufgegriffen. Sie schienen geeignet, das erste Gebot zu wahren – keine anderen Götter zu verehren, das bedeutet schließlich auch: Nichts Weltliches darf vergöttlicht werden, die Grenze zwischen den Gegensätzen muss möglichst klar bleiben. Der bedrohliche Gegensatz von Ich und Du, Eigenem und Fremdem liegt gleichermaßen darin. Romano Guardini, sicher einer der weisesten Theologen des 20. Jahrhunderts, hat eindringlich vor der Gefahr einer solchen Theologie gewarnt: Sie besteht darin, dass Gott in diesem Denken als der Andere schlechthin begriffen wird. Diese denkerische Grundlegung führt dazu, dass der Mensch zu Recht aufbegehrt:
„Mein Selbst kann nicht unter der Gewalt des Anderen stehen, auch nicht, wenn dieser Andere Gott ist. […] Und zwar nicht deshalb, weil meine Person vollkommen wäre und darum die andere nicht über sich ertrüge, sondern gerade weil sie das nicht ist. Gerade weil mein Selbst nicht wirklich und sicher in sich steht, wird ihm die Anwesenheitswucht des Anderen gefährlich. […] Dann kommt das Gefühl: Er oder ich! […] Daraus kommt der ‚postulatorische Atheismus‘: Wenn ich sein soll, kann er nicht sein.“16
Guardini sieht etwas sehr Wichtiges: Eine bestimmte Art, Gott zu denken, führt paradoxerweise zur Unmöglichkeit, Gott angemessen zu denken – der Theismus kippt in sein Gegenteil, den Atheismus. Etwas ganz Analoges erleben wir heute, wenn wir versuchen zu verstehen, wie wir bislang über Lebendigkeit, über lebendige Wesen nachgedacht haben. Die Tatsache, dass wir selbst heute noch von anderen Lebewesen als Objekten denken, im wörtlichen Sinne also als Wesen, die uns gegenübergestellt sind, bezeugt doch, dass auch wir immer noch der Fundamentalopposition von Ich und Du anhängen. Nahezu alle natur- und tierphilosophischen Ansätze der nächsten Jahre werden sich die Frage stellen müssen, welche Alternativen es zu jener radikalen Gegenüberstellung von Ich und Du geben kann, wenn ihnen daran gelegen ist, den Dauerkriegszustand zwischen den lebendigen Wesen zu beenden. Für die Theologie und die Gottesfrage vermerkt Guardini: „Gott ist nicht ‚der Andere‘, sondern Gott“, und er ergänzt: „Daran, dass das erkannt wird, hängt die Erkenntnis der Schöpfung und das Selbstverständnis des Menschen.“17 Das Kernproblem des Theismus kennzeichnet Guardini hier also dadurch, dass Gott als der Andere des Menschen erscheint bzw. so ausgelegt wird. Guardini betont deswegen:
„Von jedem Wesen sonst gilt der Satz: Es ist nicht ich, also ein Anderes. Von Gott gilt dieser Satz nicht; und eben dass er nicht gilt, drückt Gottes Wesen aus. In dem Verhältnis, von dem wir sprachen, wird Gott ein Anderer gemacht, der größte von allen: der Andere schlechthin. Ist er das, dann muss der Mensch den schrecklichen Kampf der Befreiung gegen ihn aufnehmen, und Nietzsche hätte recht. Gott ist aber nicht der andere, deshalb, weil er Gott ist. Als Gott steht er dem Geschöpf so gegenüber, dass die Kategorie des Anderer-Seins auf ihn ebenso wenig angewendet werden kann wie die des Gleicher-Seins.“18
Wohlgemerkt, Guardini nimmt die anderen Wesen, also auch die Tiere, von seiner zentralen Erkenntnis aus. Gerade hier liegt die bislang weitestgehend unerschlossene terra incognita einer Tierphilosophie: Sind denn die anderen Wesen wirklich, wie Guardini sagt, die ganz Anderen – denen folgerichtig nur im Modus der Furcht bzw. des Kampfes zu begegnen wäre?