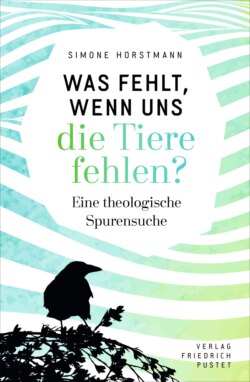Читать книгу Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? - Simone Horstmann - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„… die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht“
ОглавлениеAber welche Hölle wäre eine Welt, die sich mit dem Sterben arrangiert hat! Die industriellen Tiertötungsmaschinerien der Moderne zeugen jeden Tag davon. Als mahnendes Beispiel verraten sie weniger etwas über die Tiere, die hier milliardenfach einen unbeachteten Tod finden, vergast und aufgeschlitzt werden, als etwas über den Menschen, der zu derartigen Grausamkeiten fähig ist: Der Mensch nämlich, so schreiben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in der „Dialektik der Aufklärung“ (1944), „bekundet, indem er sich am Tier vergeht, dass er, und nur er in der ganzen Schöpfung, freiwillig so mechanisch, blind und automatisch funktioniert, wie die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht.“21
Das 20. und 21. Jahrhundert sind traumatisiert von der monströsen Wiederkunft des Conrad’schen Kurtz, den eine rein instrumentelle Vernunft leitet, die inhaltlich vollkommen entkernt und wertfrei ist. Wer nichts im Anderen erkennen kann oder will, erkennt in ihm schnell jenes Nichts im Herzen der Finsternis. Mit der Beobachtung, dass dieses Erkennen dialektisch, gewissermaßen spiegelbildlich funktioniert, haben Adorno und Horkheimer etwas Entscheidendes gesehen. Denn die Erkenntnis des Nichts im Anderen geht nur allzu oft Hand in Hand mit dem Wirksamwerden dieses Nichts im Eigenen. So ließe sich auch die kurze Passage aus der „Dialektik der Aufklärung“ lesen: Das, was der Mensch im Tier zu erkennen meint, hier also die scheinbare tierliche Unfreiheit und Determiniertheit, ist eine Form der gleichwohl schmerzhaften, und daher verdrängten Selbsterkenntnis: So macht sich der Mensch zur freiwilligen Maschine. Die Tragik dieser Beziehung zwischen Mensch und Tier, zwischen dem Eigenen und dem Fremden, hat der bulgarisch-stämmige Literaturwissenschaftler Tzvetan Todorov in unnachahmlicher Weise auf den Punkt gebracht:
„Wer keinerlei Ähnlichkeit zwischen sich und den anderen erkennt, wer nur das fremde Böse, aber nicht das eigene sieht, der ist (tragischerweise) dazu verurteilt, seinen Feind zu imitieren. Wer hingegen das Böse auch in sich selbst zu erkennen vermag und folglich merkt, dass er dem Feind ähnlich ist, gerade der unterscheidet sich wirklich von ihm.“22
Eigenes und Fremdes, Leben und Sterben, Mensch und Tier, sie alle können als Phänomene niemals im Sinne einer zweiwertigen Logik gegeneinander ausgespielt werden. Sie gehorchen vielmehr dem Axiom des analogen Denkens: Ihre Ähnlichkeit und ihre gleichzeitige Unähnlichkeit wachsen im gleichen Maß miteinander. Dies zu denken ist für unser dualistisches Weltverständnis in der Tat eine Herausforderung: Je mehr Fremdes, desto mehr Eigenes; je näher das Andere mir ist, desto ferner ist es mir. Je ferner es ist, desto näher ist es mir zugleich.23