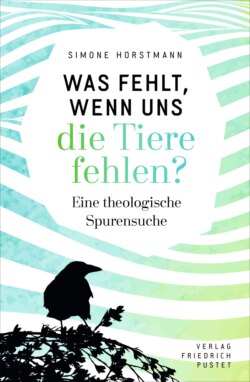Читать книгу Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? - Simone Horstmann - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Statt Todeswirrnis – Reinlichkeit und Ordnung“
ОглавлениеAllen Einflüsterungen über das bloße Verenden der Tiere zum Trotz gibt es in unserer Erfahrung eben doch immer wieder diesen Blick toter Tiere, ihren bloßen Anblick. Eine urtümliche Erschütterung, die wir nur zu gern von uns abschütteln würden – denn der Blick sterbender Tiere vermag uns zu berühren, an allen abstrakt-rationalen Erwägungen vorbei trifft er uns doch immer wieder ganz unvermittelt. Die polnische Schriftstellerin Wisława Szymborska hat diesem Anblick toter Tiere in ihrem Gedicht „Von oben betrachtet“ poetisch Ausdruck verliehen.3 Auch ihr Blick als Dichterin ist also zunächst ein Blick von oben, aber doch nicht jener abstrakt-distanzierte Blick eines Martin Heidegger. „Ein toter Käfer liegt auf dem Feldweg“ heißt es in Szymborskas Gedicht zunächst ganz abgeklärt und sachlich, die Beinchen des Käfers liegen sorgfältig, fast noch heile und scheinbar intakt „über dem Bauch gekreuzt“. Und doch: Es ist gerade dieser Anschein von Ordnung, der das Grauen des Todes überhaupt erst in seiner Tiefe zugänglich macht. „Die Trauer teilt sich nicht mit“, wendet das lyrische Ich zunächst noch gegen dieses erste Erschrecken ein, ihre Reichweite sei lediglich „streng lokal von der Quecke zur Minze“, gerade weil der Tod des Tieres derart ordentlich anmutet: „Statt Todeswirrnis – Reinlichkeit und Ordnung.“ Dann erkennt das lyrische Ich aber doch, dass dieses scheinbar gezähmte Grauen, das die Ordnung des tierlichen Todes anzudeuten scheint, dem säuberlich trennenden Denken des Menschen entspringt: Die Tiere
„[…] krepieren sozusagen den seichteren Tod, / verlieren – wir wollen es glauben – weniger Welt und Fühlen, / verlassen – so will uns scheinen – eine weniger tragische Bühne.“
Und nur kurz darauf heißt es dann von dem toten Käfer: „Er liegt, als wäre ihm nichts von Bedeutung passiert.“ Diesem Mantra eines bedeutungslosen Sterbens und Verschwindens der Tiere folgt unsere Gesellschaft bis heute. Mögen Darwin und mit ihm die neueren Evolutionstheorien die Grenze zwischen den Arten noch so sehr eingeebnet haben, spätestens wenn es ans Sterben geht, zelebrieren wir bis heute die doppelte Metaphysik eines bedeutungslosen, weil tierlichen Todes auf der einen und den metaphysischen Staatsakt menschlichen Sterbens auf der anderen Seite. Inwieweit sich durch die zunehmenden Möglichkeiten und Formen von Tierbestattungen eine Trendwende abzeichnet, bleibt abzuwarten.
Es ist daher aufschlussreich, die Gründe für die Instandsetzung und die jahrhundertelange, penible Wartung dieser fundamentalen Grenze zu suchen, über die keine Brücke zu führen scheint. Was genau schützt eine solche Sprachnorm, die den Menschen das Sterben exklusiv zuspricht und damit zugleich andeutet, dass dieses Sterben besonders, womöglich nicht endgültig sei? Wenn es umgekehrt betrachtet stimmen sollte, dass Tiere sterben (und eben nicht „verenden“), dann definieren sich beide Begriffe nahezu gegenseitig. Am sterbenden Tier lernt der moderne Mensch eine der schmerzlichsten Lektionen des Lebens, vor der ihn die Rede vom Verenden der Tiere nach Möglichkeit zu bewahren sucht: Tiere sterben – und was stirbt, ist – so der unaussprechbare Verdacht – vielleicht auch ein Tier? Das Eigenleben der Begriffe, die eine solche Conclusio ermöglichen, rührt an die tiefsten Ebenen des menschlichen Bewusstseins und präsentiert eine schiere Ungeheuerlichkeit: Mit den Tieren sterben immer auch die Menschen. Selbst wir fühlen im Angesicht sterbender Tiere jenes urtümliche Erschrecken: Blickt uns aus den Winkeln der Tieraugen etwa das Nichts an? Erkennt der menschliche Blick in den sterbenden Tieren jenen Mangel an Sein, eine Spur jenes Nichts, aus dem doch letztlich beide hervorgerufen wurden?
Grund zu einer kritiklosen Naturemphase gibt es wahrlich nicht; der Anblick toter oder sterbender Tiere dürfte die schnellste Kur gegen derart blumige Naturromantizismen sein. Schönheit und Schrecken gehen in dem, was wir „Natur“ nennen, ineinander über. Unsere Wahrnehmung kippt mitunter von einer Sekunde auf die nächste, und was zuvor schön und erhaben schien, gibt sich sogleich als urtümliches Grauen einer alles zermalmenden Wirklichkeit zu erkennen. Oft lassen sich beide Eindrücke aber auch gar nicht voneinander trennen, wie jeder weiß, der nur einmal aufmerksam einen Strand abgeschritten ist. Die sandigen Küstenabschnitte, die so erhaben auf uns wirken, sind doch immer auch die zertretenen Grabstätten von unzähligen Muscheln, deren Kalkhüllen sich hier mit den Gesteinsstückchen feinsten Sandes mischen. Es wäre zumindest nicht falsch zu behaupten, dass jene Küstenstreifen unüberschaubaren Friedhofsarealen gleichen. Ergriffenheit und Erschütterung gehen Hand in Hand in der Erfahrung dessen, was wir landläufig Natur nennen; in ihr scheint die Ambivalenz von Sterben und Lebendigkeit zutiefst verwoben zu sein. In unserer Erfahrung mit den Tieren scheint sich diese irritierende Erfahrung bis ins Unerträgliche zuzuspitzen.