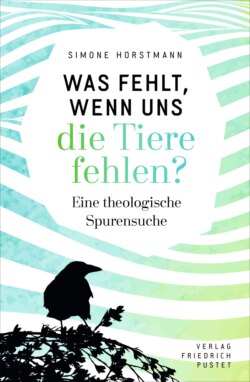Читать книгу Was fehlt, wenn uns die Tiere fehlen? - Simone Horstmann - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eine säkulare Zwei-Naturen-Lehre
ОглавлениеIn der Schilderung Reinhold Schneiders umschließt den Menschen eine Membran wie aus Glas – sie sondert ihn von der restlichen Natur ab und verhindert zugleich den Übertritt in die unergründlichen Tiefen der Wildnis, von denen bei Conrad die Rede war. Sie trennt und schützt zugleich von und vor der Natur, oder genauer: Sie zeichnet die Konturen eines säkularen Pendants zur „Zwei-Naturen-Lehre“: Die Natur der außermenschlichen Natur ist hier eine gänzlich andere als die menschliche Natur, beide Naturen existieren, ähnlich wie es ein frühchristliches Bekenntnis in Bezug auf die göttliche und die menschliche Natur Jesu Christi formuliert, „unvermischt“ und „unveränderlich“. Das frühchristliche Dogma spricht neben diesen beiden Verhältnisbestimmungen aber auch davon, dass die beiden Naturen Jesu Christi zugleich „ungetrennt“ und „unteilbar“ seien – dies gilt hinsichtlich einer säkularen Lesart der menschlichen und außermenschlichen Natur wohl lediglich aus Sicht jener umfassenden Totalität, von der Schneider ebenfalls spricht. Der Blick der menschlichen auf die außermenschliche Natur fördert bisweilen etwas zutage, was ihr grundsätzlich nicht entspricht: Die außermenschliche Natur ist schön, aber sie ist eiskalt. Je näher wir ihr kommen, desto weiter entfernt sie sich, und wir bleiben als Einsame, als Verzweifelte angesichts einer gleichermaßen schönen wie unerbittlichen Wirklichkeit zurück. Bewunderung und Schreckstarre verbinden sich in unserem Blick auf die Natur. Auch im Angesicht der Tiere mag uns diese seltsame Anmutung befallen. An anderer Stelle heißt es daher bei Schneider:
„Die Bewunderung der Zweckmäßigkeit, mit der ein Tier zur Vernichtung des anderen ausgestattet ist, der Bienenwolf zum Verderb der Bienen, die Wasserspinne zum Fischfang, der Ameisenbär für die Ameisen, grenzt an Verzweiflung.“13
Dem Menschen bleibt scheinbar nur, die hermetische Einheit der Natur zu betrachten, und mitunter durchzieht ein Anflug von wehmütiger Sehnsucht, aber auch von bodenloser Verzweiflung diesen Blick. Er gilt einem Ort, der dem Menschen verschlossen ist, weil diese Natur ihm vollkommen äußerlich zu bleiben scheint. Diese Trennung dürfte wohl am deutlichsten auch den Unterschied zur frühchristlichen Lehre von den „Zwei Naturen“ darstellen. Der Antike schien es immerhin denkmöglich, eine Person mit zwei Naturen – unvermischt, ungetrennt, unteilbar und unveränderlich – zu denken. Heute tendieren wir dazu – und der Anblick der Tiere dürfte diesen Eindruck am stärksten heraufbeschwören –, andere, außermenschliche Naturen als Bedrohung und als Sehnsucht zugleich wahrzunehmen. So ist der Glaspanzer, den Reinhold Schneider als Bild für unser Naturverhältnis entwirft, gleichermaßen Schutz der eigenen Natur wie Eingeständnis eines leisen Bedauerns und Anlass zu der Frage, wie es wohl wäre, wenn die eigene und die fremde Natur doch nicht durch jenen Glaspanzer getrennt wären. Ein solcher Panzer aus Glas markiert also eine zweite Option neben der Vernichtung der Figur des Kurtz durch jene so andere, sinnentleerte Natur in Conrads Roman: das Einverständnis in eine fundamental (zwei-)geteilte Welt. Man lasse sich nicht täuschen: Auch sie produziert Angst, wenngleich in der schwächeren Form der von Schneider genannten Ehrfurcht.
Zwei Möglichkeiten sind uns damit begegnet, wie der Mensch auf das Erlebnis einer grundlegend fremden Natur zu reagieren vermag. Schneiders literarische Option für eine geteilte Wirklichkeit dürfte im Alltag wahrscheinlich nur selten über den Status einer erkenntnistheoretischen Perspektive hinausgekommen sein. Wer sich aufmerksam umschaut, entdeckt aber gerade im alltäglichen menschlichen Umgang mit den Tieren, dass Conrads geheimnisvoller Agent Kurtz allgegenwärtig zu sein scheint.