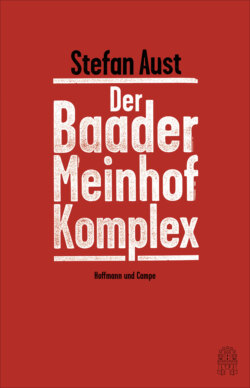Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 10
7. Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt
ОглавлениеDie Ortschaft Bartholomä liegt am Ostrand der Schwäbischen Alb, zwischen Heidenheim, Schwäbisch-Gmünd und Geislingen. Das Dorf gehörte einmal zu den Pappenheimern, wurde im Dreißigjährigen Krieg verwüstet und danach neu besiedelt. In der Dorfchronik ist zu lesen, dass damals »Fahrende aller Art, Heimatlose und Vagabunden – Württemberger, Sachsen, Ungarn, Spanier, Kroaten« – das menschliche Strandgut aller Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts – gegen einen Gulden Einstandsgeld sesshaft gemacht wurden.
Das evangelische Bartholomä, benannt nach der lutherischen Dorfkirche, wurde wieder katholisch. Bartholomä hat etwa 2000 Einwohner, zwei Drittel davon sind katholisch. Die CDU erringt regelmäßig die absolute Mehrheit.
Neben der Kirche steht ein 200 Jahre altes, verwohntes Pfarrhaus mit Garten. Von 1937 bis 1948 lebte hier die Familie des evangelischen Pfarrers Helmut EnsslinEnsslin, Helmut und seiner Frau IlseEnsslin, Ilse. Die Familie hatte sieben Kinder. Gudrun, das vierte Kind, wurde 1940 geboren.
Pfarrer Ensslin zog sich in seiner freien Zeit oft zum Malen zurück. Die Mutter galt als starke Persönlichkeit mit einen Hang zur Mystik. Im Pfarrhaus las man in den fünfziger Jahren das linke Kirchenblatt »Stimme der Gemeinde«, herausgegeben von Martin NiemöllerNiemöller, Martin, in dem zum Ausgleich mit Moskau aufgerufen, Adenauers Westpolitik angegriffen und gegen die WiederbewaffnungWiederbewaffnung polemisiert wurde.
Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt besuchte in Tuttlingen das Gymnasium und folgte dem Beispiel ihrer Eltern, die in ihrer Jugend der Wandervogelbewegung angehört hatten. Sie ging mit dem Evangelischen Mädchenwerk auf Fahrt, wurde bald Gruppenführerin und leitete die Bibelarbeit.
Auf ihrem Nachttisch lag die Zeitschrift »Rüste für den Tag« des Evangelischen Mädchenwerks. Sie las darin bis zu ihrem 22. Lebensjahr.
Als Pfarrer Helmut EnsslinEnsslin, Helmut sich zur Jahreswende 1958/59 an die Lutherkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt versetzen ließ, ging Gudrun für ein Jahr als Austauschschülerin in die USA. Sie lebte in einer Methodistengemeinde in Pennsylvania. Die Amerikaner mochten sie, waren noch Jahre später von ihr begeistert. Gudrun galt als klug, sozial engagiert, sprachgewandt, weltoffen und hübsch. Sie selbst sah die Neue Welt mit kritisch-puritanischen Augen. Im Tagebuch notierte sie ihren Widerspruch zum amerikanischen Christentum, wo Kirchenbesucher, in eleganter Kleidung und mit Brillanten behängt, den sonntäglichen Gottesdienst zur Modenschau machten.
Im Elternhaus hatte sie gelernt, dass Christentum nicht an der Kirchentür aufhört, sondern politisches und soziales Handeln einschließt. Sie war erschrocken über die politische Naivität ihrer amerikanischen Umwelt in der Ära EisenhowerEisenhower, Dwight D..
Zurück vom Schüleraustausch, bereitete sich Gudrun auf das Abitur vor. Die Lehrerinnen des Gymnasiums für Mädchen behielten sie als begabte und aufgeschlossene Schülerin in Erinnerung.
1960 begann sie in Tübingen mit dem Studium der Germanistik, Anglistik und Pädagogik.
1962 fragte sie bei einem der Wochenendbesuche ihren Vater: »Sag mal, kennst du einen Schriftsteller Vesper?«
Pfarrer Ensslin kannte den Dichter Will VesperVesper, Will, der Verse geschrieben hatte wie diesen:
»Noch ziehen die kalten Nebel schwer,
doch kamen schon Vögel vom Süden her
und wohnten im Walde und singen schon
in leise verhaltenem Ton.«
Und Vater EnssliEnsslin, Helmutn, der Kriegsgegner und AntifaschAntifaschismusist, erinnerte sich auch an ein Gedicht von Vesper, geschrieben, als die Hitlerarmee Polen überfallen hatte:
»August 1939
Mein Führer, in jeder Stunde
weiß Deutschland, was du trägst,
dass du im Herzensgrunde
für uns die schwere Schlacht des Schicksals schlägst.
In deiner Hand ohn’ Zagen
fühl unsre Hand!
Nun wag, was du musst wagen,
wozu dich Gott gesandt!«
Gudrun hatte in Tübingen einen jungen Germanistikstudenten kennengelernt: Bernward VesperVesper, Bernward, den Sohn des Blut-und-Boden-Dichters. Der hasste seinen Nazi-Vater und gab gleichzeitig ausgewählte Werke von ihm heraus. Gudrun und Bernward machten eine erste gemeinsame Reise nach Spanien.
Nach ihrer Rückkehr erschien die Tochter dem Pfarrer EnsslinEnsslin, Helmut »stark erotisiert«, und als Gudrun ihren neuen Freund im heimischen Pfarrhaus vorstellte und er noch mehrmals auftauchte, setzte ihn der Vater jedes Mal »wegen des Kuppeleiparagraphen« vor die Tür.
Die Verlobung versöhnte die Familie. Man feierte im Kurhaus von Bad Cannstatt.
Die Verlobten schmiedeten Zukunftspläne. Sie wollten zusammen einen Verlag gründen. Um weiterstudieren zu können, bemühte Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt sich, in die »Studienstiftung des Deutschen Volkes«Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen zu werden.
In ihrem Lebenslauf schrieb sie: »Mein Berufsziel ist es, Lehrerin an einer höheren Schule zu werden. Dieser Wunsch ist seit dem 13. Lebensjahr in mir lebendig; nur die Gründe dafür haben sich vertieft … Die Zeit in den USA hatte drei Schwerpunkte: Schule, Familie, Kirche … Ich persönlich bin in der amerikanischen Schule aufgewacht … wo ich meine Fächer selbst wählen sollte. Zwar sind einem zu frühem Spezialistentum Tür und Tor geöffnet, aber einen ›fruchtbaren Moment‹ darf und will ich nicht übersehen. Schwerer wiegt sicherlich dagegen die Tatsache, dass junge Menschen eine leitende, zwingende Hand hinter sich spüren wollen und müssen, um nicht nur das zu tun, was sie gern tun, sondern um auch etwas zu tun, dessen Sinn erst viele Jahre später offenbar wird.«
Für die Hochbegabtenförderung wurde Gudrun zunächst nicht zugelassen. Sie legte erst einmal die Prüfung für das Lehramt an Volksschulen ab. Durchschnittsnote »befriedigend«. Beurteilung der Lehrfähigkeit: »ausreichend«.
Kurz darauf, 1963, gründeten Bernward VesperVesper, Bernward und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt den Kleinverlag »Studio für neue Literatur«. Ein erstes Buch erschien: »Gegen den Tod. Stimmen deutscher Schriftsteller gegen die Atombombe«. Gudrun hatte mit Autoren wie Horst BingelBingel, Horst, Max BrodBrod, Max, Hans Magnus EnzensbergerEnzensberger, Hans Magnus, Stephan HermlinHermlin, Stephan, Anna SeghersSeghers, Anna, Erich FriedFried, Erich und vielen anderen korrespondiert und um Originalbeiträge für die Anthologie gebeten.
Aus einem Beitrag von Rudolf RolfsRolfs, Rudolf: »Man könnte, angefangen bei der Korruption über die Lüge bis zum Betrug, eine lange Liste jener Dinge aufzählen, die heute für ›relativ normal‹ gehalten werden, da sollte man sich nicht scheuen, als PazifisPazifismust für ›irre‹ gehalten zu werden. ›Normal‹ ist Egoismus! ›Normal‹ sind Geschäftemacherei, Rücksichtslosigkeit und Selbstherrlichkeit. Deshalb gibt es kein größeres Kompliment, als in diesem Reigen für ›irre‹ gehalten zu werden!«
In dem Beitrag von Günther AndersAnders, Günther war Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt besonders von den Sätzen fasziniert: »Die geschriene Wahrheit ist wahrhaftiger als die Wahrheit, die nicht ankommt. Der verzweifelte Frevel tugendhafter als die Tugend, die niemals verzweifelt!«
Doch neben dem Interesse an fortschrittlicher Literatur hatte das Pärchen auch einen Sinn für Tradition. In seinem Buch »Die Reise«, das erst nach seinem Tod erschien, schrieb Bernward VesperVesper, Bernward: »Meine Geschichte zerfällt deutlich in zwei Teile. Der eine ist an meinen Vater gebunden, der andere beginnt mit seinem Tod. Als er starb, flüsterte ich ihm noch den Namen Gudrun ins Ohr, die ich gerade kennengelernt hatte. Sterbeszene. Ich saß acht Tage an seinem Bett und heulte.«
1963 planten Gudrun und Bernward, eine siebenbändige Werkausgabe mit den Novellen des rechten Vaters herauszugeben. Unter dem Briefkopf »gudrun ensslin, 7 stuttgart-cannstatt, wiesbadener str. 76« findet sich im Nachlass Vespers ein auf den 11. September datiertes zweiseitiges Manuskript mit dem Titel »Liebe, Traum und Tod. Zum ersten Band der Gesamtausgabe der Will-VesperVesper, Will-Werke. – Eine Aufgabe für das nationale Deutschland«. Die Herausgeber wollten einen Verfemten, der »mit vielen seiner Zeitgenossen das Schicksal des Vergessenwerdens« teilen musste, einer neuen Generation zugänglich machen.
Es war der Herbst der »Spiegel-Affäre«Spiegel-Affäre, als Tausende gegen die Übergriffe des AdenauerAdenauer, Konrad-Staates und gegen Franz Josef StraußStrauß, Franz Josef auf die Straße gingen. Auch Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt und Bernward Vesper waren unter den Demonstranten. Der NPD-nahe »Deutsche Studentenanzeiger« nannte die ProtestProtestbewegunge »vom Osten gesteuerte, landesverräterische Umtriebe«, was Bernward VesperVesper, Bernward zu einem Protestbrief an das Blatt veranlasste. Als der »mit Rücksicht auf den hochverehrten Will VesperVesper, Will« nicht gedruckt werden sollte, schrieb Gudrun am 28. Dezember einen Brief an den zuständigen Redakteur, in dem sie die Haltung des Nazi-Dichters mit der protestierender Studenten verglich: »Im Hinblick auf den persönlichen Mut, den Will VesperVesper, Will zeit seines Lebens gezeigt hat (allen Denkschemata zum Trotz), lässt sich immer wieder nur eines tun: individuell das Gewissen entscheiden lassen.« Genau darum seien jetzt auch »Abertausende Studenten einen endlos schweigenden Protestmarsch mitgegangen … allein aus der Überzeugung, dass Kräfte und Methoden, wie sie in unserem Staat gegen Individuen angewandt wurden, nur durch persönliches Bekenntnis beantwortet und bekämpft werden können«.
Als Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt nach einem zweiten Anlauf das Stipendium der StudienstiftungStudienstiftung des Deutschen Volkes erhielt, zog sie mit ihrem Verlobten nach Westberlin und schrieb sich an der Freien UniversitätFreie Universität Berlin ein.
Schon bald nach ihrer Ankunft arbeiteten beide im »Wahlkontor der Schriftsteller« für den Sieg der SPDSPD bei der anstehenden Wahl zum Bundestag 1965.
Ein knappes Jahr später kam die Ernüchterung. Bundeskanzler ErhardErhard, Ludwig trat zurück, die Große Koalition wurde gebildet. Plötzlich saßen BrandtBrandt, Willy und SchillerSchiller, Karl, für die sie sich engagiert hatten, neben den politischen Gegnern von gestern, KiesingerKiesinger, Kurt Georg und StraußStrauß, Franz Josef, auf der Regierungsbank. »Wir mussten erleben«, sagte Gudrun später, »dass die Führer der SPDSPD selbst Gefangene des Systems waren, die politische Rücksichten nehmen mussten auf die wirtschaftlichen und außerparlamentarischen Mächte im Hintergrund.«
Gudrun gewann Abstand zum festgefügten, strengen und sittsamen Pfarrhaushalt in Bad Cannstatt, wo auf Familiengemeinschaft geachtet wurde, wo sich Kinder und Eltern am Abend in »heiterer Singekreisatmosphäre« trafen, wie es Gudruns Schwager später einmal formulierte.
Die Beziehung Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnts zu Bernward VesperVesper, Bernward war offenbar eine ähnlich tödliche Umklammerung wie die später zu Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt. In Vespers Notizbüchern ist die Rede von seinem »sado-masochistischen Verhältnis zu Gudrun«.
Nach der gemeinsamen Spanienreise schrieb Gudrun ein literarisch verschlüsseltes Tagebuch »Isabella und ich«. Darin kommt BernwardVesper, Bernward über sie: »Wolf, der das Lamm zerbricht, abhäutet, tötet, das helle Blut trinkt.« Sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihn »noch immer nicht genug liebt«, dass sie »unfähig zur Selbstaufgabe« ist. Sie bettelt um »eine letzte Chance« – bis Wolf sich ihrer wieder erbarmt und ihren »Schoß erbricht« und sie eine Liebe lehrt, »so groß, bis das kleine Heupferd nicht mehr zu klein ist. Alles tut für dich. Auch töten.«
Zehn Jahre später, 1972, wurde aus den sado-masochistischen Phantasien blutige Wirklichkeit.
Sie waren eingetaucht in das Leben der revoltierenden StudentenStudentenbewegung – nicht anders als viele, für die die antiautoritäre Bewegung der sechziger Jahre gleichbedeutend war mit Befreiung – politischer und persönlicher.
Es scheint, als sei das, was später geschah, nicht zu verstehen, ohne einen Blick auf den protestantischen Hintergrund zu werfen. Der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Pfarrer Heinrich AlbertzAlbertz, Heinrich, sagte mir später in einem Interview, es sei »eine der höchst gefährlichen Nebenerscheinungen des evangelischen Pfarrhauses, dass dort solche Menschen wachsen. Das kann was ganz Großartiges werden, das Böse kann ja auch großartig sein, oder das Großartige böse. Und die kommen dann auf die irrsinnigsten Ideen und glauben, dass sie mit Gewalt in einem Lande, in dem es noch nie eine Revolution gegeben hat und wahrscheinlich auch nie eine geben wird, etwas ändern können.«