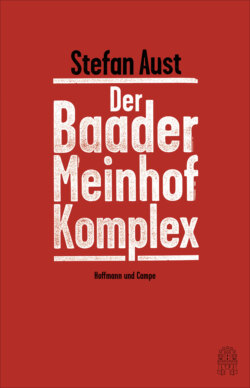Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 21
18. Die Brandstiftung oder: Es führt kein Weg zurück
ОглавлениеInzwischen hatte sich Baader, wie ein ehemaliges Kommunemitglied später sagte, zu einer »nicht unangenehmen Randfigur« der Szene gemausert. Anfang März 1968 begann vor dem Landgericht Moabit die Fortsetzung des im Juli 1967 unterbrochenen Prozesses gegen die Kommunarden Rainer LanghansLanghans, Rainer und Fritz TeufelTeufel, Fritz wegen ihres Flugblattes, mit dem sie angeblich zur Brandstiftung in Warenhäusern aufgerufen hätten.
Das Verfahren fand unter höchster Aufmerksamkeit der Medien statt, die nicht ohne Sympathie über die schrägen Kommunarden, die sich hier vor Gericht erklären sollten, schrieben. Vor allem Fritz TeufelTeufel, Fritz, der im Gerichtssaal Seifenblasen steigen ließ, entzückte viele. Als der Richter ihn aufforderte, sich zu erheben, antwortete TeufelTeufel, Fritz: »Wenn es der Wahrheitsfindung dient …« Der Satz wurde zum geflügelten Wort der sechziger Jahre.
Drei Tage nach Prozessbeginn, am 6. März, zündete im obersten Stockwerk des Kriminalgerichtes ein in eine Aktentasche verpackter Molotowcocktail. Er war mit Taschenlampenbatterien und Glühzünder ausgestattet, so wie einen Monat später Brandsätze in zwei Frankfurter KaufhäusernKaufhausbrandstiftung. Es gab eine kurze Stichflamme, der Sachschaden war gering.
Schon im Frühherbst des vorangegangenen Jahres hatte der Kommunarde Ulrich EnzensbergerEnzensberger, Hans Magnus in der Wohnung von Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt und Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt in der Badenschen Straße auf einem Tisch Drähte, Isolierband und eine Kombizange gesehen, doch niemand schöpfte Verdacht, dass Baader den Molotowcocktail ins Gericht gelegt haben könnte.
Im Prozess hatte sich LanghansLanghans, Rainer beim Richter erkundigt: »Darf ich fragen, wie Sie überhaupt zu der Auffassung kommen, dass das eine Aufforderung zur Brandstiftung sein soll?«
»Was soll das heißen?«, fragte der Richter.
»Das heißt, dass wir Leute, die sich zur Brandstiftung aufgefordert fühlen, nur für blöd halten können – und da hat sich das Gericht ja sehr hervorgetan.«
Lachen bei den Zuschauern.
LanghansLanghans, Rainer erklärte, wie der Gedanke, das Flugblatt zu entwerfen, entstanden war: »An dem Morgen haben wir die Zeitung geholt, da waren die schrecklichen Bilder drin von dem Warenhausbrand in BrüsselWarenhausbrand in Brüssel. Großartige Bilder für den, der sie gemacht hat. Und dann kamen die Hinweise, es könnte Brandstiftung dahinterstecken. Und das war dann die Idee. Wir haben uns gefragt, wie man das konkretisieren könnte. Dazu haben wir das erst mal durchgespielt.«
»Durchgespielt?«, fragte der Richter. »Wie man ein Kaufhaus in Brand setzt?« LanghansLanghans, Rainer kam ins Stottern: »Natürlich … natürlich nicht. Sondern wie man den Leuten klarmachen könnte, welche Zusammenhänge da bestehen. Wir haben das dann geschrieben und vervielfältigt.«
Der Richter stellte fest: »Geschrieben haben Sie: Dieses knisternde Vietnamgefühl, das wir in Berlin bislang noch vermissen mussten – das ist doch ein Wunsch?«
LanghansLanghans, Rainer machte einen Rückzieher: »Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, hier ist doch die Sprache der Werbung parodiert worden. Wir haben versucht, die Dinge in Form von Fiktionen zu schildern, in einer persiflierenden Sprache.«
»Wir Älteren haben noch brennende Häuser erlebt«, sagte der Richter.
»Sie haben es aber vergessen«, erwiderte der Kommunarde.
Der Beisitzer mischte sich ein: »Sie behaupten, die Flugblätter sind nicht ernst gemeint. Wollen Sie bitte sagen, wo der Scherz beginnt?«
Am 22. März 1968 wurden die Angeklagten Fritz TeufelTeufel, Fritz und Rainer LanghansLanghans, Rainer auf Kosten der Staatskasse freigesprochenKaufhausbrandstifter-Prozeß. Zwar hätten die Angeklagten den objektiven Tatbestand der – erfolglosen – Aufforderung zu strafbaren Handlungen erfüllt, es sei ihnen aber nicht nachzuweisen, dass sie dieses auch gewollt hätten.
Das Flugblatt, mit dem die Kommunarden zur WarenhausbrandstiftungWarenhausbrandstiftung, Aufruf zur aufgerufen hatten, wurde als Satire gewertet. Es fand literarische und praktische Nachahmer.
Thorwald ProllProll, Thorwald, Sohn eines Architekten, Student in Berlin, schrieb ein Gedicht in sein Tagebuch, das später vom Frankfurter Gericht als Beleg für die »Vorstellungswelt des Angeklagten« zitiert wurde:
»Wann brennt das Brandenburger Tor?
Wann brennen die
Berliner Kaufhäuser
Wann brennen die Hamburger Speicher
Wann fällt der Bamberger Reiter
Wann pfeifen die
Ulmer Spatzen
auf dem letzten Loch
Wann röten sich die Münchner
Oktoberwiesen …«
Proll hatte sich mit Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt und Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt angefreundet. In der Woche, in der TeufelTeufel, Fritz und LanghansLanghans, Rainer freigesprochen wurden, besuchten sie die »Kommune I«Kommune I und kündigten den Schritt von der Theorie zur Praxis an.
Baaders Vorschlag, mit dem KaDeWe in der Tauentzienstraße zu beginnen, wurde sogar von Dieter KunzelmannKunzelmann, Dieter abgelehnt. Angeblich sagte er: »Wenn ihr das hier macht, gehe ich zur Polizei.« Auch Baaders Exfreundin ElloM., Ellinor MM., Ellinor. war strikt gegen eine Brandstiftung in Westberlin. So beschlossen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Thorwald Proll, nach Westdeutschland zu fahren, um in dortigen Kaufhäusern zu zündeln.
Sie fragten auch, ob irgendjemand mitmachen wolle. Keiner hatte Lust, bis auf Bommi BaumannBaumann, Michael Bommi. Ihm passte die Sache nur nicht in den Terminkalender.
Proll, Ensslin und Baader reisten also allein und fuhren zunächst nach München, um dort einen alten Freund Baaders zu besuchen, Horst SöhnleinSöhnlein, Horst, der damals das »Action-Theater« leitete. Zu viert setzten sie sich in einen geliehenen Volkswagen und fuhren Richtung Norden. Im Gepäck lagen mehrere Brandsätze, gebastelt aus Plastikflaschen und Benzin, Reisewecker plus Taschenlampenbatterie und Glühzünder, eingebettet in selbstgemischten Sprengstoff. Das Ganze umwickelt mit Tesafilm und Tesakrepp.
In Stuttgart-Bad Cannstatt machten sie kurz Station in Gudruns Elternhaus.
Am Dienstag, dem 2. April 1968, kamen sie gegen 5.30 Uhr in Frankfurt an. Müde machten sie sich auf die Suche nach einer Unterkunft.
Am Nachmittag bummelten sie gemeinsam durch das Stadtzentrum und besichtigten einige Kaufhäuser in der Nähe der Hauptgeschäftsstraße, der Zeil. Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt fuhren im »Kaufhaus Schneider«Kaufhaus Schneider mit der Rolltreppe zur Möbelabteilung in den dritten Stock, probierten ein paar Campingliegen aus, durchstreiften kurz die übrigen Etagen und verließen das Kaufhaus wieder.
Kurz vor Ladenschluss, gegen 18.30 Uhr, kehrten sie zurück. Das »Kaufhaus Schneider« war fast leer. Die Rolltreppen waren schon abgestellt, und die beiden späten Kunden stürmten Hand in Hand die Treppen hinauf. Ihre abgewetzte studentische Kleidung fiel auf. Verwundert blickten ein paar Verkäuferinnen ihnen nach.
Die beiden hatten eine Tasche dabei. Als sie sich unbeobachtet fühlten, holten sie daraus einen Brandsatz hervor und legten ihn im ersten Stock, in der Abteilung für Damenoberbekleidung, auf eine Schrankwand.
Der zweite Brandsatz wurde in der Möbelabteilung auf einem altdeutschen Schrank deponiert. Die Zeitzünderuhren waren auf Mitternacht gestellt. Kurz bevor die Kaufhaustüren geschlossen wurden, verschwanden die beiden wieder auf der Straße.
An diesem Abend wurden auch im »Kaufhof« BrandsätzeKaufhausbrandstiftung gelegt. Wer die Täter waren, konnte im späteren Prozess nicht eindeutig geklärt werden.
Kurz vor Mitternacht bemerkte der Inhaber eines Taxiunternehmens, der noch in seinem Büro saß, einen Feuerschein im dritten Stockwerk des »Kaufhauses Schneider«Kaufhaus Schneider gegenüber. Er rief die Feuerwehr. Als die Löschfahrzeuge eingetroffen waren, brach im ersten Stock ein weiteres Feuer aus. Etwa zur gleichen Zeit rief eine Frau im Frankfurter Büro der Deutschen Presseagentur an und sagte: »Gleich brennt’s bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Racheakt.«
Wenige Minuten nach dem Ausbruch des Feuers im »Kaufhaus Schneider« brannte es auch im »Kaufhof«. Ein Angestellter des Hauses war auf dem Weg zu einer auch nachts im vierten Stock arbeitenden Malerkolonne, als er hinter sich eine Explosion hörte. Er drehte sich um und sah in fünf bis zehn Metern Entfernung eine Flammenwand, die bis an die Decke reichte. Der Rauch trieb auf ihn zu, er hustete, ihm tränten die Augen, und er lief aus der brennenden Bettenabteilung. Inzwischen war auch in der Spielwarenabteilung Feuer ausgebrochen. Die Sprinkleranlage schaltete sich automatisch ein. Die Löschtruppen waren schnell da und brachten die Brände in kurzer Zeit unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Es entstand ein verhältnismäßig geringer Sachschaden – im Wesentlichen durch Löschwasser. Die Brandstellen wurden noch in der Nacht von Sachverständigen untersucht. Die Versicherung trug die Kosten: im »Kaufhaus Schneider« 282339 Mark, im »Kaufhof« 390865 Mark.
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt und Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt hatten im »Club Voltaire« die Sirenen der Feuerwehr hören können. Sie eilten zur Brandstelle und reihten sich in die Gruppe der Schaulustigen ein. Dann gingen sie zurück in den »Club Voltaire« und blieben, bis das Lokal frühmorgens geschlossen wurde. Eine Bekannte nahm sie mit in ihre Wohnung.
Am Abend darauf trafen alle wieder im »Club Voltaire« zusammen. Die Frau hatte ihr Kind mitgebracht, und zu später Stunde boten ihr Baader und seine Freunde gutgelaunt an, das Kind nach Hause zu bringen, damit die Mutter noch etwas im Club bleiben könne.
Gegen ein Uhr nachts ging sie zusammen mit ihrem Freund nach Hause. Die Besucher schliefen schon auf ihrem Matratzenlager im Wohnzimmer. So schlüpfte das Pärchen zum Kind ins Bett. Dem Freund behagte der fremde Besuch nicht. Ihr merkwürdig aufgekratztes Verhalten, ihre Andeutungen und die KaufhausbrändKaufhausbrandstiftunge machten ihn misstrauisch. Im Bett fragte er seine Freundin: »Glaubst du, dass die das waren?« – »Sei ruhig und rede nicht darüber«, antwortete sie. Morgens verließen die beiden die Wohnung. Sie hofften, dass die Besucher am Abend verschwunden sein würden.
Kurz vor 10.00 Uhr vormittags erhielt die Frankfurter Polizei einen »konkreten Hinweis« auf die Brandstifter. Wenige Minuten später waren Baader, Ensslin und die beiden anderen in der Wohnung festgenommen. Sie und das Auto wurden durchsucht. In Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnts Handtasche fanden die Beamten eine Schraube, deren Duplikat an einer der Brandbomben gefunden worden war. Im Auto entdeckten die Fahnder Uhrenteile, den Glühkopf eines Batteriezünders, Reste des Klebebandes, mit dem die Bomben umhüllt waren, und sonstige zum Bau eines Sprengsatzes geeignete Materialien.
Kurz nach der Festnahme besorgte sich die Frankfurter Polizei einen Hausdurchsuchungsbefehl für Baaders und EllosM., EllinorM., Ellinor Berliner Wohnung in der Badenschen Straße. Am 5. April ließen sich zwei Berliner Beamte die Wohnung von der Hauseigentümerin aufschließen. Sie war in »verwahrlostem Zustand«, ausgestattet mit »wenig Mobiliar«, wie die Polizisten notierten. ElloM., Ellinor kam die Treppe hoch. Als sie entdeckte, dass die ganze Wohnung voller Polizeibeamter war, verließ sie das Haus. Niemand hatte sie gesehen.
Am 10. April konnte die Polizei sie vernehmen. ElloM., Ellinor sagte, sie habe keine Veranlassung mehr, irgendwelche Rücksichten auf »B.« zu nehmen, obwohl er der Vater ihres »außerehelich« geborenen Kindes sei. Sie habe Angst vor ihm, weil er »rücksichtslos gegen mich auftrat und mich auch schon einmal geschlagen hat«. Einen Satz in ihrer Aussage markierten die Beamten mit einem dicken Balken: »Mein Eindruck war, dass Baader von Natur aus dazu neigte, Menschen zu beeinflussen und sie seinem Willen gefügig zu machen.«
Nach der Verhaftung bestritt Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt jegliche Beteiligung an den Brandanschlägen, die Übrigen verweigerten die Aussage. Sofort meldeten Zeitungen, die Festgenommenen seien Mitglieder des SDSSozialistischer Deutscher Studentenbund SDS gewesen, was nicht stimmte; sie hatten lediglich am Frankfurter SDS-Kongress teilgenommen.
Der SDS-Vorstand distanzierte sich von der Brandstiftung: »Der SDS ist zutiefst darüber bestürzt, dass es in der Bundesrepublik Deutschland Menschen gibt, die glauben, an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in diesem Land durch unbegründbare Terroraktionen ihrer Opposition Ausdruck verleihen zu können.«
Die »Kommune I«Kommune I dagegen erklärte sich solidarisch: »Wir haben Verständnis für die psychische Situation, die Einzelne jetzt schon zu diesem Mittel greifen lässt.«
Im internen Kreis äußerten sich die Mitglieder der »K1« ein wenig kritischer über die Frankfurter BrandstifteKaufhausbrandstifterr: »Das ist doch nur ein psychisches Versagen, die Leute wollen eigentlich in den Knast. Das Problem ist nur noch psychologisch zu erklären. Es ist in dem Sinne nicht mehr politisch, weil sie sich auch so dilettantisch verhalten haben, dass sie gleich verhaftet worden sind.«
Gerade diese psychische Ausgangsbasis konnten aber viele nachvollziehen, die in der APOAPO Außerparlamentarische Opposition mitmachten, erlebt hatten, wie die Berliner Polizei bei DemonstrationenDemonstration zuschlug, wie Springer-Zeitungen mit Schlagzeilen Stimmung gegen die Studenten machten, wie Benno OhnesorgOhnesorg, Benno erschossen und der Todesschütze KurrasKurras, Karl-Heinz freigesprochen worden war. Bommi BaumannBaumann, Michael Bommi, Randfigur der »Kommune I«Kommune I, schilderte das so: »Ob die da nun ein Kaufhaus angesteckt haben oder nicht, war mir im Augenblick scheißegal, einfach dass da mal Leute aus dem Rahmen ausgebrochen sind und so eine Sache gemacht haben, auch wenn sie es so angestellt haben, dass sie geschnappt worden sind. Die Brandstiftung ist natürlich auch eine Konkurrenzgeschichte. Wer die knallhärtesten Taten bringt, der gibt die Richtung an.«
Es wurde ernst. Wie ernst, zeigte sich eine Woche nach dem Brandanschlag, am Gründonnerstag 1968.
Ende März 1968 war der Berliner SDSSDS-Führer Rudi DutschkeDutschke, Rudi von der Jugendkommission der Christlichen Friedenskonferenz (CFK) nach Prag eingeladen worden, um dort den »Prager Frühling« aus nächster Nähe zu besichtigen; der neue Generalsekretär der Kommunistischen Partei Alexander DubčekDubACCENT77ek, Alexander wollte einen »Sozialismus mit menschlichem Antlitz« schaffen. Der weltweite Aufbruch hatte jetzt auch den Ostblock erreicht.
DutschkeDutschke, Rudi und seine Frau Gretchen steckten den Sohn Hosea in eine Tragetasche und fuhren nach Ostberlin, um den Zug nach Prag zu nehmen. Auf dem Bahnhof trafen sie Clemens KubyKuby, Clemens, Sohn des bekannten Publizisten Erich KubyKuby, Erich.
In Prag angekommen, zogen sie gemeinsam in ein kleines Hotel.
Am nächsten Tag stieß ich selbst dazu. Ich wollte für »konkret«konkret eine Geschichte über den »Prager Frühling« schreiben, da passte es gut, im Schlepptau des bekannten Studentenführers die Aktivisten der dortigen Revolution kennenzulernen. Bis dahin hatte ich Rudi DutschkeDutschke, Rudi nur flüchtig bei verschiedenen Demonstrationen und Teach-insTeach-Ins in Berlin getroffen. »Während der Woche in Prag«, so schrieb Gretchen DutschkeDutschke, Gretchen später in ihren Erinnerungen, »waren wir unzertrennlich.« Das hatte auch seinen guten Grund, denn Clemens KubysKuby, Clemens Vater hatte für die tschechoslowakischen Ausgaben seiner Bücher einige Honorare auf dem Konto liegen, die nicht aus dem Land herausgebracht werden durften. So gingen wir regelmäßig in das luxuriöseste Hotel Prags, das »Esplanade«, und bestellten, wie Gretchen schrieb, »ein mehrgängiges Luxusessen, das die halbe Nacht dauerte«.
Rudi DutschkeDutschke, Rudi, so schrieb ich damals in »konkret«konkret über die gemeinsame Reise, wollte feststellen, ob das, was sich in der ČSSR abspielte, »Demokratisierung war oder nur die Liberalisierung einer kommunistischen Diktatur, ob rote Palastrevolution oder antiautoritäre Massenbewegung, ob Veränderung auf dem Boden des Sozialismus oder Rückkehr zum bürgerlich-liberalen kapitalistischen System«.
Eine Woche lang diskutierte er mit Studenten und Journalisten, mit marxistischen Theoretikern und liberalen Pragmatikern. Ein Ohr am Telefon nach Frankfurt, wo zur selben Zeit der SDSSDS tagte, in Sorge um »die Bewegung«, erläuterte er Studenten die Ziele der Außerparlamentarischen OppositionAPO Außerparlamentarische Opposition in der Bundesrepublik.
Auf einer Diskussion in der philosophischen Fakultät der Karlsuniversität wurde DutschkeDutschke, Rudi mit jenen Vertretern des neuen Kurses in der ČSSR konfrontiert, die fasziniert auf die wirtschaftlichen Errungenschaften des kapitalistischen Westens starrten.
»Sprechen Sie als Prophet oder als Politiker?«, fragten Leute, denen man den Hang zur Utopie in 20 Jahren Stalinismus systematisch ausgetrieben hatte. Es wäre DutschkeDutschke, Rudi ein Leichtes gewesen, seine rhetorische Überlegenheit ins Feld zu führen und die Skeptiker in Grund und Boden zu diskutieren. Doch es kam ihm nicht auf einen Schaukampf an. Er war bemüht, redliche Antworten zu geben, Missverständnisse auszuräumen, er übte offene Selbstkritik, gab Unsicherheiten zu. Er überzeugte durch undogmatisches Verhalten. Eine gemeinsame Basis wurde gefunden, Kontakte zwischen Prag und Berlin wurden geknüpft.
Mit uns in Prag war Elisabeth KäsemannKäsemann, Elisabeth, die Tochter eines bekannten Theologie-Professors in Tübingen, die knapp zehn Jahre später, 1977, in Argentinien von den Schergen der Militärjunta entführt, gefoltert und anschließend ermordet wurde.
Während wir die frische Luft des Prager Frühlings spürten, kamen aus den USA die Nachrichten, dass US-Verteidigungsminister Robert McNamaraMcNamara, Robert zurückgetreten war und Präsident Lyndon B. JohnsonJohnson, Lyndon B. nicht wieder zur Wahl antreten wollte – und kurz darauf die Meldung, dass Martin Luther KingKing, Martin Luther in Memphis ermordet worden war.
In diesen Tagen erschien in Deutschland die neue Ausgabe des Wirtschaftsmagazins »Capital«, auf dem Titel ein Foto von Rudi DutschkeDutschke, Rudi im eleganten grauen Mantel, mit rotem Halstuch und dem »Kapital« von Karl MarxMarx, Karl unterm Arm. Das sorgte auf der außerordentlichen Delegiertenkonferenz des SDS in Frankfurt für reichlich Unmut. RudiDutschke, Rudi schrieb eine Erklärung an die »Revolutionären Genossinnen und Genossen«, in der er sich über die »Personalisierung der Bewegung« Gedanken machte: »So würde die antiautoritäre Bewegung identisch gesetzt mit DutschkeDutschke, Rudi und personalisiert fast im totalen Sinne.« Deshalb werde er jetzt für einige Zeit aus der BRD weggehen, um im Ausland politisch zu arbeiten.
Nach einer guten Woche in Prag fuhren wir zurück, die DutschkesDutschke, Rudi nach Berlin, ich nach Hamburg, wo das nächste Heft von »konkret«konkret fertiggestellt werden musste.
Kurz nach der Rückkehr schrieb Rudi DutschkeDutschke, Rudi seine Eindrücke nieder. Der Text trug die Überschrift »Von der Liberalisierung zur Demokratisierung«. Er begann folgendermaßen: »Wir fuhren nach Prag mit Schuldgefühlen und etwas deprimiert darüber, dass führende Genossen innerhalb des antiautoritären Lagers zueinander wenig Zutrauen haben, Ressentiments und Prestigefragen immer noch eine große Rolle spielen. Der sich im Kampf mit der herrschenden Klasse herausbildende neue Mensch hat neue Interessen, neue Bedürfnisse und auch neue Leiden, er definiert sich aber bestimmt nicht über die existierenden Massenmedien …«
Er kam nicht über zwei Schreibmaschinenseiten hinaus.
Der Redaktionsschluss rückte näher. So nahm ich das Flugzeug nach Berlin und traf mich mit DutschkeDutschke, Rudi und unserem Prager Reisebegleiter Clemens KubyKuby, Clemens in einem italienischen Restaurant. Als wir uns verabschiedeten, versprach RudiDutschke, Rudi, seinen Text zügig fertigzuschreiben – er müsse nur noch ins SDSSDS-Zentrum am Kurfürstendamm fahren, um Unterlagen für den Artikel abzuholen.
Am nächsten Morgen, es war Gründonnerstag, der 11. April 1968, telefonierte ich noch einmal mit Rudi, und wir verabredeten uns für den kommenden Sonntag, um gemeinsam seine Prag-Geschichte zu redigieren.
Strahlender Sonnenschein lag über Berlin. Über 100000 Gäste hatten sich für die Ostertage angemeldet. Der Senat forderte über Rundfunk die Bevölkerung auf, Privatquartiere für Berlin-Besucher zur Verfügung zu stellen.