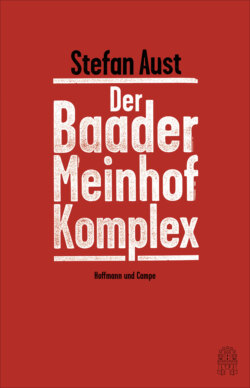Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 12
9. Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt geht nach Berlin
Оглавление1963, knapp zwanzigjährig, kam Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt nach Westberlin. Ob die Motorraddiebstähle, die Unfälle mit gestohlenen Autos oder der ständige Ärger mit der Münchner Polizei der Grund dafür waren, die Stadt zu wechseln, oder die häufigen Prügeleien in der kleinen überschaubaren Szene der bayerischen Hauptstadt, ist nicht klar auszumachen. Jedenfalls entging er durch diesen Umzug auch der Einberufung zur Bundeswehr.
Westberlin nach dem Mauerbau zog damals viele junge Westdeutsche an: Sie wollten raus aus Elternhäusern, Untermiete und engen Studentenbuden, wollten sich der Bundeswehr entziehen oder auch einfach nur in einer Stadt leben, die damals noch weit entfernt war von Gleichförmigkeit und Langeweile der wiederaufgebauten westdeutschen Städte. Westberlin hatte einiges zu bieten: eine vielfältige Kneipen- und Kunstszene, die es so wildwüchsig in anderen Städten nicht gab, und eine Menge leerstehender Großwohnungen: Viele wohlhabende Bürger hatten Berlin nach dem Bau der Mauer verlassen.
So konnte man dort eine Wohnung finden, die andernorts unerschwinglich war. Das Berliner Nachtleben kannte keine Polizeistunde und war im Verhältnis zum Westen dank Steuererleichterungen damals unvorstellbar billig.
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt nahm teil an diesem Nachtleben. Zu Beginn seiner Berliner Zeit arbeitete er kurzfristig als Praktikant bei der »Bild-Zeitung«.Bild Rausgeworfen worden sei er, so erzählte Baader, weil er betrunken, wie Tarzan an einem Kronleuchter schaukelnd, einem leitenden Redakteur mit den Füßen ins Gesicht getreten habe. Im »Kleist-Kasino«, einer traditionsreichen Schwulenbar, begegnete er dem Redakteur später wieder und verprügelte ihn.
Im »Kleist-Kasino« lernte er 1964 auch Ellinor M.M., Ellinor und H., ManfredManfred H. kennen. Ellinor (»ElloMichel, Ello«) malte naive Bilder, die sich gut verkauften. Sie war mit Manfred H. verheiratet, ebenfalls Maler, der sich gerade in der Kunstszene einen Namen machte. Das Ehepaar hatte ein Kind und lebte in einer weiträumigen Achtzimmerwohnung in Schöneberg.
Manfred, Ellinor und der drei Jahre jüngere Baader waren bald unzertrennlich. Baader zog zu ihnen. Nach außen wirkte diese Gemeinschaft wie eine Ehe zu dritt, begleitet von Besäufnissen und Prügeleien, in der Berliner Boheme der frühen sechziger Jahre nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich in dieser Szene waren eher Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnts Kneipenauftritte in teuren Jacketts, die so gar nicht in diese Umgebung passten. Es bereitete ihm offenbar Vergnügen, sein rüpelhaftes Auftreten mit eleganter Kleidung zu kombinieren. Er trug italienische Schuhe, seidene Hemden, und da es damals kaum eng geschnittenen Hosen gab, schneiderte er sie selbst. Unterhosen trug er nicht, weil, wie er meinte, »der Arsch und alles andere zur Geltung kommen muss«. Er schminkte sich, klebte sich auch mal falsche Wimpern an und benutzte oft und gern Parfum.
1966 lernte ihn der junge Schriftsteller Peter O. ChotjewitzChotjewitz, Peter O. in der »lesbischen Abfüllstation« S-Bahnquelle am Savignyplatz kennen: »Er war voller Widersprüche. Intellektuell und spontan, sanft und zupackend, witzig und flink, ungeduldig und cool. Ziemlich sexy.« In seiner Lederjacke, in Jeans und T-Shirt, schlank und schmalhüftig sei er ihm immer wie »auf dem Sprung« vorgekommen: »Mal abweisender, mal zärtlicher Blick. Meistens neugierig, manchmal gelangweilt, zuweilen spöttisch.« Baader habe versucht, ihn anzumachen: »Es war klar, dass er es tat, weil ich ihm gefiel, und das gefiel mir. Ich war etwas mädchenhaft damals. Er hatte eine lange Frau dabei, die ein Kind von ihm hatte, und er hatte einen Typ dabei, und es war vermutlich diese bisexuelle Situation, die mich anmachte.«
Den breitkrempigen Hut des verehrten Humphrey BogartBogart, Humphrey tief im Gesicht, zog Andreas über den Kurfürstendamm. In der gemeinsamen Wohnung wurde für einige Jahre eine Art künstlerisch-antibürgerlicher Salon etabliert. Zu einem sogenannten Jour fixe trafen sich am ersten Sonntag im Monat oft an die hundert Menschen, Künstler und Kunsthändler, Kritiker, Psychiater, Rechtsanwälte und Journalisten. Eine bunte Versammlung gesellschaftlich Arrivierter, die sich mit denen mischten, die ElloM., Ellinor, Andreas und Manfred bei ihren Streifzügen durch die Berliner Nächte aufgelesen hatten, Transvestiten und Prostituierte, die ersten Drogenhändler aus dem Umfeld der U.S. Army, Schauspieler vom Living Theatre. Baader stellte sich gern als unmittelbarer Nachfahre des in literarischen Kreisen bekannten Philosophen Joseph von BaaderBaader, Joseph von dar, einem Erfinder und religiösen Denker, der SchellingSchelling, Friedrich Wilhelm Joseph von beeinflusst hatte. Seine Mutter, erzählte er, sei Staatsanwältin. Von sich selbst zeichnete er das Bild eines Wunderknaben, der bereits im jugendlichen Alter von sechzehn Jahren von berühmten Philosophen zu Disputen herausgefordert worden sei. Je nach Milieu gab er sich aber auch als erfahrener Autoknacker oder souveräner Einbrecher. Besonders liebte er es, verklemmte Intellektuelle mit der Beschreibung unglaublicher sexueller Ausschweifungen zu schockieren; eigenen, ausgedachten und von anderen gehörten. Material lieferte ihm die »Neue deutsche Gerichtszeitung«, ein Sado-Maso-Blättchen, das unter dem Vorwand des gesunden deutschen Volksempfindens voller Begeisterung darüber berichtete, was alles an sexueller Abweichung vor Gericht verhandelt wurde.
Die traditionelle LinkeLinke oder das, was sich zur gleichen Zeit in seiner nächsten Umgebung als ProtestProtestbewegungbewegung zu entwickeln begann, fand in diesen Jahren nie sein Interesse. Schwarze Messen zu beschreiben lag ihm näher, als rote Fahnen zu schwenken.
1965 bekam seine Freundin ElloM., Ellinor ein Kind. Andreas war der Vater. Zusammen mit EllosM., Ellinor Ehemann wartete er vor dem Krankenhaus stundenlang auf die Geburt. Fast zwei Jahre lang lebten die beiden Männer mit der Frau und zwei Kindern zusammen.
Die aufkommende Protestbewegung ergriff auch die Künstlerszene. Plötzlich gerieten völlig unbekannte Leute in die Schlagzeilen und wurden über Nacht berühmt. Im Sommer 1967 verbrannte Baaders Freund ManfredH., Manfred öffentlich auf dem Kurfürstendamm seine Bilder. Die Aktion hieß: »Der Maler schmeißt den Pinsel weg und macht Kommune!« Ein Teil der Berliner Kunstszene vermischte sich mit der Protestbewegung.
Baader war dabei, fiel aber nicht weiter auf bei den politischen Albereien der Kommunarden. Ein Weggefährte von damals, der Kunstmaler und Autor Peter HomannHomann, Peter, beschrieb ihn als »eine Figur, mit der man sich gerne unterhielt, die man manchmal auch ziemlich bescheuert fand. Er war einer der vielen Spinner, die es in dieser Szene gab.«
Für Andreas’ Mutter AnnelieseBaader, Anneliese war er »ein Junge, der sich nie so leicht angepasst hat, der immer gefragt hat, der immer nachdenklich wirkte«. Sie habe gewusst: »Wenn er etwas tut, dann wird er es mit allen Konsequenzen tun. Ich hab immer auch ein bisschen Angst gehabt.«
Ein von Mutter, Großtante und Tante verwöhntes Kind, das seine Aggressionen in der Schule auslebte so wie später im linkeLinken Milieu Berlins. Der damalige Anwalt der Außerparlamentarischen Opposition Horst MahlerMahler, Horst erinnerte sich: »Er sagte immer: Bringst du das? Du musst das bringen. Für ihn war es keine Frage, er brachte es. So gesehen hatte er also eine kriminelle Ader, ganz eindeutig.«
Peter HomannHomann, Peter war zu der Zeit viel mit Baader in Berlin unterwegs. Er erinnerte sich an die große Kneipenszene, in der sich »vieles, auch das Vorpolitische und das Halbpolitische«, abspielte: »Und da war Baader eigentlich immer dabei, als ein Typus, der sich für Politik überhaupt nicht interessierte, sondern eher zu Hause war, in psychischen Abenteuern, sexuellen Abenteuern, von denen er immer erzählte, aber von denen wir gar nicht wussten, ob er sie auf irgendeine Weise realisierte.«