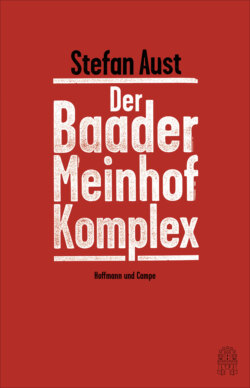Читать книгу Der Baader-Meinhof-Komplex - Stefan Aust - Страница 23
20. Der Brandstifterprozess
ОглавлениеAm 23. April 1968 besuchte Bernward VesperVesper, Bernward seine ehemalige Verlobte Gudrun in der Haftanstalt Frankfurt-PreungesheimJustizvollzugsanstalten:Frankfurt-Preungesheim. Anschließend schrieb er an seine Mutter: »Gudrun bietet ein Bild des Jammers, sie ist alt geworden und sehr abgemagert, die Haare gehen ihr aus, und irgendwie löst sich ihr Verhältnis zur Welt auf.«2 Fotos: Gegenüberstellung Ensslin / Baader
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt beantwortete am 10. Mai einen Brief der »Kommune IKommune I« mit Gefängnisimpressionen: »Knast, trübe und schwierig, Triebverzicht auf jeden Fall, irgendetwas im Fraß, das ruhig und elegisch machen soll, mich trotzdem tanzen lässt wie eine Ratte.« Hoffnungsvoll ergänzte er: »Verhandlungen wahrscheinlich im Juli (wenn Bonn längst gefallen ist, lasst uns ein Stück der NATO übrig), sonst Depressionen und der ganze Dreck …«
Gudrun bestellte sich im Melzer Verlag die pornographische »Geschichte der O« mit dem Hinweis, sie habe das Buch »vor vielen Jahren versucht, auf Französisch« zu lesen, doch das sei zu mühselig gewesen. Baader schrieb an den Mittäter Thorwald ProllProll, Thorwald, offenbar über Gudrun: »Wie ich sage, die Alte darbt, wenn sie nicht fickt.«
Bernward VesperVesper, Bernward schien sich mit Gudruns Psyche gut auszukennen. Er schrieb ihr: »Liebe, du musst deine Geschichte zu Ende machen; um frei zu werden. Du musst erst dahin kommen, dass nichts und niemand dir helfen kann (noch verlässt du dich innerlich, deshalb gehst du von einer Unfreiheit in die nächste).«
VesperVesper, Bernward schickte ihr zum Geburtstag »28 irrsinnig schöne Rosen« und »Tonnen barbarisch guter Wurst«, wie Gudrun ihm in artigen Dankesworten schrieb. Eine Beamtin habe ihr gesagt: »So einen Mann finden Sie nie wieder.« Die Fotos ihres gemeinsamen Kindes hätten sie daran erinnert, wie lange das alles noch dauern würde: »O Gott! Ich darf alles, nur nicht verrückt werden, den langen Weg nicht aus den Augen lassen.«
Die Nachrichten überschlugen sich: 50000 Leute zur Maidemonstration in Berlin, NotstandsdemonstrationNotstandsdemonstration in Bonn, Streiks und Institutsbesetzungen als Protest gegen die NotstandspläneDemonstrationen:Notstandsgesetze der Bonner Regierung an fast allen Hochschulen, SDS-Kongress in Frankfurt mit einer Rebellion der Frauen, Beate KlarsfeldKlarsfeld, Beates Ohrfeigenaktion gegen Bundeskanzler KiesingerKiesinger, Kurt Georg, Demonstration in Frankfurt gegen die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den senegalesischen Präsidenten SenghorSenghor, Léopold Sédar.
Während dieses aufrührerischen Sommers 1968 saßen die Frankfurter KaufhausbrandstifterKaufhausbrandstifter im Gefängnis.
Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt hatte sich in der Untersuchungshaft verhältnismäßig gut in den Anstaltsbetrieb eingegliedert. Sie nahm an einem politisch-literarischen Arbeitskreis der Gefangenen teil, begegnete anfangs den Ressentiments der übrigen, aus der sozialen Unterschicht stammenden Mitgefangenen, konnte die Widerstände aber überwinden. Die Anstaltsleiterin von PreungesheimPreungesheim, Helga EinseleEinsele, Helga, fand, sie sei »ein eindrucksvoller Mensch, weil sie so absolut ist, notfalls mit dem LebenRAF:Todesbereitschaft für ihre Überzeugung eintritt«.
Aus der Haft schrieb sie an ihren Anwalt Professor Ernst HeinitzHeinitz, Ernst in Berlin, den sie über seine Beratertätigkeit für die »Studienstiftung des deutschen Volkes«Studienstiftung des Deutschen Volkes kennengelernt hatte:
»Sehr verehrter, lieber Herr Professor HeinitzHeinitz, Ernst, ich mag damit nicht warten, weil ich mich wirklich sehr darüber freue: Ihnen ganz herzlich für die herrlichen Schokoladen und die allerwichtigsten Zigaretten zu danken! Solche Dinge (aus dem Himbeerreich) versehen die Zelle und das heißt eben mich selbst mit einem Glanz, der unendlich wohltut – aber das wissen Sie.
Herzliche Grüße Ihre Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt.«
In der Zwischenzeit war der bei dem Anschlag schwerverletzte Rudi DutschkeDutschke-AttentatDutschke, Rudi auf dem Weg zur Besserung.
Der Komponist Hans WernerWerner, Hans-Ulrich Henze stellte ihm sein Anwesen in der Nähe von Rom zur Verfügung. Dort erhielt er Besuch von Bernward VesperVesper, Bernward und Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73. Vesper wollte in seiner »Voltaire Edition« einen Band »Briefe an Rudi D.« herausbringen. Dutschke notierte am 18. August in seinem Tagebuch: »Ulrike wollte schon Interview, war mit Vesper gekommen. Wie schwer war mir schon die Einleitung zu den Briefen gefallen.«
Auf der Reise versuchte Vesper, mit Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 anzubändeln. Später schrieb er darüber: »Ich will nicht, dass du mich ins Bett quatschen musst, sagte Ulrike. Das Zimmer war blau. Beim ersten Zug war sie high. Später weinte sie. Über das Loch in ihrem Schädel spannte sich eine dünne Haut, sagte Klaus Rainer RöhlRöhl, Klaus Rainer …«
In Rom, an der Fontana di Trevi, blieben die beiden stehen. »Jetzt wirfst du mir vor, dass wir für Konkretkonkret Geld aus der DDR angenommen haben?«, fragte Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite. »Nein«, sagte Vesper. Dann »saugten ihn die Straßen, die Kulissen« weg. »Ganz in der Ferne, auf jenem Platz, der aussieht wie eine Riesenvotze, in der der Obelisk eines Penis steht, blieb sie zurück«, schrieb er.
Es war der Platz, an dem ich mich, fast genau zwei Jahre später, mit Klaus Rainer RöhlRöhl, Klaus Rainer verabredete, um ihm Ulrikes und seine Kinder, die entführten Zwillinge RegineRöhl, Regina und BettinaRöhl, Bettina, zu übergegeben.
Am 14. Oktober 1968 begann der ProzessKaufhausbrandstifter:Prozeß gegen die Kaufhausbrandstifter. Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt trug eine weinrote Kunstlederjacke im Military-Look. Lachend umarmten die vier einander und warfen mit Bonbonpapier.
Neun Anwälte saßen auf der Verteidigerbank, unter ihnen Otto SchilySchily, Otto, Horst MahlerMahler, Horst und Professor HeinitzHeinitz, Ernst.
Die Angeklagten äußerten sich zunächst nicht zu ihrer Tat. »Gegen eine KlassenjustizKlassenjustiz, in der die Rollen verteilt sind«, erklärten sie, »lohnt sich eine Verteidigung nicht.« Die politische Demonstration, die im Bekenntnis zur Brandstiftung lag, musste einstweilen hinter der Angst zurückstehen, für Jahre im Gefängnis zu landen.
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt bat seine alte Freundin ElloM., Ellinor um ein gutes Leumundszeugnis vor Gericht. Er schrieb ihr zwei Tage nach Prozessbeginn: »Weil es jetzt schließlich um sieben Jahre gehen soll oder vielleicht nur um drei (und du vielleicht willst, dass wir irgendwann wieder bummsen, streiten und lieben), ist wichtig, was die für ein Bild von mir haben, und weil ich nichts über mich sagen kann, wirst du es malen müssen.« Es müsse ein »Gesang dreckiger grüner Lügen« sein, etwa so: Soweit sie sich erinnern könne, sei er jemand, der niemals auf die Idee komme, ein KaufhausKaufhausbrandstifter anzuzünden. Er sei immer nur für spielerische und nicht für gewaltsame Aktionen gewesen.
Dann versuchte er, ElloM., Ellinor dazu zu bringen, frühere Aussagen über seinen gewalttätigen Charakter zurückzunehmen: »Katze – du sagst, dass ich dich einmal geschlagen habe, als ich besoffen war, dass sie es aus dir rausgepresst haben, dir in den Mund gelegt, genau wie die Idee, ich sei jemand, der anderen seinen Willen aufzwingt.«
Erst am dritten ProzessKaufhausbrandstifter:Prozeßtag meldeten sich die Angeklagten zu Wort. Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt sagte: »Im Einverständnis mit Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt will ich etwas erklären: Er und ich haben es im »Kaufhaus SchneiderKaufhaus Schneider« gemacht. Keiner der anderen war es.« Es sei nicht ihre Absicht gewesen, Menschen zu gefährden, sie hätten nur Sachen beschädigen wollen. »Wir taten es aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in VietnamDemonstration:Vietnamkrieg zusehen.« Man solle ihr aber nicht mit der billigen Erklärung kommen, dass man in einer Demokratie den ProtestProtestbewegung laut äußern könne. »Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln unrecht ist.« Zugleich räumte sie aber ein, die Aktion sei »ein Fehler und ein Irrtum« gewesen. »Darüber werde ich aber nicht mit Ihnen diskutieren, sondern mit anderen.«
Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnt ergänzte: »Ich gebe zu, am 2. April nach Ladenschluss in einen altdeutschen Schrank im »Kaufhaus Schneider« eine Tüte gelegt zu haben, die eine Maschine enthielt. Sie sollte den Schrank zerstören, mehr nicht. Wir hatten nicht den Vorsatz, Menschen zu gefährden oder auch nur einen wirklichen Brand zu verursachen.« Die beiden anderen Angeklagten, Thorwald Proll und Horst Söhnlein, schwiegen.
Am vierten Tag sagte Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnts ehemaliger Verlobter Bernward VesperVesper, Bernward als Zeuge aus. Er überreichte Gudrun rote Rosen und hielt danach ein einstündiges flammendes Plädoyer für die Angeklagte.
Kurz nach der Geburt des gemeinsamen Kindes habe Gudrun an einer VietnamDemonstration:Vietnamkriegdemonstration teilgenommen. Ein Polizist habe gefragt, was sie sich dabei denke, zu DemonstrationenDemonstration zu gehen, wenn sie ein Kind von sechs Wochen habe. »Gerade deshalb demonstriere ich, weil ich jetzt die Verantwortung für mein Kind habe«, antwortete Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt.
»Ich habe manchmal gedacht«, sagte Vesper, »dass es für sie unmöglich war, diese inneren Widersprüche auszuhalten.« Gudruns Weg, so führte er vor Gericht aus, sei »eine deutliche, nachweisbare Kette von Frustration, die das sensible und zugleich willensstarke, ohnmächtige und zugleich Veränderung erstrebende Bewusstsein erfährt«. Schon im heimischen Pfarrhaus habe sie den Widerspruch zwischen religiöser Ideologie und der Praxis erfahren, der »sichtbar wurde, als ihr selbst der Ausbruch aus dem sexualitätsverneinenden, zu Passivität und Masochismus drängenden Elternhaus gelingt und sie das Liebesverbot durchbricht«. Durch die Auseinandersetzung mit der Kirchengemeinde und der Beschäftigung mit dem Dichter Hans Henny JahnnJahnn, Hans Henny sei ihr klar geworden, »dass in der Geschichte der Religion mehr Menschen ermordet wurden als in den KZKonzentrationslager des Nazismus«.
Er setzte VietnamDemonstration:Vietnamkrieg mit AuschwitzAuschwitz gleich und kam zu dem Ergebnis: »Nicht das Verbrechen wird bekämpft, sondern derjenige, der es bewusst macht.« Am Ende war er bei der Psychopathologie des Protestes angelangt: »Jeder Psychoanalytiker kennt die Phase, in der ein Patient ihn attackiert, wenn er sich im Verlauf der Behandlung den entscheidenden Komplexen nähert. Das Gleiche geschieht mit denjenigen, die die kranke Gesellschaft zwingen, ihre eigene Krankheit einzugestehen. Sie verfallen der Verurteilung.«
Als Einzige der vier Angeklagten hatte sich Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt bereit erklärt, mit einem vom Gericht bestimmten Gutachter zu sprechen, dem Frankfurter Psychiater und Gerichtsmediziner Reinhard RethardtRethardt, Reinhard. Dreimal sprach er jeweils ein bis zwei Stunden mit Gudrun. Der Psychiater gewann den Eindruck, sie sei »von einer außerordentlich verbindlichen Freundlichkeit, aber innerlich starr, unabdingbar«.
Einmal sagte Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt: »Wir wollen kein Blatt in der Kulturgeschichte sein.« RethardtRethardt, Reinhard antwortete: »Das ist der Schrei des Menschen nach Ewigkeit.«
Der Psychiater kam zu dem Ergebnis: »Sie hatte eine heroische Ungeduld. Sie leidet unter dem Ungenügen unserer Existenz. Sie wollte nicht mehr warten. Sie wollte in die Tat umsetzen, was sie letztlich im Pfarrhaus gelernt hatte. Sie wollte den Nächsten en gros erfassen – gegen seinen Willen. Die BrandstiftungKaufhausbrandstiftung ist ein Versuch gewesen, ein paar Treppen auf den Stufen zu überspringen. Sie denkt einen Gedanken unbeirrt bis zum Ende, bis vor die Wand.«
Im Prozess erstattete RethardtRethardt, Reinhard sein Gutachten mündlich. Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt schien es plötzlich peinlich zu sein, dass sie sich so lange und intensiv mit dem Psychiater unterhalten hatte, und sie versuchte, ihn durch spitze Fragen in die Enge zu treiben. Der Psychiater erklärte sich das so: »Sie hat das getan, um die Eintrittskarte zurück zur Gruppe zu bekommen.«
Gegen Ende des Prozesses plädierten die Verteidiger. Professor HeinitzHeinitz, Ernst, der Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt vertrat, sagte: »Die Angeklagte ist nicht nur Überzeugungstäterin, sondern Gewissenstäterin.« Es liege auf der Hand, dass sie mit der BrandstiftungKaufhausbrandstiftung die Öffentlichkeit aus ihrer Gleichgültigkeit gegenüber dem VietnamkriegDemonstration:Vietnamkrieg habe aufrütteln wollen. Dies sei eine Gewissensentscheidung der Angeklagten gewesen: »Es gibt nun einmal auch ein irrendes Gewissen.«
Rechtsanwalt Horst MahlerMahler, Horst versuchte, als Verteidiger Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnts dem Gericht die Motive für die Brandstiftung nahezubringen. Das Grundmotiv sei nicht in erster Linie ProtestProtestbewegung gegen den Vietnamkrieg gewesen, sondern eine Rebellion gegen eine Generation, die in der NS-Zeit millionenfache Verbrechen geduldet und sich dadurch mitschuldig gemacht habe. Die Angeklagten hätten daraus die Konsequenz gezogen, sich auf keinen Fall mehr in eine Gesellschaft einzuordnen, die auf Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Unterdrückung beruhe.
Die Richter seien vermutlich nicht in der Lage, diese Gedankengänge nachzuvollziehen, »sonst müssten Sie Ihre Roben ausziehen und sich an die Spitze der Protestbewegung setzen«. Zum Schluss bat der Verteidiger um ein mildes Urteil. »Das Zuchthaus ist nicht der richtige Aufenthalt für diese Angeklagten. Wenn sie trotzdem ins Zuchthaus geschickt werden, so könnte man die Schlussfolgerung ziehen, dass in dieser Gesellschaft das Zuchthaus der einzige Aufenthaltsort für einen anständigen Menschen ist.«
Ursprünglich schwebte dem Anwalt MahlerMahler, Horst eine eher literarische Verteidigung Andreas BaaderBaader, Andreas durchgängig erwähnts vor. Im Aktenbestand des Sozialistischen Anwaltskollektivs BerlinSozialistisches Anwaltskollektiv Berlin fand sich später ein mehrseitiger »Vermerk fürs Plädoyer im BrandstifterprozessKaufhausbrandstifter:Prozeß«. Danach hatte er zunächst erwogen, im Gerichtssaal eine längere Passage aus Hermann HesseHesse, Hermanns »Steppenwolf« verlesen zu lassen, weil sie eine »verschlüsselte Darstellung des sozialen Gehaltes der Tat der Angeklagten« enthalte.
In seiner Notiz fasste MahlerMahler, Horst den Inhalt des damaligen Kultromans der links-alternativen Szene zusammen und identifizierte dabei Baader mit der Hauptgestalt: »Der Held und Ich-Erzähler, unbestimmter sozialer Herkunft, Prof. oder Schriftsteller, lebt als Fremder in gutbürgerlicher Umgebung. Er wird allmählich immer lebloser, erstarrter, zu Menschen und Dingen beziehungsloser. Seine bürgerliche Umgebung erlebt er als die Wirklichkeit des Todes, als die Vergewaltigung des menschlichen Traums. Er läuft in seiner Welt herum, einsam, erkaltend, verzweifelt, als Steppenwolf. Da begegnet ihm Hermine, ein bisexuelles Wesen. Sie macht ihn mit ihren Freunden bekannt. Er erlebt die Gegenwelt, die antibürgerliche Subkultur. Allmählich lässt sein Krampf nach. Er wird wieder lebendig, er hat jetzt die Kraft, seinen Traum von Leben gegen die entfremdete Umwelt durchzusetzen. Das Leben gegen die Zerstörungsmacht dieser Welt zu behaupten kann nur heißen, das System der Zerstörungsmaschinen zu zerstören, und so gesellt sich zu ihm der Theologe, dem Theologie dieser Welt Tat bedeutet.«
MahlerMahler, Horst schilderte den Höhepunkt des Romans, auf dem in einer surrealistischen Ballnacht eine Jagd auf Automobile eröffnet wird: »Wie Wild werden sie abgeschossen und verenden mit ihren Insassen. Töten in diesem Kampf macht einen gewissen Spaß, wenn auch aus Verzweiflung. Das Wissen, dass ihr Tun keinen realen Erfolgswert hat. Die anderen sind stärker. Aber sie wissen auch, dass sie keine Wahl haben. Vor allem, man muss handeln. Und am Ende steht dann doch die Schuld. Allerdings eine Schuld, die auf die Welt zurückfällt. Sie haben um der Menschlichkeit willen Menschen getötet.«
Kaum jemals hat ein Mitglied der RAF die PsychopathologieRAF:Psychopathologie der Gruppe so genau gekennzeichnet wie Horst MahlerMahler, Horst in seinem nie gehaltenen Plädoyer. Am Ende kommt er zu dem, im Manuskript gestrichenen, Schluss: »Von der Position des bürgerlichen Humanismus aus kann das Individuum als Mensch sich nur in der abstrakten Negation der bürgerlichen Welt bewahren, d.h. in seiner Selbstzerstörung … Die Angeklagten waren weiter als Hesses Steppenwolf …«
MahlerMahler, Horst, damals noch kein Terrorist, hatte das Grundmotiv auf den literarischen Punkt gebracht: Der Akt der Befreiung im Akt der Vernichtung. »SelbstmordMeinhof, Tod:Selbstmord 73 als letzter Akt der Rebellion«, wie Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite Jahre später an den Rand eines Briefes schrieb.
Noch während des Prozesses besuchte die Kolumnistin Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite 73 die Angeklagte Gudrun EnsslinEnsslin, Gudrun durchgängig erwähnt in der Haftanstalt. Sie wollte für »konkret«konkret- einen Artikel schreiben und war tief beeindruckt von der schwäbischen Pfarrerstochter, die mit ihr selbst, ihrer Denkweise, ihrem eigenen Engagement so viel gemeinsam hatte. Nur, Gudrun Ensslin hatte nicht nur geredet, sie hatte etwas getan. Der Bericht über das Gespräch mit Gudrun Ensslin wurde nicht geschrieben. »Wenn das veröffentlicht wird, was sie mir gesagt hat«, erklärte Ulrike Meinhof in der »konkret«-Redaktion, »kommen die nie aus dem Gefängnis. Auf die Frage: ›Würdet ihr auch die BrandstiftungKaufhausbrandstiftung gemacht haben, wenn das Hausmeisterehepaar in dem Haus anwesend gewesen wäre?‹ kam die ganz klipp-und-klare Antwort: ›Ja!‹ Das war Ensslin, die die Antwort gegeben hat.«
Statt des Interviews schrieb Ulrike MeinhofMeinhof, Ulrike Marie durchgängig erwähnt bis Seite einen Kommentar mit dem Titel »WarenhausbrandWarenhausbrandstiftung, Aufruf zurstiftung«:
»Gegen Brandstiftung im Allgemeinen spricht, dass dabei Menschen gefährdet werden könnten, die nicht gefährdet werden sollen.
Gegen Warenhausbrandstiftung im Besonderen spricht, dass dieser Angriff auf die kapitalistische Konsumwelt – und als solchen wollten ihn wohl die im Frankfurter Warenhausbrandprozess Angeklagten verstanden wissen – eben diese Konsumwelt nicht aus den Angeln hebt. Den Schaden – sprich Profit – zahlt die Versicherung …
So gesehen ist Warenhausbrandstiftung keine antikapitalistische Aktion, eher systemerhaltend, konterrevolutionär.
Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren, es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch …«
Am 31. Oktober 1968 wurde das Urteil gegen die vier verkündet: je drei Jahre Zuchthaus, mehr, als die meisten ProzessKaufhausbrandstifter:Prozeßbeobachter erwartet hatten. Der Vorsitzende meinte, die Angeklagten seien keine wirklichen Überzeugungstäter, sonst hätten sie nicht sieben Monate gebraucht, um sich zu ihrer Tat zu bekennen.
Die Urteilsverkündung ging in Tumulten unter. Der Studentenführer Daniel Cohn-BenditCohn-Bendit, Daniel brüllte: »Die gehören zu uns.« Baader und SöhnleinSöhnlein, Horst sprangen über die Barriere und liefen im Zickzack durch den Gerichtssaal. Es kam zu Gerangel zwischen Zuschauern und Gerichtspersonal. Draußen flogen Rauchbomben, eine Studentin wurde bewusstlos ins Freie getragen.